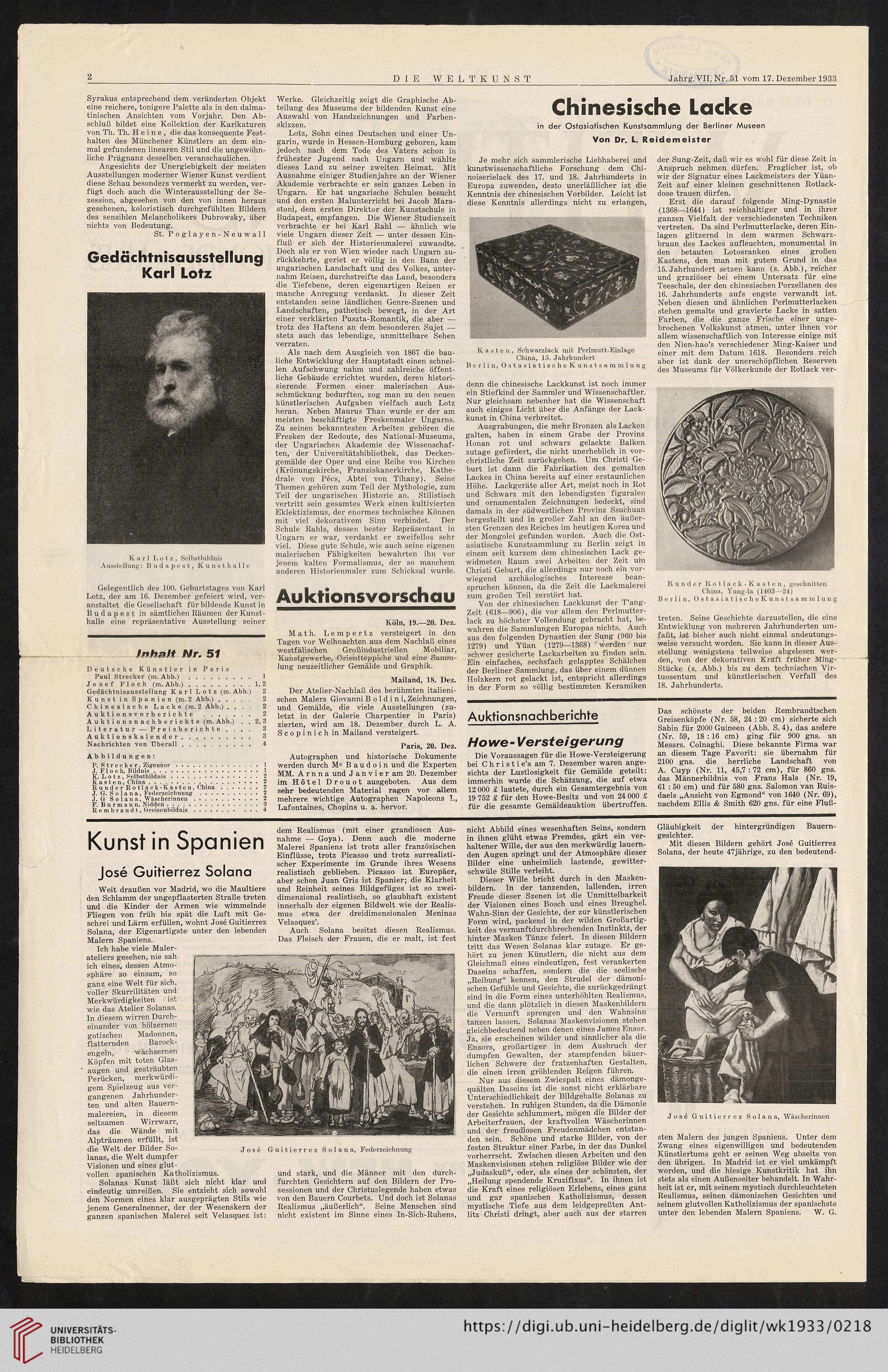2
DIE WELT KUNST
Jahrg.VII, Nr. 51 vom 17. Dezember 1933
Syrakus entsprechend dem veränderten Objekt
eine reichere, tonigere Palette als in den dalma-
tinischen Ansichten vom Vorjahr. Den Ab-
schluß bildet eine Kollektion der Karikaturen
von Th. Th. Heine, die das konsequente Fest-
halten des Münchener Künstlers an dem ein-
mal gefundenen linearen Stil und die ungewöhn-
liche Prägnanz desselben veranschaulichen.
Angesichts der Unergiebigkeit der meisten
Ausstellungen moderner Wiener Kunst verdient
diese Schau besonders vermerkt zu werden, ver-
fügt doch auch die Winterausstellung der Se-
zession, abgesehen von den von innen heraus
gesehenen, koloristisch durchgefühlten Bildern
des sensiblen Melancholikers Dubrowsky, über
nichts von Bedeutung.
St. Poglayen-Neuwall
Gedächtnisausstellung
Karl Lotz
Karl Lotz, Selbstbildnis
Ausstellung: Budapest, Kunst halle
Gelegentlich des 100. Geburtstages von Karl
Lotz, der am 16. Dezember gefeiert wird, ver-
anstaltet die Gesellschaft für bildende Kunst in
Budapest in sämtlichen Räumen der Kunst-
halle eine repräsentative Ausstellung seiner
Jnhalf Nr. 51
Deutsche Künstler in Paris
Paul Strecker (m. Abb.). 1
Josef Floch (m. Abb.).1,2
Gedächtnisausstellung Karl Lotz (m. Abb.) 2
Kunst in Spanien (m. 2 Abb.). 2
Chinesische Lacke (m. 2 Abb.) .... 2
A u k t i o n s v o r b e r i c h t e . 2
Auktionsnachberichte (m. Abb.) . . 2, 3
Literatur — Preisberichte . . . . 3
Auktionskalender. 3
Nachrichten von Überall. 4
Abbildungen:
P. S tr e cke r, Zigeuner.1
J. Floch, Bildnis.1
K, Lotz, Selbstbildnis.2
Kasten, China. 2
Runder Rotlack-Kasten, China.2
J. G. Solana, Federzeichnung .2
J. G S o 1 an a, Wäscherinnen.2
F. B u r m a n n, Nidden .3
Rembrandt, Greisenbildnis.4
Werke. Gleichzeitig zeigt die Graphische Ab-
teilung des Museums der bildenden Kunst eine
Auswahl von Handzeichnungen und Farben-
skizzen.
Lotz, Sohn eines Deutschen und einer Un-
garin, wurde in Hessen-Homburg geboren, kam
jedoch nach dem Tode des Vaters schon in
frühester Jugend nach Ungarn und wählte
dieses Land zu seiner zweiten Heimat. Mit
Ausnahme einiger Studienjahre an der Wiener
Akademie verbrachte er sein ganzes Leben in
Ungarn. Er hat ungarische Schulen besucht
und den ersten Malunterricht bei Jacob Mara-
stoni, dem ersten Direktor der Kunstschule in
Budapest, empfangen. Die Wiener Studienzeit
verbrachte er bei Karl Rahl — ähnlich wie
viele Ungarn dieser Zeit — unter dessen Ein-
fluß er sich der Historienmalerei zuwandte.
Doch als er von Wien wieder nach Ungarn zu-
rückkehrte, geriet er völlig in den Bann der
ungarischen Landschaft und des Volkes, unter-
nahm Reisen, durchstreifte das Land, besonders
die Tiefebene, deren eigenartigen Reizen er
manche Anregung verdankt. In dieser Zeit
entstanden seine ländlichen Genre-Szenen und
Landschaften, pathetisch bewegt, in der Art
einer verklärten Puszta-Romantik, die aber —
trotz des Haftens an dem besonderen Sujet —
stets auch das lebendige, unmittelbare Sehen
verraten.
Als nach dem Ausgleich von 1867 die bau-
liche Entwicklung der Hauptstadt einen schnel-
len Aufschwung nahm und zahlreiche öffent-
liche Gebäude errichtet wurden, deren histori-
sierende Formen einer malerischen Aus-
schmückung bedurften, zog man zu den neuen
künstlerischen Aufgaben vielfach auch Lotz
heran. Neben Maurus Than wurde er der am
meisten beschäftigte Freskenmaler Ungarns.
Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören die
Fresken der Redoute, des National-Museums,
der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten, der Universitätsbibliothek, das Decken-
gemälde der Oper und eine Reihe von Kirchen
(Krönungskirche, Franziskanerkirche, Kathe-
drale von Pecs, Abtei von Tihany). Seine
Themen gehören zum Teil der Mythologie, zum
Teil der ungarischen Historie an. Stilistisch
vertritt sein gesamtes Werk einen kultivierten
Eklektizismus, der enormes technisches Können
mit viel dekorativem Sinn verbindet. Der
Schule Rahls, dessen bester Repräsentant in
Ungarn er war, verdankt er zweifellos sehr
viel. Diese gute Schule, wie auch seine eigenen
malerischen Fähigkeiten bewahrten ihn vor
jenem kalten Formalismus, der so manchem
anderen Historienmaler zum Schicksal wurde.
Auktionsvorschau
Köln, 19.—20. Dez.
Math. Lempertz versteigert in den
Tagen vor Weihnachten aus dem Nachlaß eines
westfälischen Großindustriellen Mobiliar,
Kunstgewerbe, Orientteppiche und eine Samm-
lung neuzeitlicher Gemälde und Graphik.
Mailand, 18. Dez.
Der Atelier-Nachlaß des berühmten italieni-
schen Malers Giovanni B o 1 d i n i, Zeichnungen,
und Gemälde, die viele Ausstellungen (zu-
letzt in der Galerie Charpentier in Paris)
zierten, wird am 18. Dezember durch L. A.
Scopinich in Mailand versteigert.
Paris, 20. Dez.
Autographen und historische Dokumente
werden durch Me B a u d o i n und die Experten
MM. A r n n a und J a n v i e r am 20. Dezember
im Hotel Drouot ausgeboten. Aus dem
sehr bedeutenden Material ragen vor allem
mehrere wichtige Autographen Napoleons I.,
Lafontaines, Chopins u. a. hervor.
Chinesische Lacke
in der Ostasiatischen Kunstsammlung der Berliner Museen
Von Dr. L. Reidemeister
Je mehr sich sammlerische Liebhaberei und
kunstwissenschaftliche Forschung dem Chi-
noiserielack des 17. und 18. Jahrhunderts in
Europa zuwenden, desto unerläßlicher ist die
Kenntnis der chinesischen Vorbilder. Leicht ist
diese Kenntnis allerdings nicht zu erlangen,
Kasten, Schwarzlack mit Perlmutt-Einlage
China, 15. Jahrhundert
Berlin, Ostasiatische Kunstsammlung
denn die chinesische Lackkunst ist noch immer
ein Stiefkind der Sammler und Wissenschaftler.
Nur gleichsam nebenher hat die Wissenschaft
auch einiges Licht über die Anfänge der Lack-
kunst in China verbreitet.
Ausgrabungen, die mehr Bronzen als Lacken
galten, haben in einem Grabe der Provinz
Honan rot und schwarz gelackte Balken
zutage gefördert, die nicht unerheblich in vor-
christliche Zeit zurückgehen. Um Christi Ge-
burt ist dann die Fabrikation des gemalten
Lackes in China bereits auf einer erstaunlichen
Höhe. Lackgeräte aller Art, meist noch in Rot
und Schwarz mit den lebendigsten figuralen
und ornamentalen Zeichnungen bedeckt, sind
damals in der südwestlichen Provinz Ssuchuan
hergestellt und in großer Zahl an den äußer-
sten Grenzen des Reiches im heutigen Korea und
der Mongolei gefunden worden. Auch die Ost-
asiatische Kunstsammlung zu Berlin zeigt in
einem seit kurzem dem chinesischen Lack ge-
widmeten Raum zwei Arbeiten der Zeit um
Christi Geburt, die allerdings nur noch ein vor-
wiegend archäologisches Interesse bean-
spruchen können, da die Zeit die Lackmalerei
zum großen Teil zerstört hat.
Von der chinesischen Lackkunst der T’ang-
Zeit (618—906), die vor allem den Perlmutter-
lack zu höchster Vollendung gebracht hat, be-
wahren die Sammlungen Europas nichts. Auch
aus den folgenden Dynastien der Sung (960 bis
1279) und Yüan (1279—1368) werden nur
schwer gesicherte Lackarbeiten zu finden sein.
Ein einfaches, sechsfach gelapptes Schälchen
der Berliner Sammlung, das über einem dünnen
Holzkern rot gelackt ist, entspricht allerdings
in der Form so völlig bestimmten Keramiken
der Sung-Zeit, daß wir es wohl für diese Zeit in
Anspruch nehmen dürfen. Fraglicher ist, ob
wir der Signatur eines Lackmeisters der Yüan-
Zeit auf einer kleinen geschnittenen Rotlack-
dose trauen dürfen.
Erst die darauf folgende Ming-Dynastie
(1368—1644) ist reichhaltiger und in ihrer
ganzen Vielfalt der verschiedensten Techniken
vertreten. Da sind Perlmutterlacke, deren Ein-
lagen glitzernd in dem warmen Schwarz-
braun des Lackes aufleuchten, monumental in
den betauten Lotosranken eines großen
Kastens, den man mit gutem Grund in das
15. Jahrhundert setzen kann (s. Abb.), reicher
und graziöser bei einem Untersatz für eine
Teeschale, der den chinesischen Porzellanen des
16. Jahrhunderts aufs engste verwandt ist.
Neben diesen und ähnlichen Perlmutterlacken
stehen gemalte und gravierte Lacke in satten
Farben, die die ganze Frische einer unge-
brochenen Volkskunst atmen, unter ihnen vor
allem wissenschaftlich von Interesse einige mit
den Nien-hao’s verschiedener Ming-Kaiser und
einer mit dem Datum 1618. Besonders reich
aber ist dank der unerschöpflichen Reserven
des Museums für Völkerkunde der Rotlack ver-
Runder Rotlack -Kasten, geschnitten
China, Yung-la (1403—24)
Berlin, Ostasiatische Kunstsammlung
treten. Seine Geschichte darzustellen, die eine
Entwicklung von mehreren Jahrhunderten um-
faßt, ist bisher auch nicht einmal andeutungs-
weise versucht worden. Sie kann in dieser Aus-
stellung wenigstens teilweise abgelesen wer-
den, von der dekorativen Kraft früher Ming-
Stücke (s. Abb.) bis zu dem technischen Vir-
tuosentum und künstlerischen Verfall des
18. Jahrhunderts.
Auktionsnachberichte
Howe- Versteigerung
Die Voraussagen für die Howe-Versteigerung
bei C h r i s t i e’s am 7. Dezember waren ange-
sichts der Lustlosigkeit für Gemälde geteilt:
immerhin wurde die Schätzung, die auf etwa
12 000 £ lautete, durch ein Gesamtergebnis von
19 752 £ für den Howe-Besitz und von 24 000 £
für die gesamte Gemäldeauktion übertroffen.
Das schönste der beiden Rembrandtschen
Greisenköpfe (Nr. 58, 24 : 20 cm) sicherte sich
Sabin für 2000 Guineen (Abb. S. 4), das andere
(Nr. 59, 18 : 16 cm) ging für 900 gns. an
Messrs. Colnaghi. Diese bekannte Firma war
an diesem Tage Favorit: sie übernahm für
2100 gns. die herrliche Landschaft Von
A. Cuyp (Nr. 11, 45,7 : 72 cm), für 860 gns.
das Männerbildnis von Frans Hals (Nr. 19,
61 : 50 cm) und für 580 gns. Salomon van Ruis-
daels „Ansicht von Egmond“ von 1640 (Nr. 69),
nachdem Ellis & Smith 620 gns. für eine Fluß-
Kunst in Spanien
Jose Guitierrez Solana
Weit draußen vor Madrid, wo die Maultiere
den Schlamm der ungepflasterten Straße treten
und die Kinder der Armen wie wimmelnde
Fliegen von früh bis spät die Luft mit Ge-
schrei und Lärm erfüllen, wohnt Jose Guitierrez
Solana, der Eigenartigste unter den lebenden
Malern Spaniens.
Ich habe viele Malen-
dem Realismus (mit einer grandiosen Aus-
nahme — Goya). Denn auch die moderne
Malerei Spaniens ist trotz aller französischen
Einflüsse, trotz Picasso und trotz surrealisti-
scher Experimente im Grunde ihres Wesens
realistisch geblieben. Picasso ist Europäer,
aber schon Juan Gris ist Spanier; die Klarheit
und Reinheit seines Bildgefüges ist so zwei-
dimensional realistisch, so glaubhaft existent
innerhalb der eigenen Bildwelt wie der Realis-
mus etwa der dreidimensionalen Meninas
Velasquez’.
Auch Solana besitzt diesen Realismus.
Das Fleisch der Frauen, die er malt, ist fest
ateliers gesehen, nie sah
ich eines, dessen Atmo-
sphäre so einsam, so
ganz eine Welt für sich,
voller Skurrilitäten und
Merkwürdigkeiten ist
wie das Atelier Solanas.
In diesem wirren Durch-
einander von hölzernen
gotischen Madonnen,
flatternden Barock-
engeln, wächsernen
Köpfen mit toten Glas-
augen und gesträubten
Perücken, merkwürdi-
gem Spielzeug aus ver-
gangenen Jahrhunder-
ten und alten Bauern-
malereien, in diesem
seltsamen Wirrwarr,
das die Wände mit
Alpträumen erfüllt, ist
die Welt der Bilder So-
lanas, die Welt dumpfer
Visionen und eines glut-
Jose Guitierrez Solana, Federzeichnung
vollen spanischen Katholizismus.
Solanas Kunst läßt sich nicht klar und
eindeutig umreißen. Sie entzieht sich sowohl
den Normen eines klar ausgeprägten Stils wie
jenem Generalnenner, der der Wesenskem der
ganzen spanischen Malerei seit Velasquez ist:
und stark, und die Männer mit den durch-
furchten Gesichtem auf den Bildern der Pro-
zessionen und der Christuslegende haben etwas
von den Bauern Courbets. Und doch ist Solanas
Realismus „äußerlich“. Seine Menschen sind
nicht existent im Sinne eines In-Sich-Ruhens,
nicht Abbild eines wesenhaften Seins, sondern
in ihnen glüht etwas Fremdes, gärt ein ver-
haltener Wille, der aus den merkwürdig lauern-
den Augen springt und der Atmosphäre dieser
Bilder eine unheimlich lastende, gewitter-
schwüle Stille verleiht.
Dieser Wille bricht durch in den Masken-
bildern. In der tanzenden, lallenden, irren
Freude dieser Szenen ist die Unmittelbarkeit
der Visionen eines Bosch und eines Breughel.
Wahn-Sinn der Gesichte, der zur künstlerischen
Form wird, packend in der wilden Großartig-
keit des vemunftdurchbrechenden Instinkts, der
hinter Masken Tänze feiert. In diesen Bildern
tritt das Wesen Solanas klar zutage. Er ge-
hört zu jenen Künstlern, die nicht aus dem
Gleichmaß eines eindeutigen, fest verankerten
Daseins schaffen, sondern die die seelische
„Reibung“ kennen, den Strudel der dämoni-
schen Gefühle und Gesichte, die zurückgedrängt
sind in die Form eines unterhöhlten Realismus,
und die dann plötzlich in diesen Maskenbildern
die Vernunft sprengen und den Wahnsinn
tanzen lassen. Solanas Maskenvisionen stehen
gleichbedeutend neben denen eines James Ensor.
Ja, sie erscheinen wilder und sinnlicher als die
Ensors, großartiger in dem Ausbruch der
dumpfen Gewalten, der stampfenden bäuer-
lichen Schwere der fratzenhaften Gestalten,
die einen irren gröhlenden Reigen führen.
Nur aus diesem Zwiespalt eines dämonge-
quälten Daseins ist die sonst nicht erklärbare
Unterschiedlichkeit der Bildgehalte Solanas zu
verstehen. In ruhigen Stunden, da die Dämonie
der Gesichte schlummert, mögen die Bilder der
Arbeiterfrauen, der kraftvollen Wäscherinnen
und der freudlosen Freudenmädchen entstan-
den sein. Schöne und starke Bilder, von der
festen Struktur einer Farbe, in der das Dunkel
vorherrscht. Zwischen diesen Arbeiten und den
Maskenvisionen stehen religiöse Bilder wie der
„Judaskuß“, oder, als eines der schönsten, der
„Heilung spendende Kruzifixus“. In ihnen ist
die Kraft eines religiösen Erlebens, eines ganz
und gar spanischen Katholizismus, dessen
mystische Tiefe aus dem leidgepreßten Ant-
litz Christi dringt, aber auch aus der starren
Gläubigkeit der hintergründigen Bauern-
gesichter.
Mit diesen Bildern gehört Jose Guitierrez
Solana, der heute 47jährige, zu den bedeutend-
Jose Guitierrez Solana, Wäscherinnen
sten Malern des jungen Spaniens. Unter dem
Zwang eines eigenwilligen und bedeutenden
Künstlertums geht er seinen Weg abseits von
den übrigen. In Madrid ist er viel umkämpft
worden, und die hiesige Kunstkritik hat ihn
stets als einen Außenseiter behandelt. In Wahr-
heit ist er, mit seinem mystisch durchleuchteten
Realismus, seinen dämonischen Gesichten und
seinem glutvollen Katholizismus der spanischste
unter den lebenden Malern Spaniens. W. G.
DIE WELT KUNST
Jahrg.VII, Nr. 51 vom 17. Dezember 1933
Syrakus entsprechend dem veränderten Objekt
eine reichere, tonigere Palette als in den dalma-
tinischen Ansichten vom Vorjahr. Den Ab-
schluß bildet eine Kollektion der Karikaturen
von Th. Th. Heine, die das konsequente Fest-
halten des Münchener Künstlers an dem ein-
mal gefundenen linearen Stil und die ungewöhn-
liche Prägnanz desselben veranschaulichen.
Angesichts der Unergiebigkeit der meisten
Ausstellungen moderner Wiener Kunst verdient
diese Schau besonders vermerkt zu werden, ver-
fügt doch auch die Winterausstellung der Se-
zession, abgesehen von den von innen heraus
gesehenen, koloristisch durchgefühlten Bildern
des sensiblen Melancholikers Dubrowsky, über
nichts von Bedeutung.
St. Poglayen-Neuwall
Gedächtnisausstellung
Karl Lotz
Karl Lotz, Selbstbildnis
Ausstellung: Budapest, Kunst halle
Gelegentlich des 100. Geburtstages von Karl
Lotz, der am 16. Dezember gefeiert wird, ver-
anstaltet die Gesellschaft für bildende Kunst in
Budapest in sämtlichen Räumen der Kunst-
halle eine repräsentative Ausstellung seiner
Jnhalf Nr. 51
Deutsche Künstler in Paris
Paul Strecker (m. Abb.). 1
Josef Floch (m. Abb.).1,2
Gedächtnisausstellung Karl Lotz (m. Abb.) 2
Kunst in Spanien (m. 2 Abb.). 2
Chinesische Lacke (m. 2 Abb.) .... 2
A u k t i o n s v o r b e r i c h t e . 2
Auktionsnachberichte (m. Abb.) . . 2, 3
Literatur — Preisberichte . . . . 3
Auktionskalender. 3
Nachrichten von Überall. 4
Abbildungen:
P. S tr e cke r, Zigeuner.1
J. Floch, Bildnis.1
K, Lotz, Selbstbildnis.2
Kasten, China. 2
Runder Rotlack-Kasten, China.2
J. G. Solana, Federzeichnung .2
J. G S o 1 an a, Wäscherinnen.2
F. B u r m a n n, Nidden .3
Rembrandt, Greisenbildnis.4
Werke. Gleichzeitig zeigt die Graphische Ab-
teilung des Museums der bildenden Kunst eine
Auswahl von Handzeichnungen und Farben-
skizzen.
Lotz, Sohn eines Deutschen und einer Un-
garin, wurde in Hessen-Homburg geboren, kam
jedoch nach dem Tode des Vaters schon in
frühester Jugend nach Ungarn und wählte
dieses Land zu seiner zweiten Heimat. Mit
Ausnahme einiger Studienjahre an der Wiener
Akademie verbrachte er sein ganzes Leben in
Ungarn. Er hat ungarische Schulen besucht
und den ersten Malunterricht bei Jacob Mara-
stoni, dem ersten Direktor der Kunstschule in
Budapest, empfangen. Die Wiener Studienzeit
verbrachte er bei Karl Rahl — ähnlich wie
viele Ungarn dieser Zeit — unter dessen Ein-
fluß er sich der Historienmalerei zuwandte.
Doch als er von Wien wieder nach Ungarn zu-
rückkehrte, geriet er völlig in den Bann der
ungarischen Landschaft und des Volkes, unter-
nahm Reisen, durchstreifte das Land, besonders
die Tiefebene, deren eigenartigen Reizen er
manche Anregung verdankt. In dieser Zeit
entstanden seine ländlichen Genre-Szenen und
Landschaften, pathetisch bewegt, in der Art
einer verklärten Puszta-Romantik, die aber —
trotz des Haftens an dem besonderen Sujet —
stets auch das lebendige, unmittelbare Sehen
verraten.
Als nach dem Ausgleich von 1867 die bau-
liche Entwicklung der Hauptstadt einen schnel-
len Aufschwung nahm und zahlreiche öffent-
liche Gebäude errichtet wurden, deren histori-
sierende Formen einer malerischen Aus-
schmückung bedurften, zog man zu den neuen
künstlerischen Aufgaben vielfach auch Lotz
heran. Neben Maurus Than wurde er der am
meisten beschäftigte Freskenmaler Ungarns.
Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören die
Fresken der Redoute, des National-Museums,
der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten, der Universitätsbibliothek, das Decken-
gemälde der Oper und eine Reihe von Kirchen
(Krönungskirche, Franziskanerkirche, Kathe-
drale von Pecs, Abtei von Tihany). Seine
Themen gehören zum Teil der Mythologie, zum
Teil der ungarischen Historie an. Stilistisch
vertritt sein gesamtes Werk einen kultivierten
Eklektizismus, der enormes technisches Können
mit viel dekorativem Sinn verbindet. Der
Schule Rahls, dessen bester Repräsentant in
Ungarn er war, verdankt er zweifellos sehr
viel. Diese gute Schule, wie auch seine eigenen
malerischen Fähigkeiten bewahrten ihn vor
jenem kalten Formalismus, der so manchem
anderen Historienmaler zum Schicksal wurde.
Auktionsvorschau
Köln, 19.—20. Dez.
Math. Lempertz versteigert in den
Tagen vor Weihnachten aus dem Nachlaß eines
westfälischen Großindustriellen Mobiliar,
Kunstgewerbe, Orientteppiche und eine Samm-
lung neuzeitlicher Gemälde und Graphik.
Mailand, 18. Dez.
Der Atelier-Nachlaß des berühmten italieni-
schen Malers Giovanni B o 1 d i n i, Zeichnungen,
und Gemälde, die viele Ausstellungen (zu-
letzt in der Galerie Charpentier in Paris)
zierten, wird am 18. Dezember durch L. A.
Scopinich in Mailand versteigert.
Paris, 20. Dez.
Autographen und historische Dokumente
werden durch Me B a u d o i n und die Experten
MM. A r n n a und J a n v i e r am 20. Dezember
im Hotel Drouot ausgeboten. Aus dem
sehr bedeutenden Material ragen vor allem
mehrere wichtige Autographen Napoleons I.,
Lafontaines, Chopins u. a. hervor.
Chinesische Lacke
in der Ostasiatischen Kunstsammlung der Berliner Museen
Von Dr. L. Reidemeister
Je mehr sich sammlerische Liebhaberei und
kunstwissenschaftliche Forschung dem Chi-
noiserielack des 17. und 18. Jahrhunderts in
Europa zuwenden, desto unerläßlicher ist die
Kenntnis der chinesischen Vorbilder. Leicht ist
diese Kenntnis allerdings nicht zu erlangen,
Kasten, Schwarzlack mit Perlmutt-Einlage
China, 15. Jahrhundert
Berlin, Ostasiatische Kunstsammlung
denn die chinesische Lackkunst ist noch immer
ein Stiefkind der Sammler und Wissenschaftler.
Nur gleichsam nebenher hat die Wissenschaft
auch einiges Licht über die Anfänge der Lack-
kunst in China verbreitet.
Ausgrabungen, die mehr Bronzen als Lacken
galten, haben in einem Grabe der Provinz
Honan rot und schwarz gelackte Balken
zutage gefördert, die nicht unerheblich in vor-
christliche Zeit zurückgehen. Um Christi Ge-
burt ist dann die Fabrikation des gemalten
Lackes in China bereits auf einer erstaunlichen
Höhe. Lackgeräte aller Art, meist noch in Rot
und Schwarz mit den lebendigsten figuralen
und ornamentalen Zeichnungen bedeckt, sind
damals in der südwestlichen Provinz Ssuchuan
hergestellt und in großer Zahl an den äußer-
sten Grenzen des Reiches im heutigen Korea und
der Mongolei gefunden worden. Auch die Ost-
asiatische Kunstsammlung zu Berlin zeigt in
einem seit kurzem dem chinesischen Lack ge-
widmeten Raum zwei Arbeiten der Zeit um
Christi Geburt, die allerdings nur noch ein vor-
wiegend archäologisches Interesse bean-
spruchen können, da die Zeit die Lackmalerei
zum großen Teil zerstört hat.
Von der chinesischen Lackkunst der T’ang-
Zeit (618—906), die vor allem den Perlmutter-
lack zu höchster Vollendung gebracht hat, be-
wahren die Sammlungen Europas nichts. Auch
aus den folgenden Dynastien der Sung (960 bis
1279) und Yüan (1279—1368) werden nur
schwer gesicherte Lackarbeiten zu finden sein.
Ein einfaches, sechsfach gelapptes Schälchen
der Berliner Sammlung, das über einem dünnen
Holzkern rot gelackt ist, entspricht allerdings
in der Form so völlig bestimmten Keramiken
der Sung-Zeit, daß wir es wohl für diese Zeit in
Anspruch nehmen dürfen. Fraglicher ist, ob
wir der Signatur eines Lackmeisters der Yüan-
Zeit auf einer kleinen geschnittenen Rotlack-
dose trauen dürfen.
Erst die darauf folgende Ming-Dynastie
(1368—1644) ist reichhaltiger und in ihrer
ganzen Vielfalt der verschiedensten Techniken
vertreten. Da sind Perlmutterlacke, deren Ein-
lagen glitzernd in dem warmen Schwarz-
braun des Lackes aufleuchten, monumental in
den betauten Lotosranken eines großen
Kastens, den man mit gutem Grund in das
15. Jahrhundert setzen kann (s. Abb.), reicher
und graziöser bei einem Untersatz für eine
Teeschale, der den chinesischen Porzellanen des
16. Jahrhunderts aufs engste verwandt ist.
Neben diesen und ähnlichen Perlmutterlacken
stehen gemalte und gravierte Lacke in satten
Farben, die die ganze Frische einer unge-
brochenen Volkskunst atmen, unter ihnen vor
allem wissenschaftlich von Interesse einige mit
den Nien-hao’s verschiedener Ming-Kaiser und
einer mit dem Datum 1618. Besonders reich
aber ist dank der unerschöpflichen Reserven
des Museums für Völkerkunde der Rotlack ver-
Runder Rotlack -Kasten, geschnitten
China, Yung-la (1403—24)
Berlin, Ostasiatische Kunstsammlung
treten. Seine Geschichte darzustellen, die eine
Entwicklung von mehreren Jahrhunderten um-
faßt, ist bisher auch nicht einmal andeutungs-
weise versucht worden. Sie kann in dieser Aus-
stellung wenigstens teilweise abgelesen wer-
den, von der dekorativen Kraft früher Ming-
Stücke (s. Abb.) bis zu dem technischen Vir-
tuosentum und künstlerischen Verfall des
18. Jahrhunderts.
Auktionsnachberichte
Howe- Versteigerung
Die Voraussagen für die Howe-Versteigerung
bei C h r i s t i e’s am 7. Dezember waren ange-
sichts der Lustlosigkeit für Gemälde geteilt:
immerhin wurde die Schätzung, die auf etwa
12 000 £ lautete, durch ein Gesamtergebnis von
19 752 £ für den Howe-Besitz und von 24 000 £
für die gesamte Gemäldeauktion übertroffen.
Das schönste der beiden Rembrandtschen
Greisenköpfe (Nr. 58, 24 : 20 cm) sicherte sich
Sabin für 2000 Guineen (Abb. S. 4), das andere
(Nr. 59, 18 : 16 cm) ging für 900 gns. an
Messrs. Colnaghi. Diese bekannte Firma war
an diesem Tage Favorit: sie übernahm für
2100 gns. die herrliche Landschaft Von
A. Cuyp (Nr. 11, 45,7 : 72 cm), für 860 gns.
das Männerbildnis von Frans Hals (Nr. 19,
61 : 50 cm) und für 580 gns. Salomon van Ruis-
daels „Ansicht von Egmond“ von 1640 (Nr. 69),
nachdem Ellis & Smith 620 gns. für eine Fluß-
Kunst in Spanien
Jose Guitierrez Solana
Weit draußen vor Madrid, wo die Maultiere
den Schlamm der ungepflasterten Straße treten
und die Kinder der Armen wie wimmelnde
Fliegen von früh bis spät die Luft mit Ge-
schrei und Lärm erfüllen, wohnt Jose Guitierrez
Solana, der Eigenartigste unter den lebenden
Malern Spaniens.
Ich habe viele Malen-
dem Realismus (mit einer grandiosen Aus-
nahme — Goya). Denn auch die moderne
Malerei Spaniens ist trotz aller französischen
Einflüsse, trotz Picasso und trotz surrealisti-
scher Experimente im Grunde ihres Wesens
realistisch geblieben. Picasso ist Europäer,
aber schon Juan Gris ist Spanier; die Klarheit
und Reinheit seines Bildgefüges ist so zwei-
dimensional realistisch, so glaubhaft existent
innerhalb der eigenen Bildwelt wie der Realis-
mus etwa der dreidimensionalen Meninas
Velasquez’.
Auch Solana besitzt diesen Realismus.
Das Fleisch der Frauen, die er malt, ist fest
ateliers gesehen, nie sah
ich eines, dessen Atmo-
sphäre so einsam, so
ganz eine Welt für sich,
voller Skurrilitäten und
Merkwürdigkeiten ist
wie das Atelier Solanas.
In diesem wirren Durch-
einander von hölzernen
gotischen Madonnen,
flatternden Barock-
engeln, wächsernen
Köpfen mit toten Glas-
augen und gesträubten
Perücken, merkwürdi-
gem Spielzeug aus ver-
gangenen Jahrhunder-
ten und alten Bauern-
malereien, in diesem
seltsamen Wirrwarr,
das die Wände mit
Alpträumen erfüllt, ist
die Welt der Bilder So-
lanas, die Welt dumpfer
Visionen und eines glut-
Jose Guitierrez Solana, Federzeichnung
vollen spanischen Katholizismus.
Solanas Kunst läßt sich nicht klar und
eindeutig umreißen. Sie entzieht sich sowohl
den Normen eines klar ausgeprägten Stils wie
jenem Generalnenner, der der Wesenskem der
ganzen spanischen Malerei seit Velasquez ist:
und stark, und die Männer mit den durch-
furchten Gesichtem auf den Bildern der Pro-
zessionen und der Christuslegende haben etwas
von den Bauern Courbets. Und doch ist Solanas
Realismus „äußerlich“. Seine Menschen sind
nicht existent im Sinne eines In-Sich-Ruhens,
nicht Abbild eines wesenhaften Seins, sondern
in ihnen glüht etwas Fremdes, gärt ein ver-
haltener Wille, der aus den merkwürdig lauern-
den Augen springt und der Atmosphäre dieser
Bilder eine unheimlich lastende, gewitter-
schwüle Stille verleiht.
Dieser Wille bricht durch in den Masken-
bildern. In der tanzenden, lallenden, irren
Freude dieser Szenen ist die Unmittelbarkeit
der Visionen eines Bosch und eines Breughel.
Wahn-Sinn der Gesichte, der zur künstlerischen
Form wird, packend in der wilden Großartig-
keit des vemunftdurchbrechenden Instinkts, der
hinter Masken Tänze feiert. In diesen Bildern
tritt das Wesen Solanas klar zutage. Er ge-
hört zu jenen Künstlern, die nicht aus dem
Gleichmaß eines eindeutigen, fest verankerten
Daseins schaffen, sondern die die seelische
„Reibung“ kennen, den Strudel der dämoni-
schen Gefühle und Gesichte, die zurückgedrängt
sind in die Form eines unterhöhlten Realismus,
und die dann plötzlich in diesen Maskenbildern
die Vernunft sprengen und den Wahnsinn
tanzen lassen. Solanas Maskenvisionen stehen
gleichbedeutend neben denen eines James Ensor.
Ja, sie erscheinen wilder und sinnlicher als die
Ensors, großartiger in dem Ausbruch der
dumpfen Gewalten, der stampfenden bäuer-
lichen Schwere der fratzenhaften Gestalten,
die einen irren gröhlenden Reigen führen.
Nur aus diesem Zwiespalt eines dämonge-
quälten Daseins ist die sonst nicht erklärbare
Unterschiedlichkeit der Bildgehalte Solanas zu
verstehen. In ruhigen Stunden, da die Dämonie
der Gesichte schlummert, mögen die Bilder der
Arbeiterfrauen, der kraftvollen Wäscherinnen
und der freudlosen Freudenmädchen entstan-
den sein. Schöne und starke Bilder, von der
festen Struktur einer Farbe, in der das Dunkel
vorherrscht. Zwischen diesen Arbeiten und den
Maskenvisionen stehen religiöse Bilder wie der
„Judaskuß“, oder, als eines der schönsten, der
„Heilung spendende Kruzifixus“. In ihnen ist
die Kraft eines religiösen Erlebens, eines ganz
und gar spanischen Katholizismus, dessen
mystische Tiefe aus dem leidgepreßten Ant-
litz Christi dringt, aber auch aus der starren
Gläubigkeit der hintergründigen Bauern-
gesichter.
Mit diesen Bildern gehört Jose Guitierrez
Solana, der heute 47jährige, zu den bedeutend-
Jose Guitierrez Solana, Wäscherinnen
sten Malern des jungen Spaniens. Unter dem
Zwang eines eigenwilligen und bedeutenden
Künstlertums geht er seinen Weg abseits von
den übrigen. In Madrid ist er viel umkämpft
worden, und die hiesige Kunstkritik hat ihn
stets als einen Außenseiter behandelt. In Wahr-
heit ist er, mit seinem mystisch durchleuchteten
Realismus, seinen dämonischen Gesichten und
seinem glutvollen Katholizismus der spanischste
unter den lebenden Malern Spaniens. W. G.