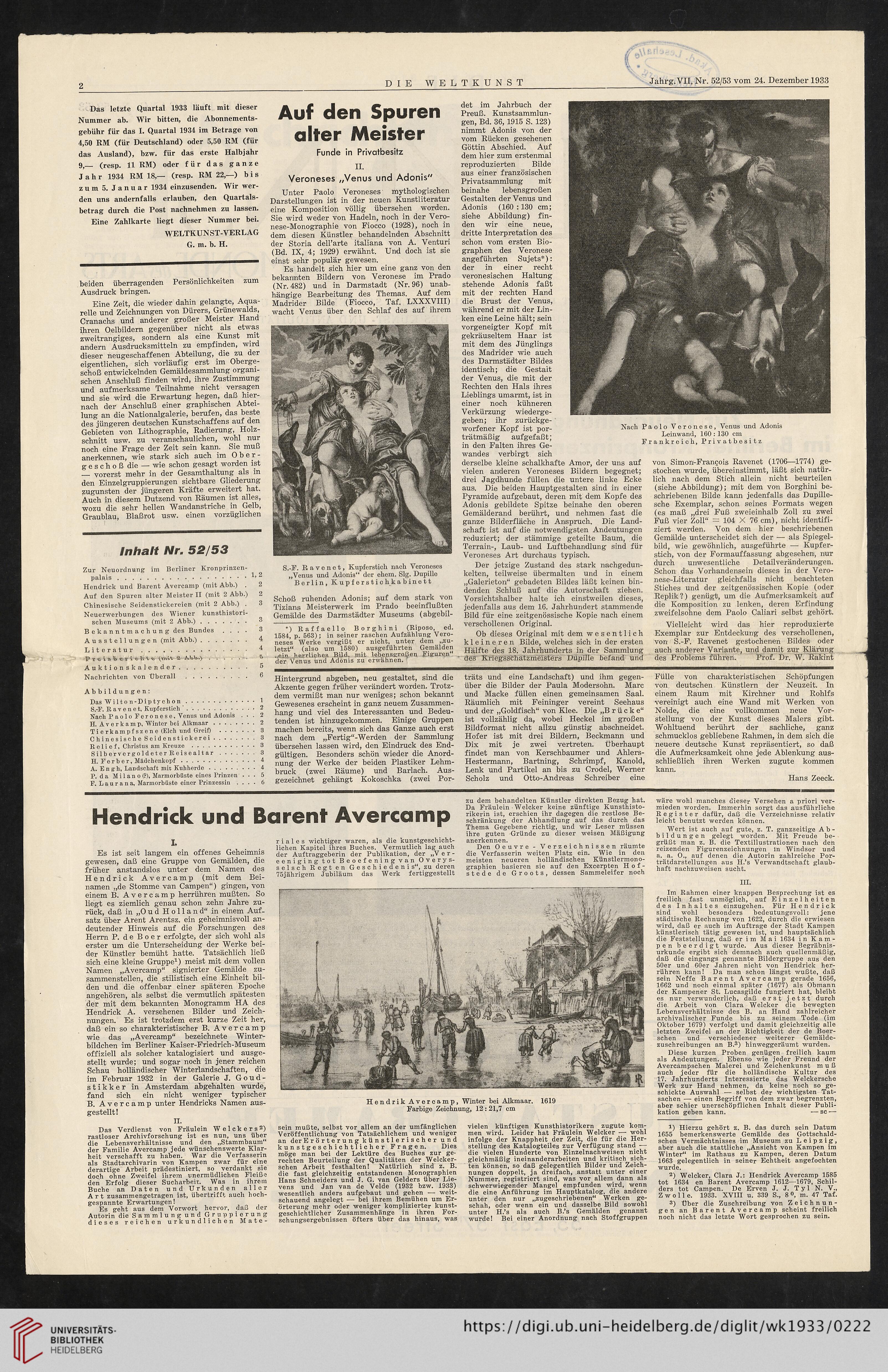2
DIE WELT KUNST
Jahrg.VII, Nr. 52/53 vom 24. Dezember 1933
Das letzte Quartal 1933 läuft mit dieser
Nummer ab. Wir bitten, die Abonnements-
gebühr für das I. Quartal 1934 im Betrage von
4,50 RM (für Deutschland) oder 5,50 RM (für
das Ausland), bzw. für das erste Halbjahr
9,— (resp. 11 RM) oder für das ganze
Jahr 1934 RM 18,— (resp. RM 22,—) b i s
zum 5. Januar 1934 einzusenden. Wir wer-
den uns andernfalls erlauben, den Quartals-
betrag durch die Post nachnehmen zu lassen.
Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.
WELTKUNST-VERLAG
G. m. b. H.
beiden überragenden Persönlichkeiten zum
Ausdruck bringen.
Eine Zeit, die wieder dahin gelangte, Aqua-
relle und Zeichnungen von Dürers, Grünewalds,
Cranachs und anderer großer Meister Hand
ihren Oelbildern gegenüber nicht als etwas
zweitrangiges, sondern als eine Kunst mit
andern Ausdrucksmitteln zu empfinden, wird
dieser neugeschaffenen Abteilung, die zu der
eigentlichen, sich vorläufig erst im Oberge-
schoß entwickelnden Gemäldesammlung organi-
schen Anschluß finden wird, ihre Zustimmung
und aufmerksame Teilnahme nicht versagen
und sie wird die Erwartung hegen, daß hier-
nach der Anschluß einer graphischen Abtei-
lung an die Nationalgalerie, berufen, das beste
des jüngeren deutschen Kunstschaffens auf den
Gebieten von Lithographie, Radierung, Holz-
schnitt usw. zu veranschaulichen, wohl nur
noch eine Frage der Zeit sein kann. Sie muß
anerkennen, wie stark sich auch im Ober-
geschoß die — wie schon gesagt worden ist
— vorerst mehr in der Gesamthaltung als in
den Einzelgruppierungen sichtbare Gliederung
zugunsten der jüngeren Kräfte erweitert hat.
Auch in diesem Dutzend von Räumen ist alles,
wozu die sehr hellen Wandanstriche in Gelb,
Graublau, Blaßrot usw. einen vorzüglichen
Inhalt Nr. 52/53
Zur Neuordnung im Berliner Kronprinzen-
palais .2
Hendrick und Barent Avercamp (mit Abb.) . 2
Auf den Spuren alter Meister II (mit 2 Abb.) 2
Chinesische Seidenstickereien (mit 2 Abb.) . 3
Neuerwerbungen des Wiener kunsthistori-
schen Museums (mit 2 Abb.). 3
Bekanntmachung des Bundes .... 3
Ausstellungen (mit Abb.). 4
Literatur . 4
P t c i s b 2. AAib.).-. &
Auktionskalender. 5
Nachrichten von Überall . 6
Abbildungen:
Das Wilton-Diptychon.1
S.-F. Ravenet, Kupferstich . . ..2
Nach Paolo Feronese, Venus und Adonis ... 2
H. Av e r k amp, Winter bei Alkmaar.2
Tierkampfszene (Elch und Greif) .3
Chinesische Seidenstickerei.3
Relief, Christus am Kreuze .3
S il b er ver g o 1 d et er R eis e alt ar .3
H. Ferb er, Mädchenkopf.. . • 4
A. Engh, Landschaft mir Kuhherde.4
P. da Mi 1 an o (?), Marmorbüste eines Prinzen ... 5
F. L a u r a n a, Marmorbüste einer Prinzessin .... 6
Auf den Spuren
alter Meister
Funde in Privatbesitz
II.
Veroneses „Venus und Adonis"
Unter Paolo Veroneses mythologischen
Darstellungen ist in der neuen Kunstliteratur
eine Komposition völlig übersehen worden.
Sie wird weder von Hadeln, noch in der Vero-
nese-Monographie von Fiocco (1928), noch in
dem diesen Künstler behandelnden Abschnitt
der Storia dell’arte italiana von A. Venturi
(Bd. IX, 4; 1929) erwähnt. Und doch ist sie
einst sehr populär gewesen.
Es handelt sich hier um eine ganz von den
bekannten Bildern von Veronese im Prado
(Nr. 482) und in Darmstadt (Nr. 96) unab-
hängige Bearbeitung des Themas. Auf dem
Madrider Bilde (Fiocco, Taf. LXXXVIH)
wacht Venus über den Schlaf des auf ihrem
S.-F. R a v e n e t, Kupferstich nach Veroneses
„Venus und Adonis“ der ehern. Slg. Dupille
Berlin, Kupferstichkabinett
Schoß ruhenden Adonis; auf dem stark von
Tizians Meisterwerk im Prado beeinflußten
Gemälde des Darmstädter Museums (abgebil-
*) Raffaello Borghini (Riposo, ed.
1584, p. 563); in seiner raschen Aufzählung Vero-
neses Werke vergißt er nicht, unter dem „zu-
letzt“ (also um 1580) ausgeführten Gemälden
..ein herrliches Bild, mit lebensgroßen Figuren“
der Venus und Adonis zu erwähnen.
det im Jahrbuch der
Preuß. Kunstsammlun-
gen, Bd. 36, 1915 S. 123)
nimmt Adonis von der
vom Rücken gesehenen
Göttin Abschied. Auf
dem hier zum erstenmal
reproduzierten Bilde
aus einer französischen
Privatsammlung mit
beinahe lebensgroßen
Gestalten der Venus und
Adonis (160 :130 cm;
siehe Abbildung) fin-
den wir eine neue,
dritte Interpretation des
schon vom ersten Bio-
graphen des Veronese
angeführten Sujets*):
der in einer recht
veronesischen Haltung
stehende Adonis faßt
mit der rechten Hand
die Brust der Venus,
während er mit der Lin-
ken eine Leine hält; sein
vorgeneigter Kopf mit
gekräuseltem Haar ist
mit dem des Jünglings
des Madrider wie auch
des Darmstädter Bildes
identisch; die Gestalt
der Venus, die mit der
Rechten den Hals ihres
Lieblings umarmt, ist in
einer noch kühneren
Verkürzung wiederge-
geben; ihr zurückge-
worfener Kopf ist por-
trätmäßig auf gefaßt;
in den Falten ihres Ge-
Nach Paolo Veronese, Venus und Adonis
Leinwand, 160 : 130 cm
Frankreich, Privatbesitz
wandes verbirgt sich
derselbe kleine schalkhafte Amor, der uns auf
vielen anderen Veroneses Bildern begegnet;
drei Jagdhunde füllen die untere linke Ecke
aus. Die beiden Hauptgestalten sind in einer
Pyramide aufgebaut, deren mit dem Kopfe des
Adonis gebildete Spitze beinahe den oberen
Gemälderand berührt, und nehmen fast die
ganze Bilderfläche in Anspruch. Die Land-
schaft ist auf die notwendigsten Andeutungen
reduziert; der stämmige geteilte Baum, die
Terrain-, Laub- und Luftbehandlung sind für
Veroneses Art durchaus typisch.
Der jetzige Zustand des stark nachgedun-
kelten, teilweise übermalten und in einem
„Galerieton“ gebadeten Bildes läßt keinen bin-
denden Schluß auf die Autorschaft ziehen.
Vorsichtshalber halte ich einstweilen dieses,
jedenfalls aus dem 16. Jahrhundert stammende
Bild für eine zeitgenössische Kopie nach einem
verschollenen Original.
Ob dieses Original mit dem wesentlich
kleineren Bilde, welches sich in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Sammlung
des Kriegsschatzmeisters Düpille befand und
von Simon-Francois Ravenet (1706—1774) ge-
stochen wurde, übereinstimmt, läßt sich natür-
lich nach dem Stich allein nicht beurteilen
(siehe Abbildung); mit dem von Borghini be-
schriebenen Bilde kann jedenfalls das Dupille-
sche Exemplar, schon seines Formats wegen
(es maß „drei Fuß zweieinhalb Zoll zu zwei
Fuß vier Zoll“ = 104 X 76 cm), nicht identifi-
ziert werden. Von dem hier beschriebenen
Gemälde unterscheidet sich der — als Spiegel-
bild, wie gewöhnlich, ausgeführte — Kupfer-
stich, von der Formauffassung abgesehen, nur
durch unwesentliche Detailveränderungen.
Schon das Vorhandensein dieses in der Vero-
nese-Literatur gleichfalls nicht beachteten
Stiches und der zeitgenössischen Kopie (oder
Replik ?) genügt, um die Aufmerksamkeit auf
die Komposition zu lenken, deren Erfindung
zweifelsohne dem Paolo Caliari selbst gehört.
Vielleicht wird das hier reproduzierte
Exemplar zur Entdeckung des verschollenen,
von S.-F. Ravenet gestochenen Bildes oder
auch anderer Variante, und damit zur Klärung
des Problems führen. Prof. Dr. W. Rakint
Hintergrund abgeben, neu gestaltet, sind die
Akzente gegen früher verändert worden. Trotz-
dem vermißt man nur weniges; schon bekannt
Gewesenes erscheint in ganz neuem Zusammen-
hang und viel des Interessanten und Bedeu-
tenden ist hinzugekommen. Einige Gruppen
machen bereits, wenn sich das Ganze auch erst
nach dem „Fertig“-Werden der Sammlung
übersehen lassen wird, den Eindruck des End-
gültigen. Besonders schön wieder die Anord-
nung der Werke der beiden Plastiker Lehm-
bruck (zwei Räume) und Barlach. Aus-
gezeichnet gehängt Kokoschka (zwei Por-
träts und eine Landschaft) und ihm gegen-
über die Bilder der Paula Modersohn. Marc
und Macke füllen einen gemeinsamen Saal.
Räumlich mit Feininger vereint Seehaus
und der „Goldfisch“ von Klee. Die „Brück e“
ist vollzählig da, wobei Heckel im großen
Bildformat nicht allzu günstig abschneidet.
Hofer ist mit drei Bildern, Beckmann und
Dix mit je zwei vertreten. Überhaupt
findet man von Kerschbaumer und Ahlers-
Hestermann, Bartning, Schrimpf, Kanold,
Lenk und Partikel an bis zu Crodel, Werner
Scholz und Otto-Andreas Schreiber eine
Fülle von charakteristischen Schöpfungen
von deutschen Künstlern der Neuzeit. In
einem Raum mit Kirchner und Rohlfs
vereinigt auch eine Wand mit Werken von
Nolde, die eine vollkommen neue Vor-
stellung von der Kunst dieses Malers gibt.
Wohltuend berührt der sachliche, ganz
schmucklos gebliebene Rahmen, in dem sich die
neuere deutsche Kunst repräsentiert, so daß
die Aufmerksamkeit ohne jede Ablenkung aus-
schließlich ihren Werken zugute kommen
kann.
Hans Zeeck.
Hendrick und Barent Avercamp
I.
Es ist seit langem ein offenes Geheimnis
gewesen, daß eine Gruppe von Gemälden, die
früher anstandslos unter dem Namen des
Hendrick Avercamp (mit dem Bei-
r i a 1 e s 'wichtiger waren, als die kunstgeschicht-
lichen Kapitel ihres Buches. Vermutlich lag auch
der Auftraggeberin der Publikation, der „Ver-
een i gi n g to t Beoefeningvan Overys-
selsch Regten Geschiedeni s“, zu deren
75jährigem Jubiläum das Werk fertiggestellt
zu dem behandelten Künstler direkten Bezug hat.
Da Fräulein ■ Weicker keine zünftige Kunsthisto-
rikerin ist, erschien ihr dagegen die restlose Be-
schränkung der Abhandlung auf das durch das
Thema Gegebene richtig, und wir Leser müssen
ihre guten Gründe zu dieser weisen Mäßigung
anerkennen.
Den Oeuvre - Verzeichnissen räumte
die Verfasserin weiten Platz ein. Wie in den
meisten neueren holländischen Künstlermono-
graphien basieren sie auf den Excerpten Hof-
stede de Groots, dessen Sammeleifer noch
namen „de Stomme van Campen“) gingen, von
einem B. Avercamp herrühren mußten. So
liegt es ziemlich genau schon zehn Jahre zu-
rück, daß in „O u d Holland“ in einem Auf-
satz über Arent Arentsz. ein geheimnisvoll an-
deutender Hinweis auf die Forschungen des
Herrn P. de Boer erfolgte, der sich wohl als
erster um die Unterscheidung der Werke bei-
der Künstler bemüht hatte. Tatsächlich ließ
sich eine kleine Gruppe1) meist mit dem vollen
Namen „Avercamp“ signierter Gemälde zu-
sammenstellen, die stilistisch eine Einheit bil-
den und die offenbar einer späteren Epoche
angehören, als selbst die vermutlich spätesten
der mit dem bekannten Monogramm HA des
Hendrick A. versehenen Bilder und Zeich-
nungen. Es ist trotzdem erst kurze Zeit her,
daß ein so charakteristischer B. Avercamp
wie das „Avercamp“ bezeichnete Winter-
bildchen im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum
offiziell als solcher katalogisiert und ausge-
stellt wurde; und sogar noch in jener reichen
Schau holländischer Winterlandschaften, die
im Februar 1932 in der Galerie J. G o u d -
stikker in Amsterdam abgehalten wurde,
fand sich ein nicht weniger typischer
B. Avercamp unter Hendricks Namen aus-
gestellt!
Hendrik Avercamp, Winter bei Alkmaar. 1619
Farbige Zeichnung, 12 : 21,7 cm
II.
Das Verdienst von Fräulein Weickers2)
rastloser Archivforschung ist es nun, uns über
die Lebensverhältnisse und den „Stammbaum“
der Familie Avercamp jede wünschenswerte Klar-
heit verschafft zu haben. War die Verfasserin
als Stadtarchivarin von Kämpen zwar für eine
derartige Arbeit prädestiniert, so verdankt sie
doch ohne Zweifel ihrem unermüdlichen Fleiße
den Erfolg dieser Sucharbeit. Was in ihrem
Buche an Daten und Urkunden aller
Art zusammengetragen ist, übertrifft auch hoch-
gespannte Erwartungen!
Es geht aus dem Vorwort hervor, daß der
Autorin die Sammlung und Gruppierung
dieses reichen urkundlichen Mate-
sein mußte, selbst vor allem an der umfänglichen
Veröffentlichung von Tatsächlichem und weniger
an der Erörterung künstlerischer und
kunstgeschichtlicher Fragen. Dies
möge man bei der Lektüre des Buches zur ge-
rechten Beurteilung der Qualitäten der Welcker-
schen Arbeit festhalten! Natürlich sind z. B.
die fast gleichzeitig entstandenen Monographien
Hans Schneiders und J. G. van Gelders über Lie-
vens und Jan van de Velde (1932 bzw. 1933)
wesentlich anders aufgebaut und gehen — weit-
schauend angelegt — bei ihrem Bemühen um Er-
örterung mehr oder weniger komplizierter kunst-
geschichtlicher Zusammenhänge in ihren For-
schungsergebnissen öfters über das hinaus, was
vielen künftigen Kunsthistorikern zugute kom-
men wird. Leider hat Fräulein Weicker — wohl
infolge der Knappheit der Zeit, die für die Her-
stellung des Katalogteiles zur Verfügung stand -—
die vielen Hunderte von Einzelnachweisen nicht
gleichmäßig ineinanderarbeiten und kritisch sich-
ten können, so daß gelegentlich Bilder und Zeich-
nungen doppelt, ja dreifach, anstatt unter einer
Nummer, registriert sind, was vor allem dann als
schwerwiegender Mangel empfunden wird, wenn
die eine Anführung im Hauptkatalog, die andere
unter den nur „zugeschriebenen“ Werken ge-
schah, oder wenn ein und dasselbe Bild sowohl
unter H.’s als auch B.’s Gemälden genannt
wurde! Bei einer Anordnung nach Stoffgruppen
wäre wohl manches dieser Versehen a priori ver-
mieden worden. Immerhin sorgt das ausführliche
Register dafür, daß die Verzeichnisse relativ
leicht benutzt werden können.
Wert ist auch auf gute, z. T. ganzseitige Ab-
bildungen gelegt worden. Mit Freude be-
grüßt man z. B. die Textillustrationen nach den
reizenden Figurenzeichnungen In Windsor und
a. a. O., auf denen die Autorin zahlreiche Por-
trätdarstellungen aus H.’s Verwandtschaft glaub-
haft nachzuweisen sucht.
III.
Im Rahmen einer knappen Besprechung ist es
freilich fast unmöglich, auf Einzelheiten
des Inhaltes einzugehen. Für Hendrick
sind wohl besonders bedeutungsvoll: jene
städtische Rechnung von 1622, durch die erwiesen
wird, daß er auch im Auftrage der Stadt Kämpen
künstlerisch tätig gewesen ist, und hauptsächlich
die Feststellung, daß er i m Mai 1634 in Käm-
pen beerdigt wurde. Aus dieser Begräbnis-
urkunde ergibt sich demnach auch quellenmäßig,
daß die eingangs genannte Bildergruppe aus den
50er und 60er Jahren nicht von Hendrick her-
rühren kann! Da man schon längst wußte, daß
sein Neffe Barent Avercamp gerade 1656,
1662 und noch einmal später (1677) als Obmann
der Kampener St. Lucasgilde fungiert hat, bleibt
es nur verwunderlich, daß erst jetzt durch
die Arbeit von Clara Weicker die bewegten
Lebensverhältnisse des B. an Hand zahlreicher
archivalischer Funde bis zu seinem Tode (im
Oktober 1679) verfolgt und damit gleichzeitig alle
letzten Zweifel an der Richtigkeit der de Boer-
schen und verschiedener weiterer Gemälde-
zuschreibungen an B.3) hinweggeräumt wurden.
Diese kurzen Proben genügen freilich kaum
als Andeutungen. Ebenso wie jeder Freund der
Avercampschen Malerei und Zeichenkunst muß
auch jeder für die holländische Kultur des
17. Jahrhunderts Interessierte das Welckersche
Werk zur Hand nehmen, da keine noch so ge-
schickte Auswahl ■— selbst der wichtigsten Tat-
sachen — einen Begriff von dem zwar begrenzten,
aber schier unerschöpflichen Inhalt dieser Publi-
kation geben kann. — sc —
t) Hierzu gehört z. B. das durch sein Datum
1655 bemerkenswerte Gemälde des Gottschald-
schen Vermächtnisses im Museum zu Leipzig,
aber auch die stattliche „Ansicht von Kämpen im
Winter“ im Rathaus zu Kämpen, deren Datum
1663 gelegentlich in seiner Echtheit angefochten
wurde.
2) Weicker, Clara J.: Hendrick Avercamp 1585
tot 1634 en Barent Avercamp 1612—1679, Schil-
ders tot Campen. De Erven J. J. T y 1 N. V.,
Zwolle. 1933. XVIII u. 339 S., 8 °, m. 47 Taf.
3) Über die Zuschreibung von Zeichnun-
gen an Barent Avercamp scheint freilich
noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein.
DIE WELT KUNST
Jahrg.VII, Nr. 52/53 vom 24. Dezember 1933
Das letzte Quartal 1933 läuft mit dieser
Nummer ab. Wir bitten, die Abonnements-
gebühr für das I. Quartal 1934 im Betrage von
4,50 RM (für Deutschland) oder 5,50 RM (für
das Ausland), bzw. für das erste Halbjahr
9,— (resp. 11 RM) oder für das ganze
Jahr 1934 RM 18,— (resp. RM 22,—) b i s
zum 5. Januar 1934 einzusenden. Wir wer-
den uns andernfalls erlauben, den Quartals-
betrag durch die Post nachnehmen zu lassen.
Eine Zahlkarte liegt dieser Nummer bei.
WELTKUNST-VERLAG
G. m. b. H.
beiden überragenden Persönlichkeiten zum
Ausdruck bringen.
Eine Zeit, die wieder dahin gelangte, Aqua-
relle und Zeichnungen von Dürers, Grünewalds,
Cranachs und anderer großer Meister Hand
ihren Oelbildern gegenüber nicht als etwas
zweitrangiges, sondern als eine Kunst mit
andern Ausdrucksmitteln zu empfinden, wird
dieser neugeschaffenen Abteilung, die zu der
eigentlichen, sich vorläufig erst im Oberge-
schoß entwickelnden Gemäldesammlung organi-
schen Anschluß finden wird, ihre Zustimmung
und aufmerksame Teilnahme nicht versagen
und sie wird die Erwartung hegen, daß hier-
nach der Anschluß einer graphischen Abtei-
lung an die Nationalgalerie, berufen, das beste
des jüngeren deutschen Kunstschaffens auf den
Gebieten von Lithographie, Radierung, Holz-
schnitt usw. zu veranschaulichen, wohl nur
noch eine Frage der Zeit sein kann. Sie muß
anerkennen, wie stark sich auch im Ober-
geschoß die — wie schon gesagt worden ist
— vorerst mehr in der Gesamthaltung als in
den Einzelgruppierungen sichtbare Gliederung
zugunsten der jüngeren Kräfte erweitert hat.
Auch in diesem Dutzend von Räumen ist alles,
wozu die sehr hellen Wandanstriche in Gelb,
Graublau, Blaßrot usw. einen vorzüglichen
Inhalt Nr. 52/53
Zur Neuordnung im Berliner Kronprinzen-
palais .2
Hendrick und Barent Avercamp (mit Abb.) . 2
Auf den Spuren alter Meister II (mit 2 Abb.) 2
Chinesische Seidenstickereien (mit 2 Abb.) . 3
Neuerwerbungen des Wiener kunsthistori-
schen Museums (mit 2 Abb.). 3
Bekanntmachung des Bundes .... 3
Ausstellungen (mit Abb.). 4
Literatur . 4
P t c i s b 2. AAib.).-. &
Auktionskalender. 5
Nachrichten von Überall . 6
Abbildungen:
Das Wilton-Diptychon.1
S.-F. Ravenet, Kupferstich . . ..2
Nach Paolo Feronese, Venus und Adonis ... 2
H. Av e r k amp, Winter bei Alkmaar.2
Tierkampfszene (Elch und Greif) .3
Chinesische Seidenstickerei.3
Relief, Christus am Kreuze .3
S il b er ver g o 1 d et er R eis e alt ar .3
H. Ferb er, Mädchenkopf.. . • 4
A. Engh, Landschaft mir Kuhherde.4
P. da Mi 1 an o (?), Marmorbüste eines Prinzen ... 5
F. L a u r a n a, Marmorbüste einer Prinzessin .... 6
Auf den Spuren
alter Meister
Funde in Privatbesitz
II.
Veroneses „Venus und Adonis"
Unter Paolo Veroneses mythologischen
Darstellungen ist in der neuen Kunstliteratur
eine Komposition völlig übersehen worden.
Sie wird weder von Hadeln, noch in der Vero-
nese-Monographie von Fiocco (1928), noch in
dem diesen Künstler behandelnden Abschnitt
der Storia dell’arte italiana von A. Venturi
(Bd. IX, 4; 1929) erwähnt. Und doch ist sie
einst sehr populär gewesen.
Es handelt sich hier um eine ganz von den
bekannten Bildern von Veronese im Prado
(Nr. 482) und in Darmstadt (Nr. 96) unab-
hängige Bearbeitung des Themas. Auf dem
Madrider Bilde (Fiocco, Taf. LXXXVIH)
wacht Venus über den Schlaf des auf ihrem
S.-F. R a v e n e t, Kupferstich nach Veroneses
„Venus und Adonis“ der ehern. Slg. Dupille
Berlin, Kupferstichkabinett
Schoß ruhenden Adonis; auf dem stark von
Tizians Meisterwerk im Prado beeinflußten
Gemälde des Darmstädter Museums (abgebil-
*) Raffaello Borghini (Riposo, ed.
1584, p. 563); in seiner raschen Aufzählung Vero-
neses Werke vergißt er nicht, unter dem „zu-
letzt“ (also um 1580) ausgeführten Gemälden
..ein herrliches Bild, mit lebensgroßen Figuren“
der Venus und Adonis zu erwähnen.
det im Jahrbuch der
Preuß. Kunstsammlun-
gen, Bd. 36, 1915 S. 123)
nimmt Adonis von der
vom Rücken gesehenen
Göttin Abschied. Auf
dem hier zum erstenmal
reproduzierten Bilde
aus einer französischen
Privatsammlung mit
beinahe lebensgroßen
Gestalten der Venus und
Adonis (160 :130 cm;
siehe Abbildung) fin-
den wir eine neue,
dritte Interpretation des
schon vom ersten Bio-
graphen des Veronese
angeführten Sujets*):
der in einer recht
veronesischen Haltung
stehende Adonis faßt
mit der rechten Hand
die Brust der Venus,
während er mit der Lin-
ken eine Leine hält; sein
vorgeneigter Kopf mit
gekräuseltem Haar ist
mit dem des Jünglings
des Madrider wie auch
des Darmstädter Bildes
identisch; die Gestalt
der Venus, die mit der
Rechten den Hals ihres
Lieblings umarmt, ist in
einer noch kühneren
Verkürzung wiederge-
geben; ihr zurückge-
worfener Kopf ist por-
trätmäßig auf gefaßt;
in den Falten ihres Ge-
Nach Paolo Veronese, Venus und Adonis
Leinwand, 160 : 130 cm
Frankreich, Privatbesitz
wandes verbirgt sich
derselbe kleine schalkhafte Amor, der uns auf
vielen anderen Veroneses Bildern begegnet;
drei Jagdhunde füllen die untere linke Ecke
aus. Die beiden Hauptgestalten sind in einer
Pyramide aufgebaut, deren mit dem Kopfe des
Adonis gebildete Spitze beinahe den oberen
Gemälderand berührt, und nehmen fast die
ganze Bilderfläche in Anspruch. Die Land-
schaft ist auf die notwendigsten Andeutungen
reduziert; der stämmige geteilte Baum, die
Terrain-, Laub- und Luftbehandlung sind für
Veroneses Art durchaus typisch.
Der jetzige Zustand des stark nachgedun-
kelten, teilweise übermalten und in einem
„Galerieton“ gebadeten Bildes läßt keinen bin-
denden Schluß auf die Autorschaft ziehen.
Vorsichtshalber halte ich einstweilen dieses,
jedenfalls aus dem 16. Jahrhundert stammende
Bild für eine zeitgenössische Kopie nach einem
verschollenen Original.
Ob dieses Original mit dem wesentlich
kleineren Bilde, welches sich in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Sammlung
des Kriegsschatzmeisters Düpille befand und
von Simon-Francois Ravenet (1706—1774) ge-
stochen wurde, übereinstimmt, läßt sich natür-
lich nach dem Stich allein nicht beurteilen
(siehe Abbildung); mit dem von Borghini be-
schriebenen Bilde kann jedenfalls das Dupille-
sche Exemplar, schon seines Formats wegen
(es maß „drei Fuß zweieinhalb Zoll zu zwei
Fuß vier Zoll“ = 104 X 76 cm), nicht identifi-
ziert werden. Von dem hier beschriebenen
Gemälde unterscheidet sich der — als Spiegel-
bild, wie gewöhnlich, ausgeführte — Kupfer-
stich, von der Formauffassung abgesehen, nur
durch unwesentliche Detailveränderungen.
Schon das Vorhandensein dieses in der Vero-
nese-Literatur gleichfalls nicht beachteten
Stiches und der zeitgenössischen Kopie (oder
Replik ?) genügt, um die Aufmerksamkeit auf
die Komposition zu lenken, deren Erfindung
zweifelsohne dem Paolo Caliari selbst gehört.
Vielleicht wird das hier reproduzierte
Exemplar zur Entdeckung des verschollenen,
von S.-F. Ravenet gestochenen Bildes oder
auch anderer Variante, und damit zur Klärung
des Problems führen. Prof. Dr. W. Rakint
Hintergrund abgeben, neu gestaltet, sind die
Akzente gegen früher verändert worden. Trotz-
dem vermißt man nur weniges; schon bekannt
Gewesenes erscheint in ganz neuem Zusammen-
hang und viel des Interessanten und Bedeu-
tenden ist hinzugekommen. Einige Gruppen
machen bereits, wenn sich das Ganze auch erst
nach dem „Fertig“-Werden der Sammlung
übersehen lassen wird, den Eindruck des End-
gültigen. Besonders schön wieder die Anord-
nung der Werke der beiden Plastiker Lehm-
bruck (zwei Räume) und Barlach. Aus-
gezeichnet gehängt Kokoschka (zwei Por-
träts und eine Landschaft) und ihm gegen-
über die Bilder der Paula Modersohn. Marc
und Macke füllen einen gemeinsamen Saal.
Räumlich mit Feininger vereint Seehaus
und der „Goldfisch“ von Klee. Die „Brück e“
ist vollzählig da, wobei Heckel im großen
Bildformat nicht allzu günstig abschneidet.
Hofer ist mit drei Bildern, Beckmann und
Dix mit je zwei vertreten. Überhaupt
findet man von Kerschbaumer und Ahlers-
Hestermann, Bartning, Schrimpf, Kanold,
Lenk und Partikel an bis zu Crodel, Werner
Scholz und Otto-Andreas Schreiber eine
Fülle von charakteristischen Schöpfungen
von deutschen Künstlern der Neuzeit. In
einem Raum mit Kirchner und Rohlfs
vereinigt auch eine Wand mit Werken von
Nolde, die eine vollkommen neue Vor-
stellung von der Kunst dieses Malers gibt.
Wohltuend berührt der sachliche, ganz
schmucklos gebliebene Rahmen, in dem sich die
neuere deutsche Kunst repräsentiert, so daß
die Aufmerksamkeit ohne jede Ablenkung aus-
schließlich ihren Werken zugute kommen
kann.
Hans Zeeck.
Hendrick und Barent Avercamp
I.
Es ist seit langem ein offenes Geheimnis
gewesen, daß eine Gruppe von Gemälden, die
früher anstandslos unter dem Namen des
Hendrick Avercamp (mit dem Bei-
r i a 1 e s 'wichtiger waren, als die kunstgeschicht-
lichen Kapitel ihres Buches. Vermutlich lag auch
der Auftraggeberin der Publikation, der „Ver-
een i gi n g to t Beoefeningvan Overys-
selsch Regten Geschiedeni s“, zu deren
75jährigem Jubiläum das Werk fertiggestellt
zu dem behandelten Künstler direkten Bezug hat.
Da Fräulein ■ Weicker keine zünftige Kunsthisto-
rikerin ist, erschien ihr dagegen die restlose Be-
schränkung der Abhandlung auf das durch das
Thema Gegebene richtig, und wir Leser müssen
ihre guten Gründe zu dieser weisen Mäßigung
anerkennen.
Den Oeuvre - Verzeichnissen räumte
die Verfasserin weiten Platz ein. Wie in den
meisten neueren holländischen Künstlermono-
graphien basieren sie auf den Excerpten Hof-
stede de Groots, dessen Sammeleifer noch
namen „de Stomme van Campen“) gingen, von
einem B. Avercamp herrühren mußten. So
liegt es ziemlich genau schon zehn Jahre zu-
rück, daß in „O u d Holland“ in einem Auf-
satz über Arent Arentsz. ein geheimnisvoll an-
deutender Hinweis auf die Forschungen des
Herrn P. de Boer erfolgte, der sich wohl als
erster um die Unterscheidung der Werke bei-
der Künstler bemüht hatte. Tatsächlich ließ
sich eine kleine Gruppe1) meist mit dem vollen
Namen „Avercamp“ signierter Gemälde zu-
sammenstellen, die stilistisch eine Einheit bil-
den und die offenbar einer späteren Epoche
angehören, als selbst die vermutlich spätesten
der mit dem bekannten Monogramm HA des
Hendrick A. versehenen Bilder und Zeich-
nungen. Es ist trotzdem erst kurze Zeit her,
daß ein so charakteristischer B. Avercamp
wie das „Avercamp“ bezeichnete Winter-
bildchen im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum
offiziell als solcher katalogisiert und ausge-
stellt wurde; und sogar noch in jener reichen
Schau holländischer Winterlandschaften, die
im Februar 1932 in der Galerie J. G o u d -
stikker in Amsterdam abgehalten wurde,
fand sich ein nicht weniger typischer
B. Avercamp unter Hendricks Namen aus-
gestellt!
Hendrik Avercamp, Winter bei Alkmaar. 1619
Farbige Zeichnung, 12 : 21,7 cm
II.
Das Verdienst von Fräulein Weickers2)
rastloser Archivforschung ist es nun, uns über
die Lebensverhältnisse und den „Stammbaum“
der Familie Avercamp jede wünschenswerte Klar-
heit verschafft zu haben. War die Verfasserin
als Stadtarchivarin von Kämpen zwar für eine
derartige Arbeit prädestiniert, so verdankt sie
doch ohne Zweifel ihrem unermüdlichen Fleiße
den Erfolg dieser Sucharbeit. Was in ihrem
Buche an Daten und Urkunden aller
Art zusammengetragen ist, übertrifft auch hoch-
gespannte Erwartungen!
Es geht aus dem Vorwort hervor, daß der
Autorin die Sammlung und Gruppierung
dieses reichen urkundlichen Mate-
sein mußte, selbst vor allem an der umfänglichen
Veröffentlichung von Tatsächlichem und weniger
an der Erörterung künstlerischer und
kunstgeschichtlicher Fragen. Dies
möge man bei der Lektüre des Buches zur ge-
rechten Beurteilung der Qualitäten der Welcker-
schen Arbeit festhalten! Natürlich sind z. B.
die fast gleichzeitig entstandenen Monographien
Hans Schneiders und J. G. van Gelders über Lie-
vens und Jan van de Velde (1932 bzw. 1933)
wesentlich anders aufgebaut und gehen — weit-
schauend angelegt — bei ihrem Bemühen um Er-
örterung mehr oder weniger komplizierter kunst-
geschichtlicher Zusammenhänge in ihren For-
schungsergebnissen öfters über das hinaus, was
vielen künftigen Kunsthistorikern zugute kom-
men wird. Leider hat Fräulein Weicker — wohl
infolge der Knappheit der Zeit, die für die Her-
stellung des Katalogteiles zur Verfügung stand -—
die vielen Hunderte von Einzelnachweisen nicht
gleichmäßig ineinanderarbeiten und kritisch sich-
ten können, so daß gelegentlich Bilder und Zeich-
nungen doppelt, ja dreifach, anstatt unter einer
Nummer, registriert sind, was vor allem dann als
schwerwiegender Mangel empfunden wird, wenn
die eine Anführung im Hauptkatalog, die andere
unter den nur „zugeschriebenen“ Werken ge-
schah, oder wenn ein und dasselbe Bild sowohl
unter H.’s als auch B.’s Gemälden genannt
wurde! Bei einer Anordnung nach Stoffgruppen
wäre wohl manches dieser Versehen a priori ver-
mieden worden. Immerhin sorgt das ausführliche
Register dafür, daß die Verzeichnisse relativ
leicht benutzt werden können.
Wert ist auch auf gute, z. T. ganzseitige Ab-
bildungen gelegt worden. Mit Freude be-
grüßt man z. B. die Textillustrationen nach den
reizenden Figurenzeichnungen In Windsor und
a. a. O., auf denen die Autorin zahlreiche Por-
trätdarstellungen aus H.’s Verwandtschaft glaub-
haft nachzuweisen sucht.
III.
Im Rahmen einer knappen Besprechung ist es
freilich fast unmöglich, auf Einzelheiten
des Inhaltes einzugehen. Für Hendrick
sind wohl besonders bedeutungsvoll: jene
städtische Rechnung von 1622, durch die erwiesen
wird, daß er auch im Auftrage der Stadt Kämpen
künstlerisch tätig gewesen ist, und hauptsächlich
die Feststellung, daß er i m Mai 1634 in Käm-
pen beerdigt wurde. Aus dieser Begräbnis-
urkunde ergibt sich demnach auch quellenmäßig,
daß die eingangs genannte Bildergruppe aus den
50er und 60er Jahren nicht von Hendrick her-
rühren kann! Da man schon längst wußte, daß
sein Neffe Barent Avercamp gerade 1656,
1662 und noch einmal später (1677) als Obmann
der Kampener St. Lucasgilde fungiert hat, bleibt
es nur verwunderlich, daß erst jetzt durch
die Arbeit von Clara Weicker die bewegten
Lebensverhältnisse des B. an Hand zahlreicher
archivalischer Funde bis zu seinem Tode (im
Oktober 1679) verfolgt und damit gleichzeitig alle
letzten Zweifel an der Richtigkeit der de Boer-
schen und verschiedener weiterer Gemälde-
zuschreibungen an B.3) hinweggeräumt wurden.
Diese kurzen Proben genügen freilich kaum
als Andeutungen. Ebenso wie jeder Freund der
Avercampschen Malerei und Zeichenkunst muß
auch jeder für die holländische Kultur des
17. Jahrhunderts Interessierte das Welckersche
Werk zur Hand nehmen, da keine noch so ge-
schickte Auswahl ■— selbst der wichtigsten Tat-
sachen — einen Begriff von dem zwar begrenzten,
aber schier unerschöpflichen Inhalt dieser Publi-
kation geben kann. — sc —
t) Hierzu gehört z. B. das durch sein Datum
1655 bemerkenswerte Gemälde des Gottschald-
schen Vermächtnisses im Museum zu Leipzig,
aber auch die stattliche „Ansicht von Kämpen im
Winter“ im Rathaus zu Kämpen, deren Datum
1663 gelegentlich in seiner Echtheit angefochten
wurde.
2) Weicker, Clara J.: Hendrick Avercamp 1585
tot 1634 en Barent Avercamp 1612—1679, Schil-
ders tot Campen. De Erven J. J. T y 1 N. V.,
Zwolle. 1933. XVIII u. 339 S., 8 °, m. 47 Taf.
3) Über die Zuschreibung von Zeichnun-
gen an Barent Avercamp scheint freilich
noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein.