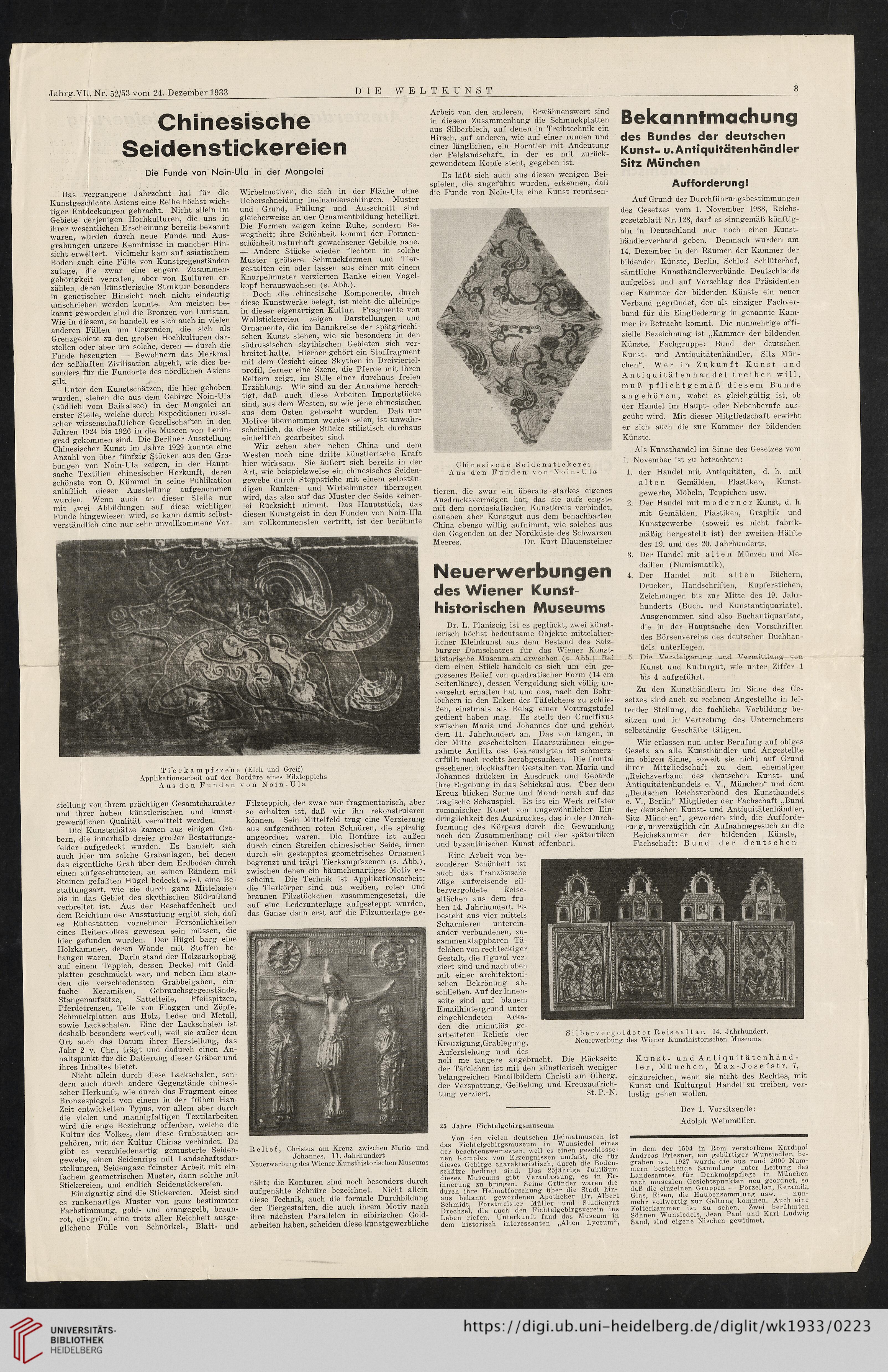Jahrg.VII, Nr. 52/53 vom 24. Dezember 1933
DIE WELTKUNST
3
Chinesische
Seidenstickereien
Die Funde von Noin-Ula in der Mongolei
Das vergangene Jahrzehnt hat für die
Kunstgeschichte Asiens eine Reihe höchst wich-
tiger Entdeckungen gebracht. Nicht allein im
Gebiete derjenigen Hochkulturen, die uns in
ihrer wesentlichen Erscheinung bereits bekannt
waren, wurden durch neue Funde und Aus-
grabungen unsere Kenntnisse in mancher Hin-
sicht erweitert. Vielmehr kam auf asiatischem
Boden auch eine Fülle von Kunstgegenständen
zutage, die zwar eine engere Zusammen-
gehörigkeit verraten, aber von Kulturen er-
zählen, deren künstlerische Struktur besonders
in genetischer Hinsicht noch nicht eindeutig
umschrieben werden konnte. Am meisten be-
kannt geworden sind die Bronzen von Luristan.
Wie in diesem, so handelt es sich auch in vielen
anderen Fällen um Gegenden, die sich als
Grenzgebiete zu den großen Hochkulturen dar-
stellen oder aber um solche, deren — durch die
Funde bezeugten — Bewohnern das Merkmal
der seßhaften Zivilisation abgeht, wie dies be-
sonders für die Fundorte des nördlichen Asiens
gilt.
Unter den Kunstschätzen, die hier gehoben
wurden, stehen die aus dem Gebirge Noin-Ula
(südlich vom Baikalsee) in der Mongolei an
erster Stelle, welche durch Expeditionen russi-
scher wissenschaftlicher Gesellschaften in den
Jahren 1924 bis 1926 in die Museen von Lenin-
grad gekommen sind. Die Berliner Ausstellung
Chinesischer Kunst im Jahre 1929 konnte eine
Anzahl von über fünfzig Stücken aus den Gra-
bungen von Noin-Ula zeigen, in der Haupt-
sache Textilien chinesischer Herkunft, deren
schönste von O. Kümmel in seine Publikation
anläßlich dieser Ausstellung aufgenommen
wurden. Wenn auch an dieser Stelle nur
mit zwei Abbildungen auf diese wichtigen
Funde hingewiesen wird, so kann damit selbst-
verständlich eine nur sehr unvollkommene Vor-
Wirbelmotiven, die sich in der Fläche ohne
Ueberschneidung ineinanderschlingen. Muster
und Grund, Füllung und Ausschnitt sind
gleicherweise an der Ornamentbildung beteiligt.
Die Formen zeigen keine Ruhe, sondern Be-
wegtheit; ihre Schönheit kommt der- Formen-
schönheit naturhaft gewachsener Gebilde nahe.
— Andere Stücke wieder flechten in solche
Muster größere Schmuckformen und Tier-
gestalten ein oder lassen aus einer mit einem
Knorpelmuster verzierten Ranke einen Vogel-
kopf herauswachsen (s. Abb.).
Doch die chinesische Komponente, durch
diese Kunstwerke belegt, ist nicht die alleinige
in dieser eigenartigen Kultur. Fragmente von
Wollstickereien zeigen Darstellungen und
Ornamente, die im Bannkreise der spätgriechi-
schen Kunst stehen, wie sie besonders in den
südrussischen skythischen Gebieten sich ver-
breitet hatte. Hierher gehört ein Stoffragment
mit dem Gesicht eines Skythen in Dreiviertel-
profil, ferner eine Szene, die Pferde mit ihren
Reitern zeigt, im Stile einer durchaus freien
Erzählung. Wir sind zu der Annahme berech-
tigt, daß auch diese Arbeiten Importstücke
sind, aus dem Westen, so wie jene chinesischen
aus dem Osten gebracht wurden. Daß nur
Motive übernommen worden seien, ist unwahr-
scheinlich, da diese Stücke stilistisch durchaus
einheitlich gearbeitet sind.
Wir sehen aber neben China und dem
Westen noch eine dritte künstlerische Kraft
hier wirksam. Sie äußert sich bereits in der
Art, wie beispielsweise ein chinesisches Seiden-
gewebe durch Steppstiche mit einem selbstän-
digen Ranken- und Wirbelmuster überzogen
wird, das also auf das Muster der Seide keiner-
lei Rücksicht nimmt. Das Hauptstück, das
diesen Kunstgeist in den Funden von Noin-Ula
am vollkommensten vertritt, ist der berühmte
T i e r k a m p f s z e'n e (Elch und Greif)
Applikationsarbeit auf der Bordüre eines Filzteppiehs
Ausden Funden von Noin-Ula
Stellung von ihrem prächtigen Gesamtcharakter
und ihrer hohen künstlerischen und kunst-
gewerblichen Qualität vermittelt werden.
Die Kunstschätze kamen aus einigen Grä-
bern, die innerhalb dreier großer Bestattungs-
felder auf gedeckt wurden. Es handelt sich
auch hier um solche Grabanlagen, bei denen
das eigentliche Grab über dem Erdboden durch
einen aufgeschütteten, an seinen Rändern mit
Steinen gefaßten Hügel bedeckt wird, eine Be-
stattungsart, wie sie durch ganz Mittelasien
bis in das Gebiet des skythischen Südrußland
verbreitet ist. Aus der Beschaffenheit und
dem Reichtum der Ausstattung ergibt sich, daß
es Ruhestätten vornehmer Persönlichkeiten
eines Reitervolkes gewesen sein müssen, die
hier gefunden wurden. Der Hügel barg eine
Holzkammer, deren Wände mit Stoffen be-
hangen waren. Darin stand der Holzsarkophag
auf einem Teppich, dessen Deckel mit Gold-
platten geschmückt war, und neben ihm stan-
den die verschiedensten Grabbeigaben, ein-
fache Keramiken, Gebrauchsgegenstände,
Stangenaufsätze, Sattelteile, Pfeilspitzen,
Pferdetrensen, Teile von Flaggen und Zöpfe,
Schmuckplatten aus Holz, Leder und Metall,
sowie Lackschalen. Eine der Lackschalen ist
deshalb besonders wertvoll, weil sie außer dem
Ort auch das Datum ihrer Herstellung, das
Jahr 2 v. Chr., trägt und dadurch einen An-
haltspunkt für die Datierung dieser Gräber und
ihres Inhaltes bietet.
Nicht allein durch diese Lackschalen, son-
dern auch durch andere Gegenstände chinesi-
scher Herkunft, wie durch das Fragment eines
Bronzespiegels von einem in der frühen Han-
Zeit entwickelten Typus, vor allem aber durch
die vielen und mannigfaltigen Textilarbeiten
wird die enge Beziehung offenbar, welche die
Kultur des Volkes, dem diese Grabstätten an-
gehören, mit der Kultur Chinas verbindet. Da
gibt es verschiedenartig gemusterte Seiden-
gewebe, einen Seidenrips mit Landschaftsdar-
stellungen, Seidengaze feinster Arbeit mit ein-
fachem geometrischen Muster, dann solche mit
Stickereien, und endlich Seidenstickereien.
Einzigartig sind die Stickereien. Meist sind
es rankenartige Muster von ganz bestimmter
Farbstimmung, gold- und orangegelb, braun-
rot, olivgrün, eine trotz aller Reichheit ausge-
glichene Fülle von Schnörkel-, Blatt- und
Filzteppich, der zwar nur fragmentarisch, aber
so erhalten ist, daß wir ihn rekonstruieren
können. Sein Mittelfeld trug eine Verzierung
aus aufgenähten roten Schnüren, die spiralig
angeordnet waren. Die Bordüre ist außen
durch einen Streifen chinesischer Seide, innen
durch ein gestepptes geometrisches Ornament
begrenzt und trägt Tierkampfszenen (s. Abb.),
zwischen denen ein bäumchenartiges Motiv er-
scheint. Die Technik ist Applikationsarbeit:
die Tierkörper sind aus weißen, roten und
braunen Filzstückchen zusammengesetzt, die
auf eine Lederunterlage aufgesteppt wurden,
das Ganze dann erst auf die Filzunterlage ge-
Relief, Christus am Kreuz zwischen Maria und
Johannes. 11. Jahrhundert
Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums
näht; die Konturen sind noch besonders durch
aufgenähte Schnüre bezeichnet. Nicht allein
diese Technik, auch die formale Durchbildung
der Tiergestalten, die auch ihrem Motiv nach
ihre nächsten Parallelen in sibirischen Gold-
arbeiten haben, scheiden diese kunstgewerbliche
Arbeit von den anderen. Erwähnenswert sind
in diesem Zusammenhang die Schmuckplatten
aus Silberblech, auf denen in Treibtechnik ein
Hirsch, auf anderen, wie auf einer runden und
einer länglichen, ein Horntier mit Andeutung
der Felslandschaft, in der es mit zurück-
gewendetem Kopfe steht, gegeben ist.
Es läßt sich auch aus diesen wenigen Bei-
spielen, die angeführt wurden, erkennen, daß
die Funde von Noin-Ula eine Kunst repräsen-
Chinesische Seidenstickerei
Aus den Funden von Noin-Ula
tieren, die zwar ein überaus - starkes eigenes
Ausdrucksvermögen hat, das sie aufs engste
mit dem nordasiatischen Kunstkreis verbindet,
daneben aber Kunstgut aus dem benachbarten
China ebenso willig aufnimmt, wie solches aus
den Gegenden an der Nordküste des Schwarzen
Meeres. Dr. Kurt Blauensteiner
Neuerwerbungen
des Wiener Kunst-
historischen Museums
Dr. L. Planiscig ist es geglückt, zwei künst-
lerisch höchst bedeutsame Objekte mittelalter-
licher Kleinkunst aus dem Bestand des Salz-
burger’ Domschatzes für das Wiener Kunst-
historische Museum zu erwerben (s. Abb.). Bei
dem einen Stück handelt es sich um ein ge-
gossenes Relief von quadratischer Form (14 cm
Seitenlänge), dessen Vergoldung sich völlig un-
versehrt erhalten hat und das, nach den Bohr-
löchern in den Ecken des Täfelchens zu schlie-
ßen, einstmals als Belag einer Vortragstafel
gedient haben mag. Es stellt den Crucifixus
zwischen Maria und Johannes dar und gehört
dem 11. Jahrhundert an. Das von langen, in
der Mitte gescheitelten Haarsträhnen einge-
rahmte Antlitz des Gekreuzigten ist schmerz-
erfüllt nach rechts herabgesunken. Die frontal
gesehenen blockhaften Gestalten von Maria und
Johannes drücken in Ausdruck und Gebärde
ihre Ergebung in das Schicksal aus. Über dem
Kreuz blicken Sonne und Mond herab auf das
tragische Schauspiel. Es ist ein Werk reifster
romanischer Kunst von ungewöhnlicher Ein-
dringlichkeit des Ausdruckes, das in der Durch-
formung des Körpers durch die Gewandung
noch den Zusammenhang mit der spätantiken
und byzantinischen Kunst offenbart.
Bekanntmachung
des Bundes der deutschen
Kunst- u. Antiquitätenhändler
Sitz München
Aufforderung!
Auf Grund der Durchführungsbestimmungen
des Gesetzes vom 1. November 1933, Reichs-
gesetzblatt Nr. 123, darf es sinngemäß künftig-
hin in Deutschland nur noch einen Kunst-
händlerverband geben. Demnach wurden am
14. Dezember in den Räumen der Kammer der
bildenden Künste, Berlin, Schloß Schlüterhof,
sämtliche Kunsthändlerverbände Deutschlands
aufgelöst und auf Vorschlag des Präsidenten
der Kammer der bildenden Künste ein neuer
Verband gegründet, der als einziger Fachver-
band für die Eingliederung in genannte Kam-
mer in Betracht kommt. Die nunmehrige offi-
zielle Bezeichnung ist „Kammer der bildenden
Künste, Fachgruppe: Bund der deutschen
Kunst- und Antiquitätenhändler, Sitz Mün-
chen“. Wer in Zukunft Kunst und
A n t i q u i t ä t e n h a n d e 1 treiben will,
muß pflichtgemäß diesem Bunde
angehören, wobei es gleichgültig ist, ob
der Handel im Haupt- oder Nebenberufe aus-
geübt wird. Mit dieser Mitgliedschaft erwirbt
er sich auch die zur Kammer der bildenden
Künste.
Als Kunsthandel im Sinne des Gesetzes vom
1. November ist zu betrachten:
1. der Handel mit Antiquitäten, d. h. mit
alten Gemälden, Plastiken, Kunst-
gewerbe1, Möbeln, Teppichen usw.
2. Der Handel mit moderner Kunst, d. h.
mit Gemälden, Plastiken, Graphik und
Kunstgewerbe (soweit es nicht fabrik-
mäßig hergestellt ist) der zweiten Hälfte
des 19. und des 20. Jahrhunderts.
3. Der Handel mit alten Münzen und Me-
daillen (Numismatik).
4. Der Handel mit alten Büchern,
Drucken, Handschriften, Kupferstichen,
Zeichnungen bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts (Buch- und Kunstantiquariate).
Ausgenommen sind also Buchantiquariate,
die in der Hauptsache den Vorschriften
des Börsenvereins des deutschen Buchhan-
dels unterliegen.
5. Die Versteigerung und Vermittlung von
Kunst und Kulturgut, wie unter Ziffer 1
bis 4 aufgeführt.
Zu den Kunsthändlern im Sinne des Ge-
setzes sind auch zu rechnen Angestellte in lei-
tender Stellung, die fachliche Vorbildung be-
sitzen und in Vertretung des Unternehmers
selbständig Geschäfte tätigen.
Wir erlassen nun unter Berufung auf obiges
Gesetz an alle Kunsthändler und Angestellte
im obigen Sinne, soweit sie nicht auf Grund
ihrer Mitgliedschaft zu dem ehemaligen
„Reichsverband des deutschen Kunst- und
Antiquitätenhandels e. V., München“ und dem
„Deutschen Reichsverband des Kunsthandels
e. V., Berlin“ Mitglieder der Fachschaft „Bund
der deutschen Kunst- und Antiquitätenhändler,
Sitz München“, geworden sind, die Aufforde-
rung, unverzüglich ein Aufnahmegesuch an die
Reichskammer der bildenden Künste,
Fachschaft: Bund der deutschen
Eine Arbeit von be-
sonderer Schönheit ist
auch das französische
Züge aufweisende sil-
bervergoldete Reise-
altächen aus dem frü-
hen 14. Jahrhundert. Es
besteht aus vier mittels
Scharnieren unterein-
ander verbundenen, zu-
sammenklappbaren Tä-
felchen von rechteckiger
Gestalt, die figural ver-
ziert sind und nach oben
mit einer architektoni-
schen Bekrönung ab-
schließen. Auf der Innen-
seite sind auf blauem
Emailhintergrund unter
eingeblendeten Arka-
den die minutiös ge-
arbeiteten Reliefs der
Kreuzigung,Grablegung,
Auferstehung und des
noli me tangere angebracht.
Silbervergoldeter Reisealtar. 14. Jahrhundert.
Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums
Die Rückseite Kunst- und Antiquitätenhänd-
der Täfelchen ist mit den künstlerisch weniger
belangreichen Emailbildern Christi am Ölberg,
der Verspottung, Geißelung und Kreuzaufrich-
tung verziert. St. P.-N.
ler, München, Max-Josefstr. 7,
einzureichen, wenn sie nicht des Rechtes, mit
Kunst und Kulturgut Handel zu treiben, ver-
lustig gehen wollen.
25 Jahre Fichtelgebirgsmuseum
Von den vielen deutschen Heimatmuseen ist
das Fichtelgebirgsrnuseum in Wunsiedel eines
der beachtenswertesten, weil es einen geschlosse-
nen Komplex von Erzeugnissen umfaßt, die für
dieses Gebirge charakteristisch, durch die Boden-
schätze bedingt sind. Das 25jährige Jubiläum
dieses Museums gibt Veranlassung, es in Er-
innerung zu bringen. Seine Gründer waren die
durch ihre Heimatforschung über die Stadt hin-
aus bekannt gewordenen Apotheker Dr. Albert
Schmidt, Forstmeister Müller und Studienrat
Drechsel, die auch den Fichtelgebirgsverein ins
Leben riefen. Unterkunft fand das Museum in
dem historisch interessanten „Alten Lyceum“,
Der 1. Vorsitzende:
Adolph Weinmüller.
in dem der 1504 in Rom verstorbene Kardinal
Andreas Friesner, ein gebürtiger Wunsiedler, be-
graben ist. 1927 wurde die aus rund 2000 Num-
mern bestehende Sammlung unter Leitung des
Landesamtes für Denkmalspflege in München
nach musealen Gesichtspunkten neu geordnet, so
daß die einzelnen Gruppen ■— Porzellan, Keramik,
Glas, Eisen, die Haubensammlung usw. ■— nun-
mehr vollwertig zur Geltung kommen. Auch eine
Folterkammer ist zu sehen. Zwei berühmten
Söhnen Wunsiedels, Jean Paul und Karl Ludwig
Sand, sind eigene Nischen gewidmet.
DIE WELTKUNST
3
Chinesische
Seidenstickereien
Die Funde von Noin-Ula in der Mongolei
Das vergangene Jahrzehnt hat für die
Kunstgeschichte Asiens eine Reihe höchst wich-
tiger Entdeckungen gebracht. Nicht allein im
Gebiete derjenigen Hochkulturen, die uns in
ihrer wesentlichen Erscheinung bereits bekannt
waren, wurden durch neue Funde und Aus-
grabungen unsere Kenntnisse in mancher Hin-
sicht erweitert. Vielmehr kam auf asiatischem
Boden auch eine Fülle von Kunstgegenständen
zutage, die zwar eine engere Zusammen-
gehörigkeit verraten, aber von Kulturen er-
zählen, deren künstlerische Struktur besonders
in genetischer Hinsicht noch nicht eindeutig
umschrieben werden konnte. Am meisten be-
kannt geworden sind die Bronzen von Luristan.
Wie in diesem, so handelt es sich auch in vielen
anderen Fällen um Gegenden, die sich als
Grenzgebiete zu den großen Hochkulturen dar-
stellen oder aber um solche, deren — durch die
Funde bezeugten — Bewohnern das Merkmal
der seßhaften Zivilisation abgeht, wie dies be-
sonders für die Fundorte des nördlichen Asiens
gilt.
Unter den Kunstschätzen, die hier gehoben
wurden, stehen die aus dem Gebirge Noin-Ula
(südlich vom Baikalsee) in der Mongolei an
erster Stelle, welche durch Expeditionen russi-
scher wissenschaftlicher Gesellschaften in den
Jahren 1924 bis 1926 in die Museen von Lenin-
grad gekommen sind. Die Berliner Ausstellung
Chinesischer Kunst im Jahre 1929 konnte eine
Anzahl von über fünfzig Stücken aus den Gra-
bungen von Noin-Ula zeigen, in der Haupt-
sache Textilien chinesischer Herkunft, deren
schönste von O. Kümmel in seine Publikation
anläßlich dieser Ausstellung aufgenommen
wurden. Wenn auch an dieser Stelle nur
mit zwei Abbildungen auf diese wichtigen
Funde hingewiesen wird, so kann damit selbst-
verständlich eine nur sehr unvollkommene Vor-
Wirbelmotiven, die sich in der Fläche ohne
Ueberschneidung ineinanderschlingen. Muster
und Grund, Füllung und Ausschnitt sind
gleicherweise an der Ornamentbildung beteiligt.
Die Formen zeigen keine Ruhe, sondern Be-
wegtheit; ihre Schönheit kommt der- Formen-
schönheit naturhaft gewachsener Gebilde nahe.
— Andere Stücke wieder flechten in solche
Muster größere Schmuckformen und Tier-
gestalten ein oder lassen aus einer mit einem
Knorpelmuster verzierten Ranke einen Vogel-
kopf herauswachsen (s. Abb.).
Doch die chinesische Komponente, durch
diese Kunstwerke belegt, ist nicht die alleinige
in dieser eigenartigen Kultur. Fragmente von
Wollstickereien zeigen Darstellungen und
Ornamente, die im Bannkreise der spätgriechi-
schen Kunst stehen, wie sie besonders in den
südrussischen skythischen Gebieten sich ver-
breitet hatte. Hierher gehört ein Stoffragment
mit dem Gesicht eines Skythen in Dreiviertel-
profil, ferner eine Szene, die Pferde mit ihren
Reitern zeigt, im Stile einer durchaus freien
Erzählung. Wir sind zu der Annahme berech-
tigt, daß auch diese Arbeiten Importstücke
sind, aus dem Westen, so wie jene chinesischen
aus dem Osten gebracht wurden. Daß nur
Motive übernommen worden seien, ist unwahr-
scheinlich, da diese Stücke stilistisch durchaus
einheitlich gearbeitet sind.
Wir sehen aber neben China und dem
Westen noch eine dritte künstlerische Kraft
hier wirksam. Sie äußert sich bereits in der
Art, wie beispielsweise ein chinesisches Seiden-
gewebe durch Steppstiche mit einem selbstän-
digen Ranken- und Wirbelmuster überzogen
wird, das also auf das Muster der Seide keiner-
lei Rücksicht nimmt. Das Hauptstück, das
diesen Kunstgeist in den Funden von Noin-Ula
am vollkommensten vertritt, ist der berühmte
T i e r k a m p f s z e'n e (Elch und Greif)
Applikationsarbeit auf der Bordüre eines Filzteppiehs
Ausden Funden von Noin-Ula
Stellung von ihrem prächtigen Gesamtcharakter
und ihrer hohen künstlerischen und kunst-
gewerblichen Qualität vermittelt werden.
Die Kunstschätze kamen aus einigen Grä-
bern, die innerhalb dreier großer Bestattungs-
felder auf gedeckt wurden. Es handelt sich
auch hier um solche Grabanlagen, bei denen
das eigentliche Grab über dem Erdboden durch
einen aufgeschütteten, an seinen Rändern mit
Steinen gefaßten Hügel bedeckt wird, eine Be-
stattungsart, wie sie durch ganz Mittelasien
bis in das Gebiet des skythischen Südrußland
verbreitet ist. Aus der Beschaffenheit und
dem Reichtum der Ausstattung ergibt sich, daß
es Ruhestätten vornehmer Persönlichkeiten
eines Reitervolkes gewesen sein müssen, die
hier gefunden wurden. Der Hügel barg eine
Holzkammer, deren Wände mit Stoffen be-
hangen waren. Darin stand der Holzsarkophag
auf einem Teppich, dessen Deckel mit Gold-
platten geschmückt war, und neben ihm stan-
den die verschiedensten Grabbeigaben, ein-
fache Keramiken, Gebrauchsgegenstände,
Stangenaufsätze, Sattelteile, Pfeilspitzen,
Pferdetrensen, Teile von Flaggen und Zöpfe,
Schmuckplatten aus Holz, Leder und Metall,
sowie Lackschalen. Eine der Lackschalen ist
deshalb besonders wertvoll, weil sie außer dem
Ort auch das Datum ihrer Herstellung, das
Jahr 2 v. Chr., trägt und dadurch einen An-
haltspunkt für die Datierung dieser Gräber und
ihres Inhaltes bietet.
Nicht allein durch diese Lackschalen, son-
dern auch durch andere Gegenstände chinesi-
scher Herkunft, wie durch das Fragment eines
Bronzespiegels von einem in der frühen Han-
Zeit entwickelten Typus, vor allem aber durch
die vielen und mannigfaltigen Textilarbeiten
wird die enge Beziehung offenbar, welche die
Kultur des Volkes, dem diese Grabstätten an-
gehören, mit der Kultur Chinas verbindet. Da
gibt es verschiedenartig gemusterte Seiden-
gewebe, einen Seidenrips mit Landschaftsdar-
stellungen, Seidengaze feinster Arbeit mit ein-
fachem geometrischen Muster, dann solche mit
Stickereien, und endlich Seidenstickereien.
Einzigartig sind die Stickereien. Meist sind
es rankenartige Muster von ganz bestimmter
Farbstimmung, gold- und orangegelb, braun-
rot, olivgrün, eine trotz aller Reichheit ausge-
glichene Fülle von Schnörkel-, Blatt- und
Filzteppich, der zwar nur fragmentarisch, aber
so erhalten ist, daß wir ihn rekonstruieren
können. Sein Mittelfeld trug eine Verzierung
aus aufgenähten roten Schnüren, die spiralig
angeordnet waren. Die Bordüre ist außen
durch einen Streifen chinesischer Seide, innen
durch ein gestepptes geometrisches Ornament
begrenzt und trägt Tierkampfszenen (s. Abb.),
zwischen denen ein bäumchenartiges Motiv er-
scheint. Die Technik ist Applikationsarbeit:
die Tierkörper sind aus weißen, roten und
braunen Filzstückchen zusammengesetzt, die
auf eine Lederunterlage aufgesteppt wurden,
das Ganze dann erst auf die Filzunterlage ge-
Relief, Christus am Kreuz zwischen Maria und
Johannes. 11. Jahrhundert
Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums
näht; die Konturen sind noch besonders durch
aufgenähte Schnüre bezeichnet. Nicht allein
diese Technik, auch die formale Durchbildung
der Tiergestalten, die auch ihrem Motiv nach
ihre nächsten Parallelen in sibirischen Gold-
arbeiten haben, scheiden diese kunstgewerbliche
Arbeit von den anderen. Erwähnenswert sind
in diesem Zusammenhang die Schmuckplatten
aus Silberblech, auf denen in Treibtechnik ein
Hirsch, auf anderen, wie auf einer runden und
einer länglichen, ein Horntier mit Andeutung
der Felslandschaft, in der es mit zurück-
gewendetem Kopfe steht, gegeben ist.
Es läßt sich auch aus diesen wenigen Bei-
spielen, die angeführt wurden, erkennen, daß
die Funde von Noin-Ula eine Kunst repräsen-
Chinesische Seidenstickerei
Aus den Funden von Noin-Ula
tieren, die zwar ein überaus - starkes eigenes
Ausdrucksvermögen hat, das sie aufs engste
mit dem nordasiatischen Kunstkreis verbindet,
daneben aber Kunstgut aus dem benachbarten
China ebenso willig aufnimmt, wie solches aus
den Gegenden an der Nordküste des Schwarzen
Meeres. Dr. Kurt Blauensteiner
Neuerwerbungen
des Wiener Kunst-
historischen Museums
Dr. L. Planiscig ist es geglückt, zwei künst-
lerisch höchst bedeutsame Objekte mittelalter-
licher Kleinkunst aus dem Bestand des Salz-
burger’ Domschatzes für das Wiener Kunst-
historische Museum zu erwerben (s. Abb.). Bei
dem einen Stück handelt es sich um ein ge-
gossenes Relief von quadratischer Form (14 cm
Seitenlänge), dessen Vergoldung sich völlig un-
versehrt erhalten hat und das, nach den Bohr-
löchern in den Ecken des Täfelchens zu schlie-
ßen, einstmals als Belag einer Vortragstafel
gedient haben mag. Es stellt den Crucifixus
zwischen Maria und Johannes dar und gehört
dem 11. Jahrhundert an. Das von langen, in
der Mitte gescheitelten Haarsträhnen einge-
rahmte Antlitz des Gekreuzigten ist schmerz-
erfüllt nach rechts herabgesunken. Die frontal
gesehenen blockhaften Gestalten von Maria und
Johannes drücken in Ausdruck und Gebärde
ihre Ergebung in das Schicksal aus. Über dem
Kreuz blicken Sonne und Mond herab auf das
tragische Schauspiel. Es ist ein Werk reifster
romanischer Kunst von ungewöhnlicher Ein-
dringlichkeit des Ausdruckes, das in der Durch-
formung des Körpers durch die Gewandung
noch den Zusammenhang mit der spätantiken
und byzantinischen Kunst offenbart.
Bekanntmachung
des Bundes der deutschen
Kunst- u. Antiquitätenhändler
Sitz München
Aufforderung!
Auf Grund der Durchführungsbestimmungen
des Gesetzes vom 1. November 1933, Reichs-
gesetzblatt Nr. 123, darf es sinngemäß künftig-
hin in Deutschland nur noch einen Kunst-
händlerverband geben. Demnach wurden am
14. Dezember in den Räumen der Kammer der
bildenden Künste, Berlin, Schloß Schlüterhof,
sämtliche Kunsthändlerverbände Deutschlands
aufgelöst und auf Vorschlag des Präsidenten
der Kammer der bildenden Künste ein neuer
Verband gegründet, der als einziger Fachver-
band für die Eingliederung in genannte Kam-
mer in Betracht kommt. Die nunmehrige offi-
zielle Bezeichnung ist „Kammer der bildenden
Künste, Fachgruppe: Bund der deutschen
Kunst- und Antiquitätenhändler, Sitz Mün-
chen“. Wer in Zukunft Kunst und
A n t i q u i t ä t e n h a n d e 1 treiben will,
muß pflichtgemäß diesem Bunde
angehören, wobei es gleichgültig ist, ob
der Handel im Haupt- oder Nebenberufe aus-
geübt wird. Mit dieser Mitgliedschaft erwirbt
er sich auch die zur Kammer der bildenden
Künste.
Als Kunsthandel im Sinne des Gesetzes vom
1. November ist zu betrachten:
1. der Handel mit Antiquitäten, d. h. mit
alten Gemälden, Plastiken, Kunst-
gewerbe1, Möbeln, Teppichen usw.
2. Der Handel mit moderner Kunst, d. h.
mit Gemälden, Plastiken, Graphik und
Kunstgewerbe (soweit es nicht fabrik-
mäßig hergestellt ist) der zweiten Hälfte
des 19. und des 20. Jahrhunderts.
3. Der Handel mit alten Münzen und Me-
daillen (Numismatik).
4. Der Handel mit alten Büchern,
Drucken, Handschriften, Kupferstichen,
Zeichnungen bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts (Buch- und Kunstantiquariate).
Ausgenommen sind also Buchantiquariate,
die in der Hauptsache den Vorschriften
des Börsenvereins des deutschen Buchhan-
dels unterliegen.
5. Die Versteigerung und Vermittlung von
Kunst und Kulturgut, wie unter Ziffer 1
bis 4 aufgeführt.
Zu den Kunsthändlern im Sinne des Ge-
setzes sind auch zu rechnen Angestellte in lei-
tender Stellung, die fachliche Vorbildung be-
sitzen und in Vertretung des Unternehmers
selbständig Geschäfte tätigen.
Wir erlassen nun unter Berufung auf obiges
Gesetz an alle Kunsthändler und Angestellte
im obigen Sinne, soweit sie nicht auf Grund
ihrer Mitgliedschaft zu dem ehemaligen
„Reichsverband des deutschen Kunst- und
Antiquitätenhandels e. V., München“ und dem
„Deutschen Reichsverband des Kunsthandels
e. V., Berlin“ Mitglieder der Fachschaft „Bund
der deutschen Kunst- und Antiquitätenhändler,
Sitz München“, geworden sind, die Aufforde-
rung, unverzüglich ein Aufnahmegesuch an die
Reichskammer der bildenden Künste,
Fachschaft: Bund der deutschen
Eine Arbeit von be-
sonderer Schönheit ist
auch das französische
Züge aufweisende sil-
bervergoldete Reise-
altächen aus dem frü-
hen 14. Jahrhundert. Es
besteht aus vier mittels
Scharnieren unterein-
ander verbundenen, zu-
sammenklappbaren Tä-
felchen von rechteckiger
Gestalt, die figural ver-
ziert sind und nach oben
mit einer architektoni-
schen Bekrönung ab-
schließen. Auf der Innen-
seite sind auf blauem
Emailhintergrund unter
eingeblendeten Arka-
den die minutiös ge-
arbeiteten Reliefs der
Kreuzigung,Grablegung,
Auferstehung und des
noli me tangere angebracht.
Silbervergoldeter Reisealtar. 14. Jahrhundert.
Neuerwerbung des Wiener Kunsthistorischen Museums
Die Rückseite Kunst- und Antiquitätenhänd-
der Täfelchen ist mit den künstlerisch weniger
belangreichen Emailbildern Christi am Ölberg,
der Verspottung, Geißelung und Kreuzaufrich-
tung verziert. St. P.-N.
ler, München, Max-Josefstr. 7,
einzureichen, wenn sie nicht des Rechtes, mit
Kunst und Kulturgut Handel zu treiben, ver-
lustig gehen wollen.
25 Jahre Fichtelgebirgsmuseum
Von den vielen deutschen Heimatmuseen ist
das Fichtelgebirgsrnuseum in Wunsiedel eines
der beachtenswertesten, weil es einen geschlosse-
nen Komplex von Erzeugnissen umfaßt, die für
dieses Gebirge charakteristisch, durch die Boden-
schätze bedingt sind. Das 25jährige Jubiläum
dieses Museums gibt Veranlassung, es in Er-
innerung zu bringen. Seine Gründer waren die
durch ihre Heimatforschung über die Stadt hin-
aus bekannt gewordenen Apotheker Dr. Albert
Schmidt, Forstmeister Müller und Studienrat
Drechsel, die auch den Fichtelgebirgsverein ins
Leben riefen. Unterkunft fand das Museum in
dem historisch interessanten „Alten Lyceum“,
Der 1. Vorsitzende:
Adolph Weinmüller.
in dem der 1504 in Rom verstorbene Kardinal
Andreas Friesner, ein gebürtiger Wunsiedler, be-
graben ist. 1927 wurde die aus rund 2000 Num-
mern bestehende Sammlung unter Leitung des
Landesamtes für Denkmalspflege in München
nach musealen Gesichtspunkten neu geordnet, so
daß die einzelnen Gruppen ■— Porzellan, Keramik,
Glas, Eisen, die Haubensammlung usw. ■— nun-
mehr vollwertig zur Geltung kommen. Auch eine
Folterkammer ist zu sehen. Zwei berühmten
Söhnen Wunsiedels, Jean Paul und Karl Ludwig
Sand, sind eigene Nischen gewidmet.