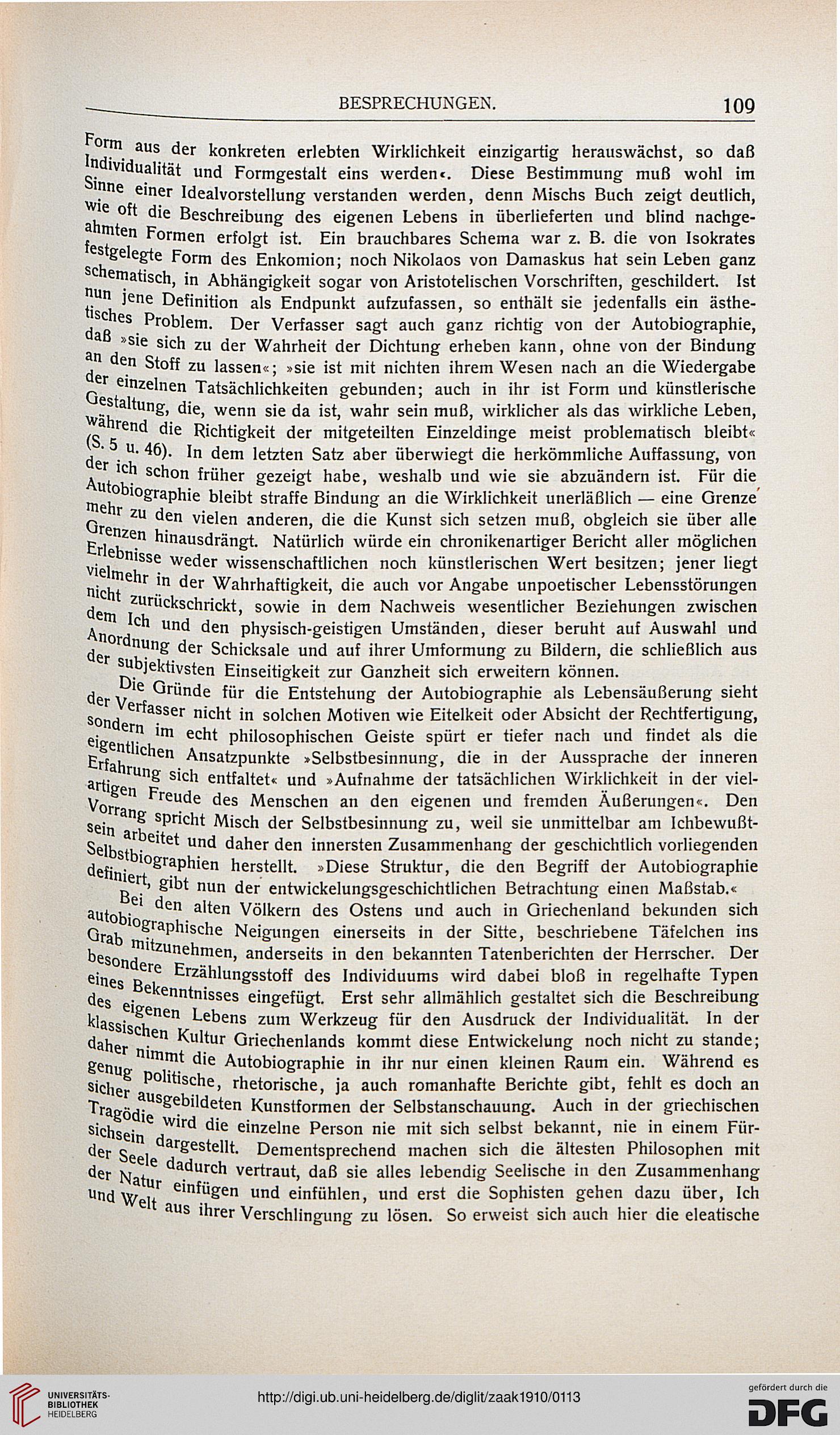BESPRECHUNGEN. 109
I ri"1- 3US der konkreten erlebten Wirklichkeit einzigartig herauswächst, so daß
vidualität und Formgestalt eins werden«. Diese Bestimmung muß wohl im
e einer Idealvorstellung verstanden werden, denn Mischs Buch zeigt deutlich,
oft die Beschreibung des eigenen Lebens in überlieferten und blind nachge-
ten Formen erfolgt ist. Ein brauchbares Schema war z. B. die von Isokrates
gelegte Form des Enkomion; noch Nikolaos von Damaskus hat sein Leben ganz
rnatisch, in Abhängigkeit sogar von Aristotelischen Vorschriften, geschildert. Ist
n jene Definition als Endpunkt aufzufassen, so enthält sie jedenfalls ein ästhe-
, es Problem. Der Verfasser sagt auch ganz richtig von der Autobiographie,
»sie sich zu der Wahrheit der Dichtung erheben kann, ohne von der Bindung
en Stoff zu lassen«; »sie ist mit nichten ihrem Wesen nach an die Wiedergabe
einzelnen Tatsächlichkeiten gebunden; auch in ihr ist Form und künstlerische
... altung, die, wenn sie da ist, wahr sein muß, wirklicher als das wirkliche Leben,
,„ re die Richtigkeit der mitgeteilten Einzeldinge meist problematisch bleibt«
• u. 46). In dem letzten Satz aber überwiegt die herkömmliche Auffassung, von
A u- scnon früher gezeigt habe, weshalb und wie sie abzuändern ist. Für die
10graphie bleibt straffe Bindung an die Wirklichkeit unerläßlich — eine Grenze
zu den vielen anderen, die die Kunst sich setzen muß, obgleich sie über alle
Erl ^ ausdrängt. Natürlich würde ein chronikenartiger Bericht aller möglichen
viel 1SSe wec*er wissenschaftlichen noch künstlerischen Wert besitzen; jener liegt
n: . ln der Wahrhaftigkeit, die auch vor Angabe unpoetischer Lebensstörungen
dem IZUruc'cscrlric'<t, sowie in dem Nachweis wesentlicher Beziehungen zwischen
^ und den physisch-geistigen Umständen, dieser beruht auf Auswahl und
der nunS der Schicksale und auf ihrer Umformung zu Bildern, die schließlich aus
jektivsten Einseitigkeit zur Ganzheit sich erweitern können.
der v le Gründe für die Entstehung der Autobiographie als Lebensäußerung sieht
sond Sser nicnt in solchen Motiven wie Eitelkeit oder Absicht der Rechtfertigung,
ej ""n irn echt philosophischen Geiste spürt er tiefer nach und findet als die
Erf h en Ansatzpunkte »Selbstbesinnung, die in der Aussprache der inneren
arti rU'lg S'Cl1 entraltet« und »Aufnahme der tatsächlichen Wirklichkeit in der viel-
y0 Freude des Menschen an den eigenen und fremden Äußerungen«. Den
sein k SPr'cn' Misch der Selbstbesinnung zu, weil sie unmittelbar am Ichbewußt-
Selhstk- UnC* daher den innersten Zusammenhang der geschichtlich vorliegenden
defin- 10grapnien herstellt. »Diese Struktur, die den Begriff der Autobiographie
> gibt nun der entwickelungsgeschichtlichen Betrachtung einen Maßstab.«
autoh' a"en Völkern des Ostens und auch in Griechenland bekunden sich
QraL Sraphiscne Neigungen einerseits in der Sitte, beschriebene Täfelchen ins
beso , ' zunehmen, anderseits in den bekannten Tatenberichten der Herrscher. Der
eines R6r^ Erzählungsstoff des Individuums wird dabei bloß in regelhafte Typen
des e' 6 nisses eingefügt. Erst sehr allmählich gestaltet sich die Beschreibung
klassj g^nen Lebens zum Werkzeug für den Ausdruck der Individualität. In der
daher -^ ^ultur Griechenlands kommt diese Entwickelung noch nicht zu stände;
genug lm'n.t d'e Aut°biographie in ihr nur einen kleinen Raum ein. Während es
sicher tiscne> rhetorische, ja auch romanhafte Berichte gibt, fehlt es doch an
^ragöd USget)ildeten Kunstlormen der Selbstanschauung. Auch in der griechischen
sichsejn HW'rd die einzelne Person nie mit sich selbst bekannt, nie in einem Für-
der se 1 argeste"t- Dementsprechend machen sich die ältesten Philosophen mit
der Naf6 . urcn vertraut, daß sie alles lebendig Seelische in den Zusammenhang
und Welt einfüSen und einfühlen, und erst die Sophisten gehen dazu über, Ich
aus ihrer Verschlingung zu lösen. So erweist sich auch hier die eieatische
I ri"1- 3US der konkreten erlebten Wirklichkeit einzigartig herauswächst, so daß
vidualität und Formgestalt eins werden«. Diese Bestimmung muß wohl im
e einer Idealvorstellung verstanden werden, denn Mischs Buch zeigt deutlich,
oft die Beschreibung des eigenen Lebens in überlieferten und blind nachge-
ten Formen erfolgt ist. Ein brauchbares Schema war z. B. die von Isokrates
gelegte Form des Enkomion; noch Nikolaos von Damaskus hat sein Leben ganz
rnatisch, in Abhängigkeit sogar von Aristotelischen Vorschriften, geschildert. Ist
n jene Definition als Endpunkt aufzufassen, so enthält sie jedenfalls ein ästhe-
, es Problem. Der Verfasser sagt auch ganz richtig von der Autobiographie,
»sie sich zu der Wahrheit der Dichtung erheben kann, ohne von der Bindung
en Stoff zu lassen«; »sie ist mit nichten ihrem Wesen nach an die Wiedergabe
einzelnen Tatsächlichkeiten gebunden; auch in ihr ist Form und künstlerische
... altung, die, wenn sie da ist, wahr sein muß, wirklicher als das wirkliche Leben,
,„ re die Richtigkeit der mitgeteilten Einzeldinge meist problematisch bleibt«
• u. 46). In dem letzten Satz aber überwiegt die herkömmliche Auffassung, von
A u- scnon früher gezeigt habe, weshalb und wie sie abzuändern ist. Für die
10graphie bleibt straffe Bindung an die Wirklichkeit unerläßlich — eine Grenze
zu den vielen anderen, die die Kunst sich setzen muß, obgleich sie über alle
Erl ^ ausdrängt. Natürlich würde ein chronikenartiger Bericht aller möglichen
viel 1SSe wec*er wissenschaftlichen noch künstlerischen Wert besitzen; jener liegt
n: . ln der Wahrhaftigkeit, die auch vor Angabe unpoetischer Lebensstörungen
dem IZUruc'cscrlric'<t, sowie in dem Nachweis wesentlicher Beziehungen zwischen
^ und den physisch-geistigen Umständen, dieser beruht auf Auswahl und
der nunS der Schicksale und auf ihrer Umformung zu Bildern, die schließlich aus
jektivsten Einseitigkeit zur Ganzheit sich erweitern können.
der v le Gründe für die Entstehung der Autobiographie als Lebensäußerung sieht
sond Sser nicnt in solchen Motiven wie Eitelkeit oder Absicht der Rechtfertigung,
ej ""n irn echt philosophischen Geiste spürt er tiefer nach und findet als die
Erf h en Ansatzpunkte »Selbstbesinnung, die in der Aussprache der inneren
arti rU'lg S'Cl1 entraltet« und »Aufnahme der tatsächlichen Wirklichkeit in der viel-
y0 Freude des Menschen an den eigenen und fremden Äußerungen«. Den
sein k SPr'cn' Misch der Selbstbesinnung zu, weil sie unmittelbar am Ichbewußt-
Selhstk- UnC* daher den innersten Zusammenhang der geschichtlich vorliegenden
defin- 10grapnien herstellt. »Diese Struktur, die den Begriff der Autobiographie
> gibt nun der entwickelungsgeschichtlichen Betrachtung einen Maßstab.«
autoh' a"en Völkern des Ostens und auch in Griechenland bekunden sich
QraL Sraphiscne Neigungen einerseits in der Sitte, beschriebene Täfelchen ins
beso , ' zunehmen, anderseits in den bekannten Tatenberichten der Herrscher. Der
eines R6r^ Erzählungsstoff des Individuums wird dabei bloß in regelhafte Typen
des e' 6 nisses eingefügt. Erst sehr allmählich gestaltet sich die Beschreibung
klassj g^nen Lebens zum Werkzeug für den Ausdruck der Individualität. In der
daher -^ ^ultur Griechenlands kommt diese Entwickelung noch nicht zu stände;
genug lm'n.t d'e Aut°biographie in ihr nur einen kleinen Raum ein. Während es
sicher tiscne> rhetorische, ja auch romanhafte Berichte gibt, fehlt es doch an
^ragöd USget)ildeten Kunstlormen der Selbstanschauung. Auch in der griechischen
sichsejn HW'rd die einzelne Person nie mit sich selbst bekannt, nie in einem Für-
der se 1 argeste"t- Dementsprechend machen sich die ältesten Philosophen mit
der Naf6 . urcn vertraut, daß sie alles lebendig Seelische in den Zusammenhang
und Welt einfüSen und einfühlen, und erst die Sophisten gehen dazu über, Ich
aus ihrer Verschlingung zu lösen. So erweist sich auch hier die eieatische