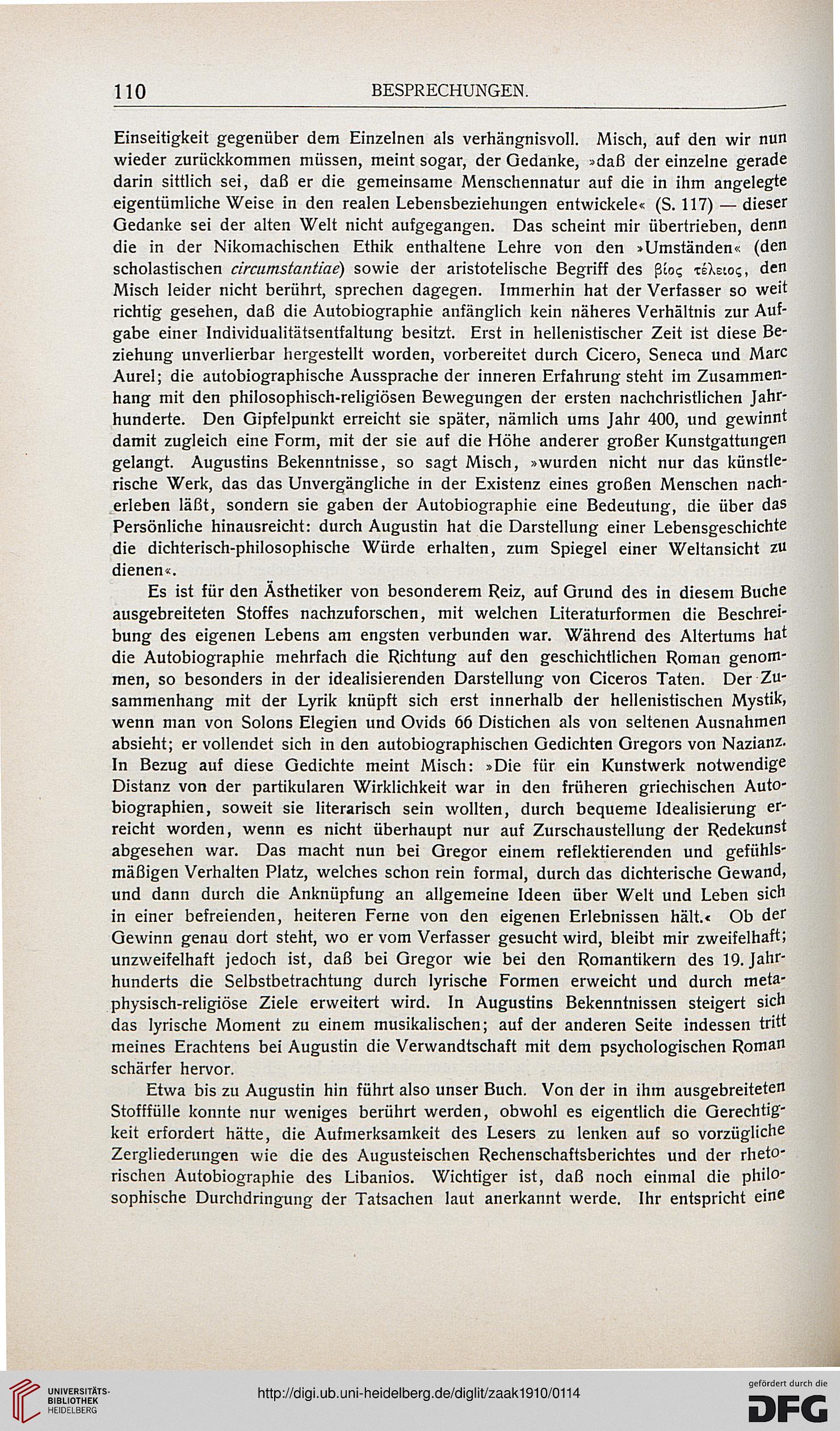110 BESPRECHUNGEN.
Einseitigkeit gegenüber dem Einzelnen als verhängnisvoll. Misch, auf den wir nun
wieder zurückkommen müssen, meint sogar, der Gedanke, »daß der einzelne gerade
darin sittlich sei, daß er die gemeinsame Menschennatur auf die in ihm angelegte
eigentümliche Weise in den realen Lebensbeziehungen entwickele« (S. 117) — dieser
Gedanke sei der alten Welt nicht aufgegangen. Das scheint mir übertrieben, denn
die in der Nikomachischen Ethik enthaltene Lehre von den »Umständen« (den
scholastischen circumstantiae) sowie der aristotelische Begriff des ßco? ikXsxoc,, den
Misch leider nicht berührt, sprechen dagegen. Immerhin hat der Verfasser so weit
richtig gesehen, daß die Autobiographie anfänglich kein näheres Verhältnis zur Auf-
gabe einer Individualitätsentfaltung besitzt. Erst in hellenistischer Zeit ist diese Be-
ziehung unverlierbar hergestellt worden, vorbereitet durch Cicero, Seneca und Marc
Aurel; die autobiographische Aussprache der inneren Erfahrung steht im Zusammen-
hang mit den philosophisch-religiösen Bewegungen der ersten nachchristlichen Jahr-
hunderte. Den Gipfelpunkt erreicht sie später, nämlich ums Jahr 400, und gewinnt
damit zugleich eine Form, mit der sie auf die Höhe anderer großer Kunstgattungen
gelangt. Augustins Bekenntnisse, so sagt Misch, »wurden nicht nur das künstle-
rische Werk, das das Unvergängliche in der Existenz eines großen Menschen nach-
erleben läßt, sondern sie gaben der Autobiographie eine Bedeutung, die über das
Persönliche hinausreicht: durch Augustin hat die Darstellung einer Lebensgeschichte
die dichterisch-philosophische Würde erhalten, zum Spiegel einer Weltansicht zu
dienen«.
Es ist für den Ästhetiker von besonderem Reiz, auf Grund des in diesem Buche
ausgebreiteten Stoffes nachzuforschen, mit welchen Literaturformen die Beschrei-
bung des eigenen Lebens am engsten verbunden war. Während des Altertums hat
die Autobiographie mehrfach die Richtung auf den geschichtlichen Roman genom-
men, so besonders in der idealisierenden Darstellung von Ciceros Taten. Der Zu-
sammenhang mit der Lyrik knüpft sich erst innerhalb der hellenistischen Mystik,
wenn man von Solons Elegien und Ovids 66 Distichen als von seltenen Ausnahmen
absieht; er vollendet sich in den autobiographischen Gedichten Gregors von Nazianz.
In Bezug auf diese Gedichte meint Misch: »Die für ein Kunstwerk notwendige
Distanz von der partikularen Wirklichkeit war in den früheren griechischen Auto-
biographien, soweit sie literarisch sein wollten, durch bequeme Idealisierung er-
reicht worden, wenn es nicht überhaupt nur auf Zurschaustellung der Redekunst
abgesehen war. Das macht nun bei Gregor einem reflektierenden und gefühls-
mäßigen Verhalten Platz, welches schon rein formal, durch das dichterische Gewand,
und dann durch die Anknüpfung an allgemeine Ideen über Welt und Leben sich
in einer befreienden, heiteren Ferne von den eigenen Erlebnissen hält.« Ob der
Gewinn genau dort steht, wo er vom Verfasser gesucht wird, bleibt mir zweifelhaft;
unzweifelhaft jedoch ist, daß bei Gregor wie bei den Romantikern des 19. Jahr-
hunderts die Selbstbetrachtung durch lyrische Formen erweicht und durch meta-
physisch-religiöse Ziele erweitert wird. In Augustins Bekenntnissen steigert sich
das lyrische Moment zu einem musikalischen; auf der anderen Seite indessen tritt
meines Erachtens bei Augustin die Verwandtschaft mit dem psychologischen Roman
schärfer hervor.
Etwa bis zu Augustin hin führt also unser Buch. Von der in ihm ausgebreiteten
Stofffülle konnte nur weniges berührt werden, obwohl es eigentlich die Gerechtig-
keit erfordert hätte, die Aufmerksamkeit des Lesers zu lenken auf so vorzügliche
Zergliederungen wie die des Augusteischen Rechenschaftsberichtes und der rheto-
rischen Autobiographie des Libanios. Wichtiger ist, daß noch einmal die philo-
sophische Durchdringung der Tatsachen laut anerkannt werde. Ihr entspricht eine
Einseitigkeit gegenüber dem Einzelnen als verhängnisvoll. Misch, auf den wir nun
wieder zurückkommen müssen, meint sogar, der Gedanke, »daß der einzelne gerade
darin sittlich sei, daß er die gemeinsame Menschennatur auf die in ihm angelegte
eigentümliche Weise in den realen Lebensbeziehungen entwickele« (S. 117) — dieser
Gedanke sei der alten Welt nicht aufgegangen. Das scheint mir übertrieben, denn
die in der Nikomachischen Ethik enthaltene Lehre von den »Umständen« (den
scholastischen circumstantiae) sowie der aristotelische Begriff des ßco? ikXsxoc,, den
Misch leider nicht berührt, sprechen dagegen. Immerhin hat der Verfasser so weit
richtig gesehen, daß die Autobiographie anfänglich kein näheres Verhältnis zur Auf-
gabe einer Individualitätsentfaltung besitzt. Erst in hellenistischer Zeit ist diese Be-
ziehung unverlierbar hergestellt worden, vorbereitet durch Cicero, Seneca und Marc
Aurel; die autobiographische Aussprache der inneren Erfahrung steht im Zusammen-
hang mit den philosophisch-religiösen Bewegungen der ersten nachchristlichen Jahr-
hunderte. Den Gipfelpunkt erreicht sie später, nämlich ums Jahr 400, und gewinnt
damit zugleich eine Form, mit der sie auf die Höhe anderer großer Kunstgattungen
gelangt. Augustins Bekenntnisse, so sagt Misch, »wurden nicht nur das künstle-
rische Werk, das das Unvergängliche in der Existenz eines großen Menschen nach-
erleben läßt, sondern sie gaben der Autobiographie eine Bedeutung, die über das
Persönliche hinausreicht: durch Augustin hat die Darstellung einer Lebensgeschichte
die dichterisch-philosophische Würde erhalten, zum Spiegel einer Weltansicht zu
dienen«.
Es ist für den Ästhetiker von besonderem Reiz, auf Grund des in diesem Buche
ausgebreiteten Stoffes nachzuforschen, mit welchen Literaturformen die Beschrei-
bung des eigenen Lebens am engsten verbunden war. Während des Altertums hat
die Autobiographie mehrfach die Richtung auf den geschichtlichen Roman genom-
men, so besonders in der idealisierenden Darstellung von Ciceros Taten. Der Zu-
sammenhang mit der Lyrik knüpft sich erst innerhalb der hellenistischen Mystik,
wenn man von Solons Elegien und Ovids 66 Distichen als von seltenen Ausnahmen
absieht; er vollendet sich in den autobiographischen Gedichten Gregors von Nazianz.
In Bezug auf diese Gedichte meint Misch: »Die für ein Kunstwerk notwendige
Distanz von der partikularen Wirklichkeit war in den früheren griechischen Auto-
biographien, soweit sie literarisch sein wollten, durch bequeme Idealisierung er-
reicht worden, wenn es nicht überhaupt nur auf Zurschaustellung der Redekunst
abgesehen war. Das macht nun bei Gregor einem reflektierenden und gefühls-
mäßigen Verhalten Platz, welches schon rein formal, durch das dichterische Gewand,
und dann durch die Anknüpfung an allgemeine Ideen über Welt und Leben sich
in einer befreienden, heiteren Ferne von den eigenen Erlebnissen hält.« Ob der
Gewinn genau dort steht, wo er vom Verfasser gesucht wird, bleibt mir zweifelhaft;
unzweifelhaft jedoch ist, daß bei Gregor wie bei den Romantikern des 19. Jahr-
hunderts die Selbstbetrachtung durch lyrische Formen erweicht und durch meta-
physisch-religiöse Ziele erweitert wird. In Augustins Bekenntnissen steigert sich
das lyrische Moment zu einem musikalischen; auf der anderen Seite indessen tritt
meines Erachtens bei Augustin die Verwandtschaft mit dem psychologischen Roman
schärfer hervor.
Etwa bis zu Augustin hin führt also unser Buch. Von der in ihm ausgebreiteten
Stofffülle konnte nur weniges berührt werden, obwohl es eigentlich die Gerechtig-
keit erfordert hätte, die Aufmerksamkeit des Lesers zu lenken auf so vorzügliche
Zergliederungen wie die des Augusteischen Rechenschaftsberichtes und der rheto-
rischen Autobiographie des Libanios. Wichtiger ist, daß noch einmal die philo-
sophische Durchdringung der Tatsachen laut anerkannt werde. Ihr entspricht eine