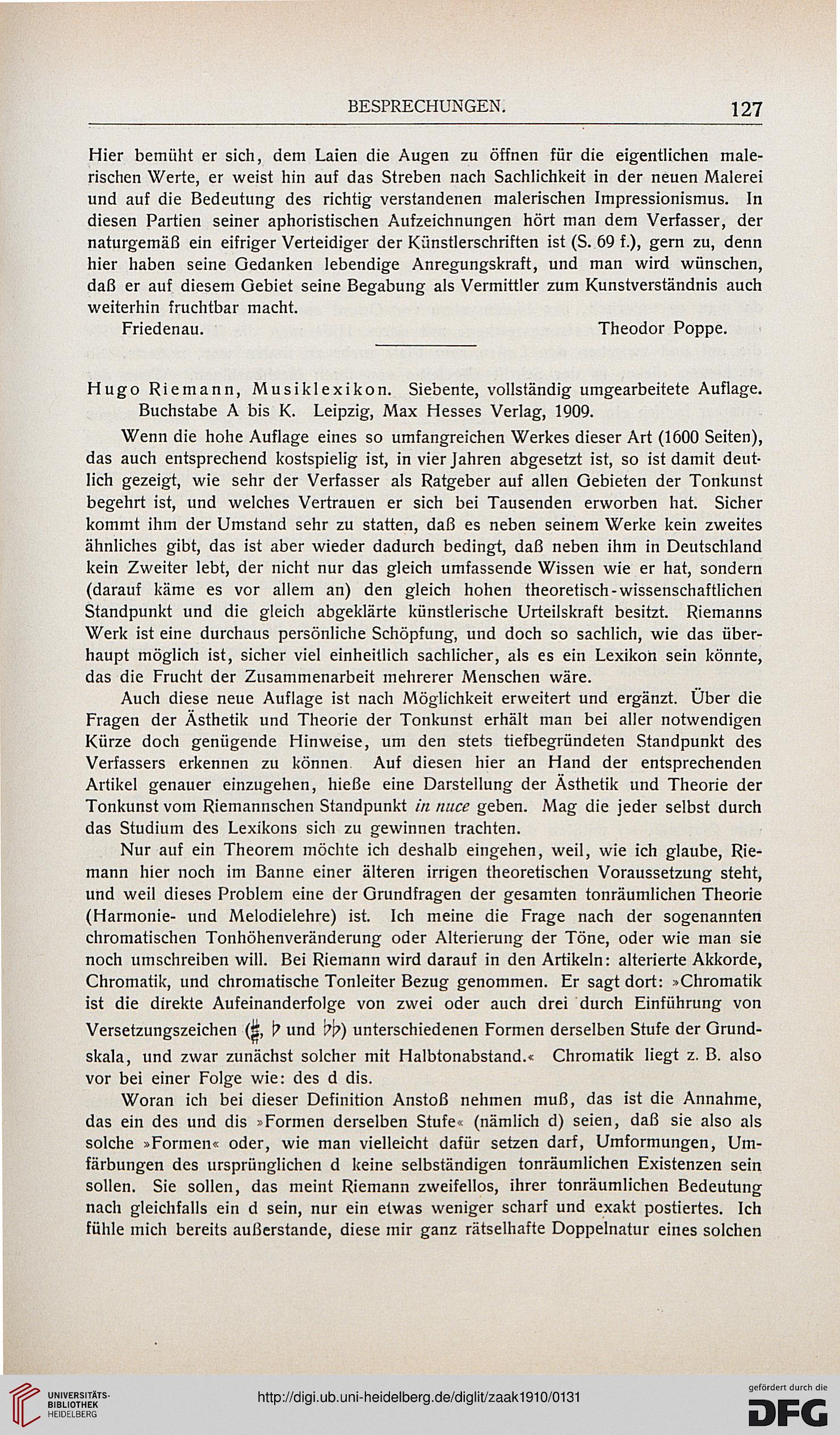BESPRECHUNGEN. ]27
Hier bemüht er sich, dem Laien die Augen zu öffnen für die eigentlichen male-
rischen Werte, er weist hin auf das Streben nach Sachlichkeit in der neuen Malerei
und auf die Bedeutung des richtig verstandenen malerischen Impressionismus. In
diesen Partien seiner aphoristischen Aufzeichnungen hört man dem Verfasser, der
naturgemäß ein eifriger Verteidiger der Künstlerschriften ist (S. 69 f.), gern zu, denn
hier haben seine Gedanken lebendige Anregungskraft, und man wird wünschen,
daß er auf diesem Gebiet seine Begabung als Vermittler zum Kunstverständnis auch
weiterhin fruchtbar macht.
Friedenau. Theodor Poppe.
Hugo Riemann, Musiklexikon. Siebente, vollständig umgearbeitete Auflage.
Buchstabe A bis K. Leipzig, Max Hesses Verlag, 1909.
Wenn die hohe Auflage eines so umfangreichen Werkes dieser Art (1600 Seiten),
das auch entsprechend kostspielig ist, in vier Jahren abgesetzt ist, so ist damit deut-
lich gezeigt, wie sehr der Verfasser als Ratgeber auf allen Gebieten der Tonkunst
begehrt ist, und welches Vertrauen er sich bei Tausenden erworben hat. Sicher
kommt ihm der Umstand sehr zu statten, daß es neben seinem Werke kein zweites
ähnliches gibt, das ist aber wieder dadurch bedingt, daß neben ihm in Deutschland
kein Zweiter lebt, der nicht nur das gleich umfassende Wissen wie er hat, sondern
(darauf käme es vor allem an) den gleich hohen theoretisch-wissenschaftlichen
Standpunkt und die gleich abgeklärte künstlerische Urteilskraft besitzt. Riemanns
Werk ist eine durchaus persönliche Schöpfung, und doch so sachlich, wie das über-
haupt möglich ist, sicher viel einheitlich sachlicher, als es ein Lexikon sein könnte,
das die Frucht der Zusammenarbeit mehrerer Menschen wäre.
Auch diese neue Auflage ist nach Möglichkeit erweitert und ergänzt. Über die
Fragen der Ästhetik und Theorie der Tonkunst erhält man bei aller notwendigen
Kürze doch genügende Hinweise, um den stets tiefbegründeten Standpunkt des
Verfassers erkennen zu können Auf diesen hier an Hand der entsprechenden
Artikel genauer einzugehen, hieße eine Darstellung der Ästhetik und Theorie der
Tonkunst vom Riemannschen Standpunkt in nuce geben. Mag die jeder selbst durch
das Studium des Lexikons sich zu gewinnen trachten.
Nur auf ein Theorem möchte ich deshalb eingehen, weil, wie ich glaube, Rie-
mann hier noch im Banne einer älteren irrigen theoretischen Voraussetzung steht,
und weil dieses Problem eine der Grundfragen der gesamten tonräumlichen Theorie
(Harmonie- und Melodielehre) ist. Ich meine die Frage nach der sogenannten
chromatischen Tonhöhenveränderung oder Alterierung der Töne, oder wie man sie
noch umschreiben will. Bei Riemann wird darauf in den Artikeln: alterierte Akkorde,
Chromatik, und chromatische Tonleiter Bezug genommen. Er sagt dort: »Chromatik
ist die direkte Aufeinanderfolge von zwei oder auch drei durch Einführung von
Versetzungszeichen (i, \> und ?i?) unterschiedenen Formen derselben Stufe der Grund-
skala, und zwar zunächst solcher mit Halbtonabstand.« Chromatik liegt z. B. also
vor bei einer Folge wie: des d dis.
Woran ich bei dieser Definition Anstoß nehmen muß, das ist die Annahme,
das ein des und dis »Formen derselben Stufe« (nämlich d) seien, daß sie also als
solche »Formen« oder, wie man vielleicht dafür setzen darf, Umformungen, Um-
färbungen des ursprünglichen d keine selbständigen tonräumlichen Existenzen sein
sollen. Sie sollen, das meint Riemann zweifellos, ihrer tonräumlichen Bedeutung
nach gleichfalls ein d sein, nur ein etwas weniger scharf und exakt postiertes. Ich
fühle mich bereits außerstande, diese mir ganz rätselhafte Doppelnatur eines solchen
Hier bemüht er sich, dem Laien die Augen zu öffnen für die eigentlichen male-
rischen Werte, er weist hin auf das Streben nach Sachlichkeit in der neuen Malerei
und auf die Bedeutung des richtig verstandenen malerischen Impressionismus. In
diesen Partien seiner aphoristischen Aufzeichnungen hört man dem Verfasser, der
naturgemäß ein eifriger Verteidiger der Künstlerschriften ist (S. 69 f.), gern zu, denn
hier haben seine Gedanken lebendige Anregungskraft, und man wird wünschen,
daß er auf diesem Gebiet seine Begabung als Vermittler zum Kunstverständnis auch
weiterhin fruchtbar macht.
Friedenau. Theodor Poppe.
Hugo Riemann, Musiklexikon. Siebente, vollständig umgearbeitete Auflage.
Buchstabe A bis K. Leipzig, Max Hesses Verlag, 1909.
Wenn die hohe Auflage eines so umfangreichen Werkes dieser Art (1600 Seiten),
das auch entsprechend kostspielig ist, in vier Jahren abgesetzt ist, so ist damit deut-
lich gezeigt, wie sehr der Verfasser als Ratgeber auf allen Gebieten der Tonkunst
begehrt ist, und welches Vertrauen er sich bei Tausenden erworben hat. Sicher
kommt ihm der Umstand sehr zu statten, daß es neben seinem Werke kein zweites
ähnliches gibt, das ist aber wieder dadurch bedingt, daß neben ihm in Deutschland
kein Zweiter lebt, der nicht nur das gleich umfassende Wissen wie er hat, sondern
(darauf käme es vor allem an) den gleich hohen theoretisch-wissenschaftlichen
Standpunkt und die gleich abgeklärte künstlerische Urteilskraft besitzt. Riemanns
Werk ist eine durchaus persönliche Schöpfung, und doch so sachlich, wie das über-
haupt möglich ist, sicher viel einheitlich sachlicher, als es ein Lexikon sein könnte,
das die Frucht der Zusammenarbeit mehrerer Menschen wäre.
Auch diese neue Auflage ist nach Möglichkeit erweitert und ergänzt. Über die
Fragen der Ästhetik und Theorie der Tonkunst erhält man bei aller notwendigen
Kürze doch genügende Hinweise, um den stets tiefbegründeten Standpunkt des
Verfassers erkennen zu können Auf diesen hier an Hand der entsprechenden
Artikel genauer einzugehen, hieße eine Darstellung der Ästhetik und Theorie der
Tonkunst vom Riemannschen Standpunkt in nuce geben. Mag die jeder selbst durch
das Studium des Lexikons sich zu gewinnen trachten.
Nur auf ein Theorem möchte ich deshalb eingehen, weil, wie ich glaube, Rie-
mann hier noch im Banne einer älteren irrigen theoretischen Voraussetzung steht,
und weil dieses Problem eine der Grundfragen der gesamten tonräumlichen Theorie
(Harmonie- und Melodielehre) ist. Ich meine die Frage nach der sogenannten
chromatischen Tonhöhenveränderung oder Alterierung der Töne, oder wie man sie
noch umschreiben will. Bei Riemann wird darauf in den Artikeln: alterierte Akkorde,
Chromatik, und chromatische Tonleiter Bezug genommen. Er sagt dort: »Chromatik
ist die direkte Aufeinanderfolge von zwei oder auch drei durch Einführung von
Versetzungszeichen (i, \> und ?i?) unterschiedenen Formen derselben Stufe der Grund-
skala, und zwar zunächst solcher mit Halbtonabstand.« Chromatik liegt z. B. also
vor bei einer Folge wie: des d dis.
Woran ich bei dieser Definition Anstoß nehmen muß, das ist die Annahme,
das ein des und dis »Formen derselben Stufe« (nämlich d) seien, daß sie also als
solche »Formen« oder, wie man vielleicht dafür setzen darf, Umformungen, Um-
färbungen des ursprünglichen d keine selbständigen tonräumlichen Existenzen sein
sollen. Sie sollen, das meint Riemann zweifellos, ihrer tonräumlichen Bedeutung
nach gleichfalls ein d sein, nur ein etwas weniger scharf und exakt postiertes. Ich
fühle mich bereits außerstande, diese mir ganz rätselhafte Doppelnatur eines solchen