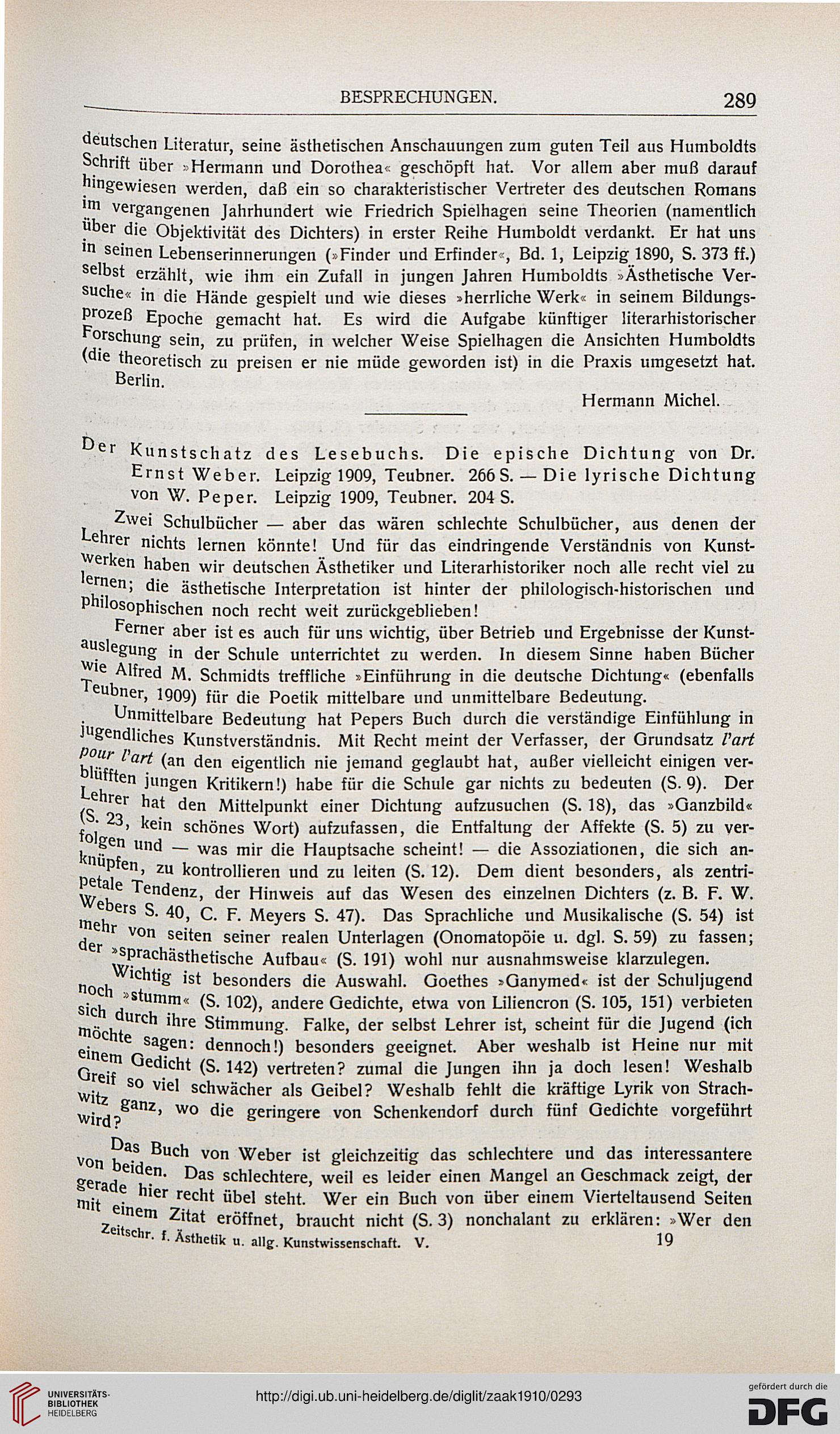BESPRECHUNGEN. 280
deutschen Literatur, seine ästhetischen Anschauungen zum guten Teil aus Humboldts
Schrift über Hermann und Dorothea« geschöpft hat. Vor allem aber muß darauf
Hingewiesen werden, daß ein so charakteristischer Vertreter des deutschen Romans
!m vergangenen Jahrhundert wie Friedrich Spielhagen seine Theorien (namentlich
über die Objektivität des Dichters) in erster Reihe Humboldt verdankt. Er hat uns
In seinen Lebenserinnerungen (»Finder und Erfinder=, Bd. 1, Leipzig 1890, S. 373 ff.)
selbst erzählt, wie ihm ein Zufall in jungen Jahren Humboldts »Ästhetische Ver-
suche« in die Hände gespielt und wie dieses »herrliche Werk« in seinem Bildungs-
prozeß Epoche gemacht hat. Es wird die Aufgabe künftiger literarhistorischer
orschung sein, zu prüfen, in welcher Weise Spielhagen die Ansichten Humboldts
(die theoretisch zu preisen er nie müde geworden ist) in die Praxis umgesetzt hat.
Berlin.
Hermann Michel.
er Kunstschatz des Lesebuchs. Die epische Dichtung von Dr.
Ernst Weber. Leipzig 1909, Teubner. 266S. — Die lyrische Dichtung
von W. Peper. Leipzig 1909, Teubner. 204 S.
Zwei Schulbücher — aber das wären schlechte Schulbücher, aus denen der
nrer nichts lernen könnte! Und für das eindringende Verständnis von Kunst-
rken haben wir deutschen Ästhetiker und Literarhistoriker noch alle recht viel zu
nen; die ästhetische Interpretation ist hinter der philologisch-historischen und
Philosophischen noch recht weit zurückgeblieben!
ferner aber ist es auch für uns wichtig, über Betrieb und Ergebnisse der Kunst-
egung in der Schule unterrichtet zu werden. In diesem Sinne haben Bücher
Alfred M. Schmidts treffliche »Einführung in die deutsche Dichtung« (ebenfalls
ei>bner, 1909) für die Poetik mittelbare und unmittelbare Bedeutung.
Unmittelbare Bedeutung hat Pepers Buch durch die verständige Einfühlung in
Sendüches Kunstverständnis. Mit Recht meint der Verfasser, der Grundsatz Vart
.. ' art (an den eigentlich nie jemand geglaubt hat, außer vielleicht einigen ver-
Unten jungen Kritikern!) habe für die Schule gar nichts zu bedeuten (S. 9). Der
rer hat den Mittelpunkt einer Dichtung aufzusuchen (S. 18), das »Ganzbild«
• J. kein schönes Wort) aufzufassen, die Entfaltung der Affekte (S. 5) zu ver-
S n und — was mir die Hauptsache scheint! — die Assoziationen, die sich an-
Pen, zu kontrollieren und zu leiten (S. 12). Dem dient besonders, als zentri-
W h& enz> der Hinweis auf das Wesen des einzelnen Dichters (z. B. F. W.
inet S' 40' C> F- Meyers S. 47). Das Sprachliche und Musikalische (S. 54) ist
von Seiten seiner realen Unterlagen (Onomatopöie u. dgl. S. 59) zu fassen;
* Prachästhetische Aufbau« (S. 191) wohl nur ausnahmsweise klarzulegen.
nocl '£ ist besonders die Auswahl. Goethes »Ganymed« ist der Schuljugend
sicl/d StUmm< ^S' 102^' andere °edichte» etwa v°n Liliencron (S. 105, 151) verbieten
mö hfUrCtl ''lre stimmung- Falke, der selbst Lehrer ist, scheint für die Jugend (ich
ein C Sagen: dennoch!) besonders geeignet. Aber weshalb ist Heine nur mit
Q .!? Qed'cht (S. 142) vertreten? zumal die Jungen ihn ja doch lesen! Weshalb
n so viel schwächer als Geibel? Weshalb fehlt die kräftige Lyrik von Strach-
wird?ganZ' W° d'e Seringere von Schenkendorf durch fünf Gedichte vorgeführt
von h&* Bucl1 Von Weber ist gleichzeitig das schlechtere und das interessantere
„e , _n- Das schlechtere, weil es leider einen Mangel an Geschmack zeigt, der
mit ^ recllt übel steht- Wer ein Buch von "ber einem Vierteltausend Seiten
^einem Zitat eröffnet, braucht nicht (S. 3) nonchalant zu erklären: »Wer den
eits<*r. f Ästhetik u. allE. Kunstwissenschaft. V. 19
deutschen Literatur, seine ästhetischen Anschauungen zum guten Teil aus Humboldts
Schrift über Hermann und Dorothea« geschöpft hat. Vor allem aber muß darauf
Hingewiesen werden, daß ein so charakteristischer Vertreter des deutschen Romans
!m vergangenen Jahrhundert wie Friedrich Spielhagen seine Theorien (namentlich
über die Objektivität des Dichters) in erster Reihe Humboldt verdankt. Er hat uns
In seinen Lebenserinnerungen (»Finder und Erfinder=, Bd. 1, Leipzig 1890, S. 373 ff.)
selbst erzählt, wie ihm ein Zufall in jungen Jahren Humboldts »Ästhetische Ver-
suche« in die Hände gespielt und wie dieses »herrliche Werk« in seinem Bildungs-
prozeß Epoche gemacht hat. Es wird die Aufgabe künftiger literarhistorischer
orschung sein, zu prüfen, in welcher Weise Spielhagen die Ansichten Humboldts
(die theoretisch zu preisen er nie müde geworden ist) in die Praxis umgesetzt hat.
Berlin.
Hermann Michel.
er Kunstschatz des Lesebuchs. Die epische Dichtung von Dr.
Ernst Weber. Leipzig 1909, Teubner. 266S. — Die lyrische Dichtung
von W. Peper. Leipzig 1909, Teubner. 204 S.
Zwei Schulbücher — aber das wären schlechte Schulbücher, aus denen der
nrer nichts lernen könnte! Und für das eindringende Verständnis von Kunst-
rken haben wir deutschen Ästhetiker und Literarhistoriker noch alle recht viel zu
nen; die ästhetische Interpretation ist hinter der philologisch-historischen und
Philosophischen noch recht weit zurückgeblieben!
ferner aber ist es auch für uns wichtig, über Betrieb und Ergebnisse der Kunst-
egung in der Schule unterrichtet zu werden. In diesem Sinne haben Bücher
Alfred M. Schmidts treffliche »Einführung in die deutsche Dichtung« (ebenfalls
ei>bner, 1909) für die Poetik mittelbare und unmittelbare Bedeutung.
Unmittelbare Bedeutung hat Pepers Buch durch die verständige Einfühlung in
Sendüches Kunstverständnis. Mit Recht meint der Verfasser, der Grundsatz Vart
.. ' art (an den eigentlich nie jemand geglaubt hat, außer vielleicht einigen ver-
Unten jungen Kritikern!) habe für die Schule gar nichts zu bedeuten (S. 9). Der
rer hat den Mittelpunkt einer Dichtung aufzusuchen (S. 18), das »Ganzbild«
• J. kein schönes Wort) aufzufassen, die Entfaltung der Affekte (S. 5) zu ver-
S n und — was mir die Hauptsache scheint! — die Assoziationen, die sich an-
Pen, zu kontrollieren und zu leiten (S. 12). Dem dient besonders, als zentri-
W h& enz> der Hinweis auf das Wesen des einzelnen Dichters (z. B. F. W.
inet S' 40' C> F- Meyers S. 47). Das Sprachliche und Musikalische (S. 54) ist
von Seiten seiner realen Unterlagen (Onomatopöie u. dgl. S. 59) zu fassen;
* Prachästhetische Aufbau« (S. 191) wohl nur ausnahmsweise klarzulegen.
nocl '£ ist besonders die Auswahl. Goethes »Ganymed« ist der Schuljugend
sicl/d StUmm< ^S' 102^' andere °edichte» etwa v°n Liliencron (S. 105, 151) verbieten
mö hfUrCtl ''lre stimmung- Falke, der selbst Lehrer ist, scheint für die Jugend (ich
ein C Sagen: dennoch!) besonders geeignet. Aber weshalb ist Heine nur mit
Q .!? Qed'cht (S. 142) vertreten? zumal die Jungen ihn ja doch lesen! Weshalb
n so viel schwächer als Geibel? Weshalb fehlt die kräftige Lyrik von Strach-
wird?ganZ' W° d'e Seringere von Schenkendorf durch fünf Gedichte vorgeführt
von h&* Bucl1 Von Weber ist gleichzeitig das schlechtere und das interessantere
„e , _n- Das schlechtere, weil es leider einen Mangel an Geschmack zeigt, der
mit ^ recllt übel steht- Wer ein Buch von "ber einem Vierteltausend Seiten
^einem Zitat eröffnet, braucht nicht (S. 3) nonchalant zu erklären: »Wer den
eits<*r. f Ästhetik u. allE. Kunstwissenschaft. V. 19