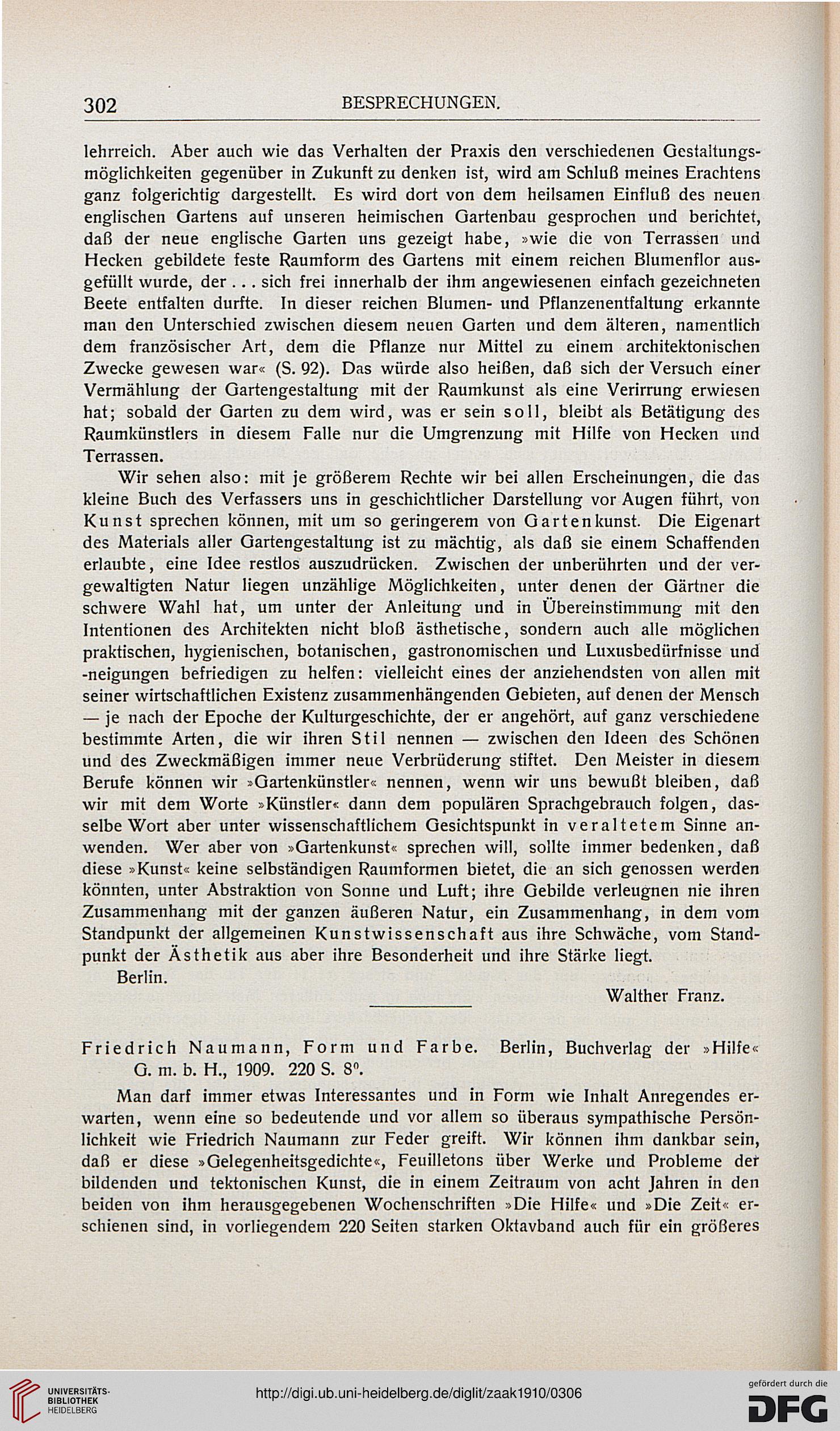302 BESPRECHUNGEN.
lehrreich. Aber auch wie das Verhalten der Praxis den verschiedenen Gestaltungs-
möglichkeiten gegenüber in Zukunft zu denken ist, wird am Schluß meines Erachtens
ganz folgerichtig dargestellt. Es wird dort von dem heilsamen Einfluß des neuen
englischen Gartens auf unseren heimischen Gartenbau gesprochen und berichtet,
daß der neue englische Garten uns gezeigt habe, »wie die von Terrassen und
Hecken gebildete feste Raumform des Gartens mit einem reichen Blumenflor aus-
gefüllt wurde, der . . . sich frei innerhalb der ihm angewiesenen einfach gezeichneten
Beete entfalten durfte. In dieser reichen Blumen- und Pflanzenentfaltung erkannte
mau den Unterschied zwischen diesem neuen Garten und dem älteren, namentlich
dem französischer Art, dem die Pflanze nur Mittel zu einem architektonischen
Zwecke gewesen war« (S. 92). Das würde also heißen, daß sich der Versuch einer
Vermählung der Gartengestaltung mit der Raumkunst als eine Verirrung erwiesen
hat; sobald der Garten zu dem wird, was er sein soll, bleibt als Betätigung des
Raumkünstlers in diesem Falle nur die Umgrenzung mit Hilfe von Hecken und
Terrassen.
Wir sehen also: mit je größerem Rechte wir bei allen Erscheinungen, die das
kleine Buch des Verfassers uns in geschichtlicher Darstellung vor Augen führt, von
Kunst sprechen können, mit um so geringerem von Gartenkunst. Die Eigenart
des Materials aller Gartengestaltung ist zu mächtig, als daß sie einem Schaffenden
erlaubte, eine Idee restlos auszudrücken. Zwischen der unberührten und der ver-
gewaltigten Natur liegen unzählige Möglichkeiten, unter denen der Gärtner die
schwere Wahl hat, um unter der Anleitung und in Übereinstimmung mit den
Intentionen des Architekten nicht bloß ästhetische, sondern auch alle möglichen
praktischen, hygienischen, botanischen, gastronomischen und Luxusbedürfnisse und
-neigungen befriedigen zu helfen: vielleicht eines der anziehendsten von allen mit
seiner wirtschaftlichen Existenz zusammenhängenden Gebieten, auf denen der Mensch
— je nach der Epoche der Kulturgeschichte, der er angehört, auf ganz verschiedene
bestimmte Arten, die wir ihren Stil nennen — zwischen den Ideen des Schönen
und des Zweckmäßigen immer neue Verbrüderung stiftet. Den Meister in diesem
Berufe können wir »Gartenkünstler« nennen, wenn wir uns bewußt bleiben, daß
wir mit dem Worte »Künstler« dann dem populären Sprachgebrauch folgen, das-
selbe Wort aber unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt in veraltetem Sinne an-
wenden. Wer aber von »Gartenkunst' sprechen will, sollte immer bedenken, daß
diese »Kunst« keine selbständigen Raumformen bietet, die an sich genossen werden
könnten, unter Abstraktion von Sonne und Luft; ihre Gebilde verleugnen nie ihren
Zusammenhang mit der ganzen äußeren Natur, ein Zusammenhang, in dem vom
Standpunkt der allgemeinen Kunstwissenschaft aus ihre Schwäche, vom Stand-
punkt der Ästhetik aus aber ihre Besonderheit und ihre Stärke liegt.
Berlin.
___________ Walther Franz.
Friedrich Naumann, Form und Farbe. Berlin, Buchverlag der »Hilfe«
G. m. b. H., 1909. 220 S. 8°.
Man darf immer etwas Interessantes und in Form wie Inhalt Anregendes er-
warten, wenn eine so bedeutende und vor allem so überaus sympathische Persön-
lichkeit wie Friedrich Naumann zur Feder greift. Wir können ihm dankbar sein,
daß er diese »Gelegenheitsgedichte«, Feuilletons über Werke und Probleme der
bildenden und tektonischen Kunst, die in einem Zeitraum von acht Jahren in den
beiden von ihm herausgegebenen Wochenschriften »Die Hilfe« und »Die Zeit« er-
schienen sind, in vorliegendem 220 Seiten starken Oktavband auch für ein größeres
lehrreich. Aber auch wie das Verhalten der Praxis den verschiedenen Gestaltungs-
möglichkeiten gegenüber in Zukunft zu denken ist, wird am Schluß meines Erachtens
ganz folgerichtig dargestellt. Es wird dort von dem heilsamen Einfluß des neuen
englischen Gartens auf unseren heimischen Gartenbau gesprochen und berichtet,
daß der neue englische Garten uns gezeigt habe, »wie die von Terrassen und
Hecken gebildete feste Raumform des Gartens mit einem reichen Blumenflor aus-
gefüllt wurde, der . . . sich frei innerhalb der ihm angewiesenen einfach gezeichneten
Beete entfalten durfte. In dieser reichen Blumen- und Pflanzenentfaltung erkannte
mau den Unterschied zwischen diesem neuen Garten und dem älteren, namentlich
dem französischer Art, dem die Pflanze nur Mittel zu einem architektonischen
Zwecke gewesen war« (S. 92). Das würde also heißen, daß sich der Versuch einer
Vermählung der Gartengestaltung mit der Raumkunst als eine Verirrung erwiesen
hat; sobald der Garten zu dem wird, was er sein soll, bleibt als Betätigung des
Raumkünstlers in diesem Falle nur die Umgrenzung mit Hilfe von Hecken und
Terrassen.
Wir sehen also: mit je größerem Rechte wir bei allen Erscheinungen, die das
kleine Buch des Verfassers uns in geschichtlicher Darstellung vor Augen führt, von
Kunst sprechen können, mit um so geringerem von Gartenkunst. Die Eigenart
des Materials aller Gartengestaltung ist zu mächtig, als daß sie einem Schaffenden
erlaubte, eine Idee restlos auszudrücken. Zwischen der unberührten und der ver-
gewaltigten Natur liegen unzählige Möglichkeiten, unter denen der Gärtner die
schwere Wahl hat, um unter der Anleitung und in Übereinstimmung mit den
Intentionen des Architekten nicht bloß ästhetische, sondern auch alle möglichen
praktischen, hygienischen, botanischen, gastronomischen und Luxusbedürfnisse und
-neigungen befriedigen zu helfen: vielleicht eines der anziehendsten von allen mit
seiner wirtschaftlichen Existenz zusammenhängenden Gebieten, auf denen der Mensch
— je nach der Epoche der Kulturgeschichte, der er angehört, auf ganz verschiedene
bestimmte Arten, die wir ihren Stil nennen — zwischen den Ideen des Schönen
und des Zweckmäßigen immer neue Verbrüderung stiftet. Den Meister in diesem
Berufe können wir »Gartenkünstler« nennen, wenn wir uns bewußt bleiben, daß
wir mit dem Worte »Künstler« dann dem populären Sprachgebrauch folgen, das-
selbe Wort aber unter wissenschaftlichem Gesichtspunkt in veraltetem Sinne an-
wenden. Wer aber von »Gartenkunst' sprechen will, sollte immer bedenken, daß
diese »Kunst« keine selbständigen Raumformen bietet, die an sich genossen werden
könnten, unter Abstraktion von Sonne und Luft; ihre Gebilde verleugnen nie ihren
Zusammenhang mit der ganzen äußeren Natur, ein Zusammenhang, in dem vom
Standpunkt der allgemeinen Kunstwissenschaft aus ihre Schwäche, vom Stand-
punkt der Ästhetik aus aber ihre Besonderheit und ihre Stärke liegt.
Berlin.
___________ Walther Franz.
Friedrich Naumann, Form und Farbe. Berlin, Buchverlag der »Hilfe«
G. m. b. H., 1909. 220 S. 8°.
Man darf immer etwas Interessantes und in Form wie Inhalt Anregendes er-
warten, wenn eine so bedeutende und vor allem so überaus sympathische Persön-
lichkeit wie Friedrich Naumann zur Feder greift. Wir können ihm dankbar sein,
daß er diese »Gelegenheitsgedichte«, Feuilletons über Werke und Probleme der
bildenden und tektonischen Kunst, die in einem Zeitraum von acht Jahren in den
beiden von ihm herausgegebenen Wochenschriften »Die Hilfe« und »Die Zeit« er-
schienen sind, in vorliegendem 220 Seiten starken Oktavband auch für ein größeres