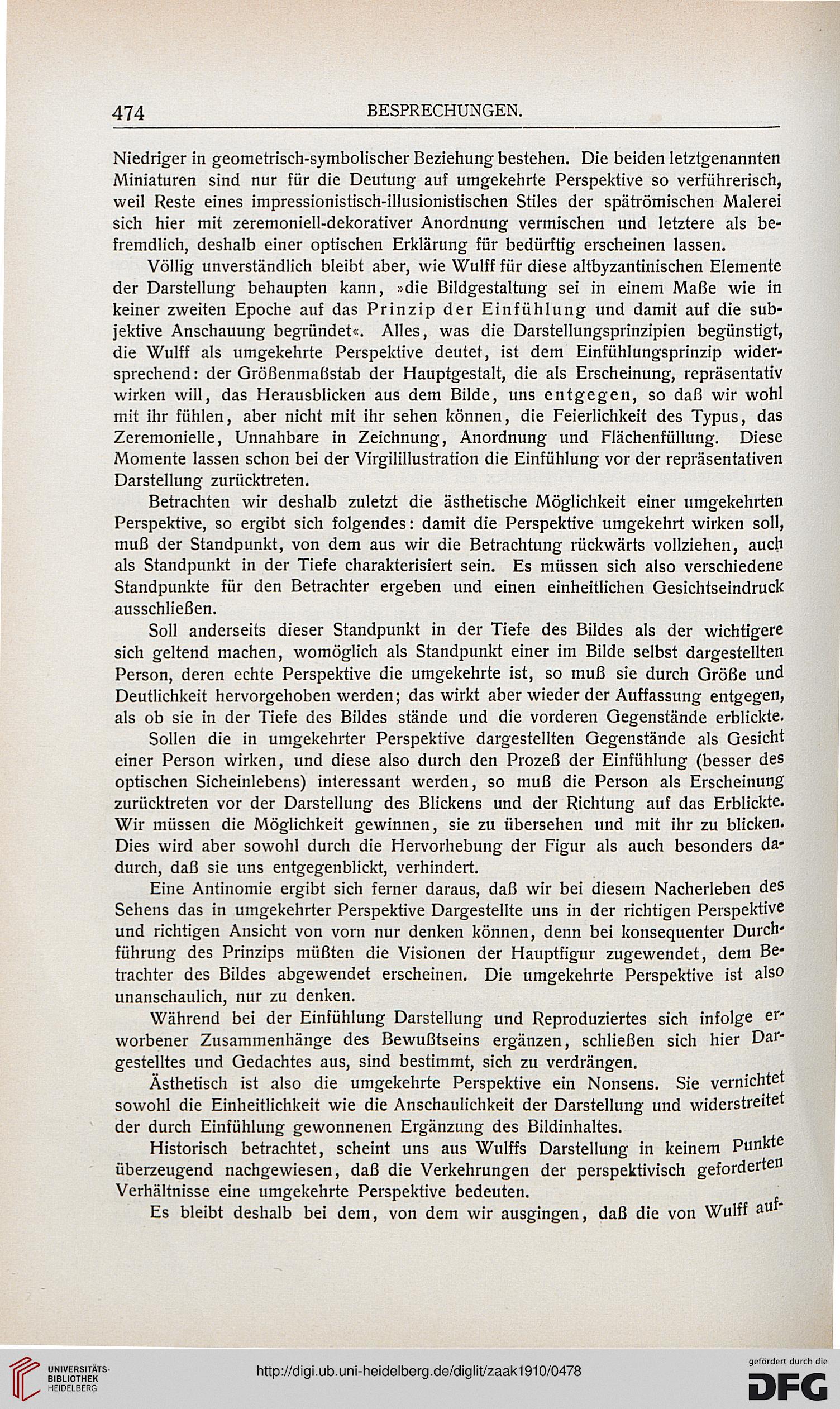474 BESPRECHUNGEN.
Niedriger in geometrisch-symbolischer Beziehung bestehen. Die beiden letztgenannten
Miniaturen sind nur für die Deutung auf umgekehrte Perspektive so verführerisch,
weil Reste eines impressionistisch-illusionistischen Stiles der spätrömischen Malerei
sich hier mit zeremoniell-dekorativer Anordnung vermischen und letztere als be-
fremdlich, deshalb einer optischen Erklärung für bedürftig erscheinen lassen.
Völlig unverständlich bleibt aber, wie Wulff für diese altbyzantinischen Elemente
der Darstellung behaupten kann, »die Bildgestaltung sei in einem Maße wie in
keiner zweiten Epoche auf das Prinzip der Einfühlung und damit auf die sub-
jektive Anschauung begründet«. Alles, was die Darstellungsprinzipien begünstigt,
die Wulff als umgekehrte Perspektive deutet, ist dem Einfühlungsprinzip wider-
sprechend: der Größenmaßstab der Hauptgestalt, die als Erscheinung, repräsentativ
wirken will, das Herausblicken aus dem Bilde, uns entgegen, so daß wir wohl
mit ihr fühlen, aber nicht mit ihr sehen können, die Feierlichkeit des Typus, das
Zeremonielle, Unnahbare in Zeichnung, Anordnung und Flächenfüllung. Diese
Momente lassen schon bei der Virgilillustration die Einfühlung vor der repräsentativen
Darstellung zurücktreten.
Betrachten wir deshalb zuletzt die ästhetische Möglichkeit einer umgekehrten
Perspektive, so ergibt sich folgendes: damit die Perspektive umgekehrt wirken soll,
muß der Standpunkt, von dem aus wir die Betrachtung rückwärts vollziehen, auch
als Standpunkt in der Tiefe charakterisiert sein. Es müssen sich also verschiedene
Standpunkte für den Betrachter ergeben und einen einheitlichen Gesichtseindruck
ausschließen.
Soll anderseits dieser Standpunkt in der Tiefe des Bildes als der wichtigere
sich geltend machen, womöglich als Standpunkt einer im Bilde selbst dargestellten
Person, deren echte Perspektive die umgekehrte ist, so muß sie durch Größe und
Deutlichkeit hervorgehoben werden; das wirkt aber wieder der Auffassung entgegen,
als ob sie in der Tiefe des Bildes stände und die vorderen Gegenstände erblickte.
Sollen die in umgekehrter Perspektive dargestellten Gegenstände als Gesicht
einer Person wirken, und diese also durch den Prozeß der Einfühlung (besser des
optischen Sicheinlebens) interessant werden, so muß die Person als Erscheinung
zurücktreten vor der Darstellung des Blickens und der Richtung auf das Erblickte.
Wir müssen die Möglichkeit gewinnen, sie zu übersehen und mit ihr zu blicken.
Dies wird aber sowohl durch die Hervorhebung der Figur als auch besonders da-
durch, daß sie uns entgegenblickt, verhindert.
Eine Antinomie ergibt sich ferner daraus, daß wir bei diesem Nacherleben des
Sehens das in umgekehrter Perspektive Dargestellte uns in der richtigen Perspektive
und richtigen Ansicht von vorn nur denken können, denn bei konsequenter Durch-
führung des Prinzips müßten die Visionen der Hauptfigur zugewendet, dem Be-
trachter des Bildes abgewendet erscheinen. Die umgekehrte Perspektive ist also
unanschaulich, nur zu denken.
Während bei der Einfühlung Darstellung und Reproduziertes sich infolge er-
worbener Zusammenhänge des Bewußtseins ergänzen, schließen sich hier Dar-
gestelltes und Gedachtes aus, sind bestimmt, sich zu verdrängen.
Ästhetisch ist also die umgekehrte Perspektive ein Nonsens. Sie vernichtet
sowohl die Einheitlichkeit wie die Anschaulichkeit der Darstellung und widerstreitet
der durch Einfühlung gewonnenen Ergänzung des Bildinhaltes.
Historisch betrachtet, scheint uns aus Wulffs Darstellung in keinem Punkte
überzeugend nachgewiesen, daß die Verkehrungen der perspektivisch geforderten
Verhältnisse eine umgekehrte Perspektive bedeuten.
Es bleibt deshalb bei dem, von dem wir ausgingen, daß die von Wulff au"
Niedriger in geometrisch-symbolischer Beziehung bestehen. Die beiden letztgenannten
Miniaturen sind nur für die Deutung auf umgekehrte Perspektive so verführerisch,
weil Reste eines impressionistisch-illusionistischen Stiles der spätrömischen Malerei
sich hier mit zeremoniell-dekorativer Anordnung vermischen und letztere als be-
fremdlich, deshalb einer optischen Erklärung für bedürftig erscheinen lassen.
Völlig unverständlich bleibt aber, wie Wulff für diese altbyzantinischen Elemente
der Darstellung behaupten kann, »die Bildgestaltung sei in einem Maße wie in
keiner zweiten Epoche auf das Prinzip der Einfühlung und damit auf die sub-
jektive Anschauung begründet«. Alles, was die Darstellungsprinzipien begünstigt,
die Wulff als umgekehrte Perspektive deutet, ist dem Einfühlungsprinzip wider-
sprechend: der Größenmaßstab der Hauptgestalt, die als Erscheinung, repräsentativ
wirken will, das Herausblicken aus dem Bilde, uns entgegen, so daß wir wohl
mit ihr fühlen, aber nicht mit ihr sehen können, die Feierlichkeit des Typus, das
Zeremonielle, Unnahbare in Zeichnung, Anordnung und Flächenfüllung. Diese
Momente lassen schon bei der Virgilillustration die Einfühlung vor der repräsentativen
Darstellung zurücktreten.
Betrachten wir deshalb zuletzt die ästhetische Möglichkeit einer umgekehrten
Perspektive, so ergibt sich folgendes: damit die Perspektive umgekehrt wirken soll,
muß der Standpunkt, von dem aus wir die Betrachtung rückwärts vollziehen, auch
als Standpunkt in der Tiefe charakterisiert sein. Es müssen sich also verschiedene
Standpunkte für den Betrachter ergeben und einen einheitlichen Gesichtseindruck
ausschließen.
Soll anderseits dieser Standpunkt in der Tiefe des Bildes als der wichtigere
sich geltend machen, womöglich als Standpunkt einer im Bilde selbst dargestellten
Person, deren echte Perspektive die umgekehrte ist, so muß sie durch Größe und
Deutlichkeit hervorgehoben werden; das wirkt aber wieder der Auffassung entgegen,
als ob sie in der Tiefe des Bildes stände und die vorderen Gegenstände erblickte.
Sollen die in umgekehrter Perspektive dargestellten Gegenstände als Gesicht
einer Person wirken, und diese also durch den Prozeß der Einfühlung (besser des
optischen Sicheinlebens) interessant werden, so muß die Person als Erscheinung
zurücktreten vor der Darstellung des Blickens und der Richtung auf das Erblickte.
Wir müssen die Möglichkeit gewinnen, sie zu übersehen und mit ihr zu blicken.
Dies wird aber sowohl durch die Hervorhebung der Figur als auch besonders da-
durch, daß sie uns entgegenblickt, verhindert.
Eine Antinomie ergibt sich ferner daraus, daß wir bei diesem Nacherleben des
Sehens das in umgekehrter Perspektive Dargestellte uns in der richtigen Perspektive
und richtigen Ansicht von vorn nur denken können, denn bei konsequenter Durch-
führung des Prinzips müßten die Visionen der Hauptfigur zugewendet, dem Be-
trachter des Bildes abgewendet erscheinen. Die umgekehrte Perspektive ist also
unanschaulich, nur zu denken.
Während bei der Einfühlung Darstellung und Reproduziertes sich infolge er-
worbener Zusammenhänge des Bewußtseins ergänzen, schließen sich hier Dar-
gestelltes und Gedachtes aus, sind bestimmt, sich zu verdrängen.
Ästhetisch ist also die umgekehrte Perspektive ein Nonsens. Sie vernichtet
sowohl die Einheitlichkeit wie die Anschaulichkeit der Darstellung und widerstreitet
der durch Einfühlung gewonnenen Ergänzung des Bildinhaltes.
Historisch betrachtet, scheint uns aus Wulffs Darstellung in keinem Punkte
überzeugend nachgewiesen, daß die Verkehrungen der perspektivisch geforderten
Verhältnisse eine umgekehrte Perspektive bedeuten.
Es bleibt deshalb bei dem, von dem wir ausgingen, daß die von Wulff au"