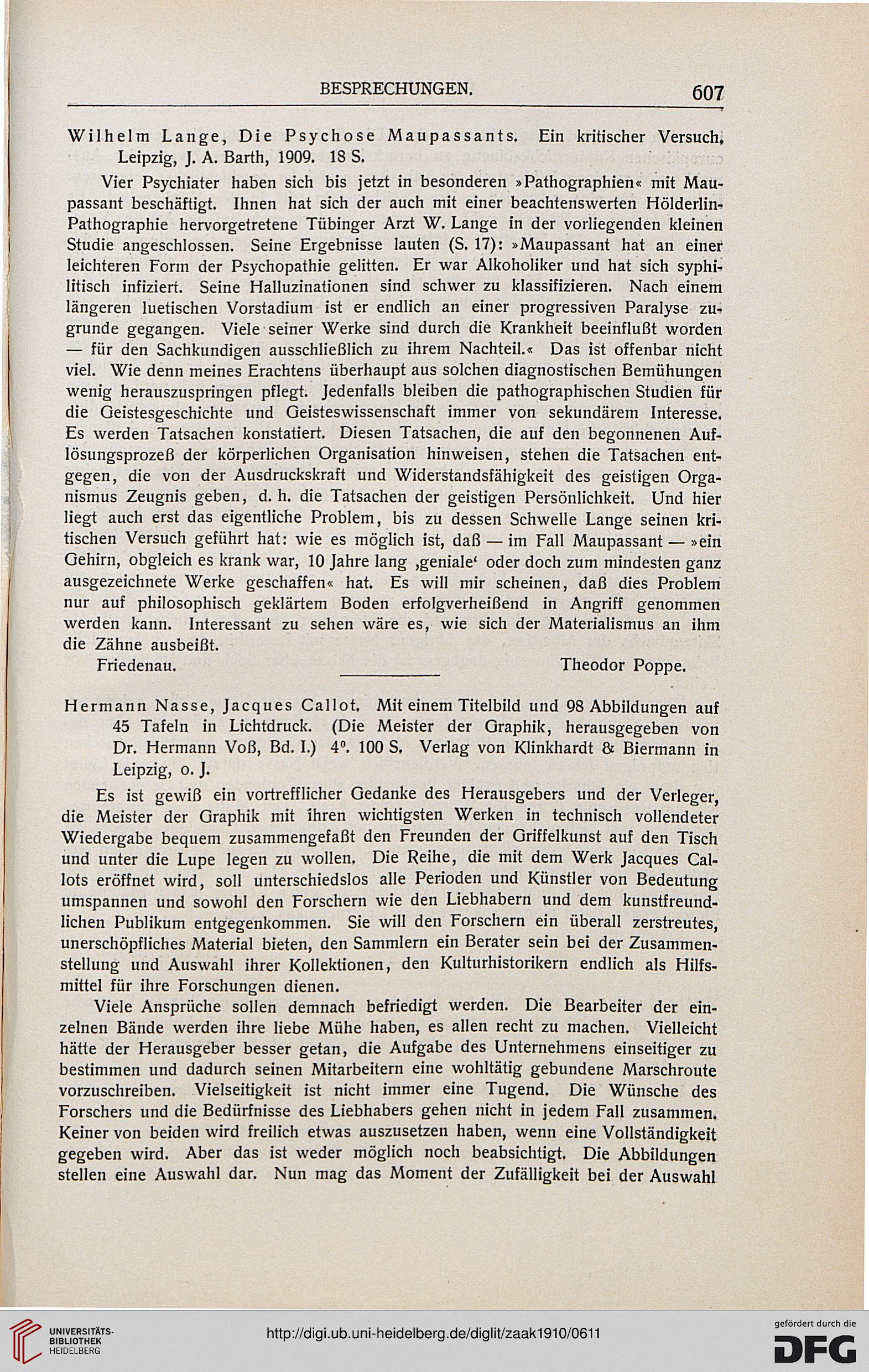BESPRECHUNGEN. 607
Wilhelm Lange, Die Psychose Maupassants. Ein kritischer Versuch,
Leipzig, J. A. Barth, 1909. 18 S.
Vier Psychiater haben sich bis jetzt in besonderen »Pathographien« mit Mau-
passant beschäftigt. Ihnen hat sich der auch mit einer beachtenswerten Hölderlin-
Pathographie hervorgetretene Tübinger Arzt W. Lange in der vorliegenden kleinen
Studie angeschlossen. Seine Ergebnisse lauten (S. 17): »Maupassant hat an einer
leichteren Form der Psychopathie gelitten. Er war Alkoholiker und hat sich syphi-
litisch infiziert. Seine Halluzinationen sind schwer zu klassifizieren. Nach einem
längeren luetischen Vorstadium ist er endlich an einer progressiven Paralyse zu-
grunde gegangen. Viele seiner Werke sind durch die Krankheit beeinflußt worden
— für den Sachkundigen ausschließlich zu ihrem Nachteil.« Das ist offenbar nicht
viel. Wie denn meines Erachtens überhaupt aus solchen diagnostischen Bemühungen
wenig herauszuspringen pflegt. Jedenfalls bleiben die pathographischen Studien für
die Geistesgeschichte und Geisteswissenschaft immer von sekundärem Interesse.
Es werden Tatsachen konstatiert. Diesen Tatsachen, die auf den begonnenen Auf-
lösungsprozeß der körperlichen Organisation hinweisen, stehen die Tatsachen ent-
gegen, die von der Ausdruckskraft und Widerstandsfähigkeit des geistigen Orga-
nismus Zeugnis geben, d.h. die Tatsachen der geistigen Persönlichkeit. Und hier
liegt auch erst das eigentliche Problem, bis zu dessen Schwelle Lange seinen kri-
tischen Versuch geführt hat: wie es möglich ist, daß — im Fall Maupassant — »ein
Gehirn, obgleich es krank war, 10 Jahre lang ,geniale' oder doch zum mindesten ganz
ausgezeichnete Werke geschaffen« hat. Es will mir scheinen, daß dies Problem
nur auf philosophisch geklärtem Boden erfolgverheißend in Angriff genommen
werden kann. Interessant zu sehen wäre es, wie sich der Materialismus an ihm
die Zähne ausbeißt.
Friedenau. ___________ Theodor Poppe.
Hermann Nasse, Jacques Callot. Mit einem Titelbild und 98 Abbildungen auf
45 Tafeln in Lichtdruck. (Die Meister der Graphik, herausgegeben von
Dr. Hermann Voß, Bd. I.) 4°. 100 S. Verlag von Klinkhardt & Biermann in
Leipzig, o. J.
Es ist gewiß ein vortrefflicher Gedanke des Herausgebers und der Verleger,
die Meister der Graphik mit ihren wichtigsten Werken in technisch vollendeter
Wiedergabe bequem zusammengefaßt den Freunden der Griffelkunst auf den Tisch
und unter die Lupe legen zu wollen. Die Reihe, die mit dem Werk Jacques Cal-
lots eröffnet wird, soll unterschiedslos alle Perioden und Künstler von Bedeutung
umspannen und sowohl den Forschern wie den Liebhabern und dem kunstfreund-
lichen Publikum entgegenkommen. Sie will den Forschern ein überall zerstreutes,
unerschöpfliches Material bieten, den Sammlern ein Berater sein bei der Zusammen-
stellung und Auswahl ihrer Kollektionen, den Kulturhistorikern endlich als Hilfs-
mittel für ihre Forschungen dienen.
Viele Ansprüche sollen demnach befriedigt werden. Die Bearbeiter der ein-
zelnen Bände werden ihre liebe Mühe haben, es allen recht zu machen. Vielleicht
hätte der Herausgeber besser getan, die Aufgabe des Unternehmens einseitiger zu
bestimmen und dadurch seinen Mitarbeitern eine wohltätig gebundene Marschroute
vorzuschreiben. Vielseitigkeit ist nicht immer eine Tugend. Die Wünsche des
Forschers und die Bedürfnisse des Liebhabers gehen nicht in jedem Fall zusammen.
Keiner von beiden wird freilich etwas auszusetzen haben, wenn eine Vollständigkeit
gegeben wird. Aber das ist weder möglich noch beabsichtigt. Die Abbildungen
stellen eine Auswahl dar. Nun mag das Moment der Zufälligkeit bei der Auswahl
Wilhelm Lange, Die Psychose Maupassants. Ein kritischer Versuch,
Leipzig, J. A. Barth, 1909. 18 S.
Vier Psychiater haben sich bis jetzt in besonderen »Pathographien« mit Mau-
passant beschäftigt. Ihnen hat sich der auch mit einer beachtenswerten Hölderlin-
Pathographie hervorgetretene Tübinger Arzt W. Lange in der vorliegenden kleinen
Studie angeschlossen. Seine Ergebnisse lauten (S. 17): »Maupassant hat an einer
leichteren Form der Psychopathie gelitten. Er war Alkoholiker und hat sich syphi-
litisch infiziert. Seine Halluzinationen sind schwer zu klassifizieren. Nach einem
längeren luetischen Vorstadium ist er endlich an einer progressiven Paralyse zu-
grunde gegangen. Viele seiner Werke sind durch die Krankheit beeinflußt worden
— für den Sachkundigen ausschließlich zu ihrem Nachteil.« Das ist offenbar nicht
viel. Wie denn meines Erachtens überhaupt aus solchen diagnostischen Bemühungen
wenig herauszuspringen pflegt. Jedenfalls bleiben die pathographischen Studien für
die Geistesgeschichte und Geisteswissenschaft immer von sekundärem Interesse.
Es werden Tatsachen konstatiert. Diesen Tatsachen, die auf den begonnenen Auf-
lösungsprozeß der körperlichen Organisation hinweisen, stehen die Tatsachen ent-
gegen, die von der Ausdruckskraft und Widerstandsfähigkeit des geistigen Orga-
nismus Zeugnis geben, d.h. die Tatsachen der geistigen Persönlichkeit. Und hier
liegt auch erst das eigentliche Problem, bis zu dessen Schwelle Lange seinen kri-
tischen Versuch geführt hat: wie es möglich ist, daß — im Fall Maupassant — »ein
Gehirn, obgleich es krank war, 10 Jahre lang ,geniale' oder doch zum mindesten ganz
ausgezeichnete Werke geschaffen« hat. Es will mir scheinen, daß dies Problem
nur auf philosophisch geklärtem Boden erfolgverheißend in Angriff genommen
werden kann. Interessant zu sehen wäre es, wie sich der Materialismus an ihm
die Zähne ausbeißt.
Friedenau. ___________ Theodor Poppe.
Hermann Nasse, Jacques Callot. Mit einem Titelbild und 98 Abbildungen auf
45 Tafeln in Lichtdruck. (Die Meister der Graphik, herausgegeben von
Dr. Hermann Voß, Bd. I.) 4°. 100 S. Verlag von Klinkhardt & Biermann in
Leipzig, o. J.
Es ist gewiß ein vortrefflicher Gedanke des Herausgebers und der Verleger,
die Meister der Graphik mit ihren wichtigsten Werken in technisch vollendeter
Wiedergabe bequem zusammengefaßt den Freunden der Griffelkunst auf den Tisch
und unter die Lupe legen zu wollen. Die Reihe, die mit dem Werk Jacques Cal-
lots eröffnet wird, soll unterschiedslos alle Perioden und Künstler von Bedeutung
umspannen und sowohl den Forschern wie den Liebhabern und dem kunstfreund-
lichen Publikum entgegenkommen. Sie will den Forschern ein überall zerstreutes,
unerschöpfliches Material bieten, den Sammlern ein Berater sein bei der Zusammen-
stellung und Auswahl ihrer Kollektionen, den Kulturhistorikern endlich als Hilfs-
mittel für ihre Forschungen dienen.
Viele Ansprüche sollen demnach befriedigt werden. Die Bearbeiter der ein-
zelnen Bände werden ihre liebe Mühe haben, es allen recht zu machen. Vielleicht
hätte der Herausgeber besser getan, die Aufgabe des Unternehmens einseitiger zu
bestimmen und dadurch seinen Mitarbeitern eine wohltätig gebundene Marschroute
vorzuschreiben. Vielseitigkeit ist nicht immer eine Tugend. Die Wünsche des
Forschers und die Bedürfnisse des Liebhabers gehen nicht in jedem Fall zusammen.
Keiner von beiden wird freilich etwas auszusetzen haben, wenn eine Vollständigkeit
gegeben wird. Aber das ist weder möglich noch beabsichtigt. Die Abbildungen
stellen eine Auswahl dar. Nun mag das Moment der Zufälligkeit bei der Auswahl