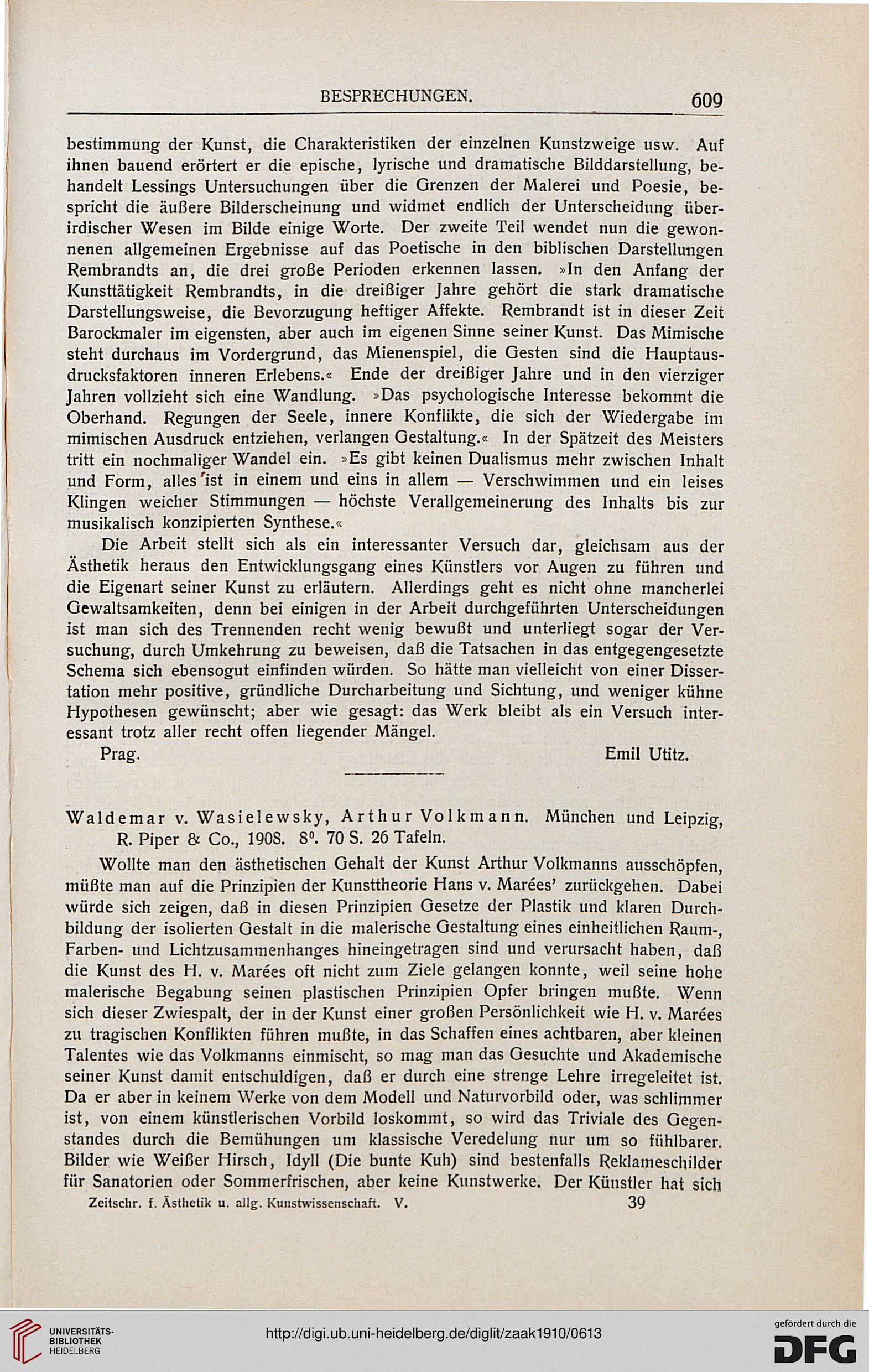BESPRECHUNGEN. 60g
bestimmung der Kunst, die Charakteristiken der einzelnen Kunstzweige usw. Auf
ihnen bauend erörtert er die epische, lyrische und dramatische Bilddarstellung, be-
handelt Lessings Untersuchungen über die Grenzen der Malerei und Poesie, be-
spricht die äußere Bilderscheinung und widmet endlich der Unterscheidung über-
irdischer Wesen im Bilde einige Worte. Der zweite Teil wendet nun die gewon-
nenen allgemeinen Ergebnisse auf das Poetische in den biblischen Darstellungen
Rembrandts an, die drei große Perioden erkennen lassen. »In den Anfang der
Kunsttätigkeit Rembrandts, in die dreißiger Jahre gehört die stark dramatische
Darstellungsweise, die Bevorzugung heftiger Affekte. Rembrandt ist in dieser Zeit
Barockmaler im eigensten, aber auch im eigenen Sinne seiner Kunst. Das Mimische
steht durchaus im Vordergrund, das Mienenspiel, die Gesten sind die Hauptaus-
drucksfaktoren inneren Erlebens.« Ende der dreißiger Jahre und in den vierziger
Jahren vollzieht sich eine Wandlung. »Das psychologische Interesse bekommt die
Oberhand. Regungen der Seele, innere Konflikte, die sich der Wiedergabe im
mimischen Ausdruck entziehen, verlangen Gestaltung.« In der Spätzeit des Meisters
tritt ein nochmaliger Wandel ein. »Es gibt keinen Dualismus mehr zwischen Inhalt
und Form, allesrist in einem und eins in allem — Verschwimmen und ein leises
Klingen weicher Stimmungen — höchste Verallgemeinerung des Inhalts bis zur
musikalisch konzipierten Synthese.«
Die Arbeit stellt sich als ein interessanter Versuch dar, gleichsam aus der
Ästhetik heraus den Entwicklungsgang eines Künstlers vor Augen zu führen und
die Eigenart seiner Kunst zu erläutern. Allerdings geht es nicht ohne mancherlei
Gewaltsamkeiten, denn bei einigen in der Arbeit durchgeführten Unterscheidungen
ist man sich des Trennenden recht wenig bewußt und unterliegt sogar der Ver-
suchung, durch Umkehrung zu beweisen, daß die Tatsachen in das entgegengesetzte
Schema sich ebensogut einfinden würden. So hätte man vielleicht von einer Disser-
tation mehr positive, gründliche Durcharbeitung und Sichtung, und weniger kühne
Hypothesen gewünscht; aber wie gesagt: das Werk bleibt als ein Versuch inter-
essant trotz aller recht offen liegender Mängel.
Prag. Emil Utitz.
Waldemar v. Wasielewsky, Arthu r Vol km ann. München und Leipzig,
R. Piper & Co., 1908. 8°. 70 S. 26 Tafeln.
Wollte man den ästhetischen Gehalt der Kunst Arthur Volkmanns ausschöpfen,
müßte man auf die Prinzipien der Kunsttheorie Hans v. Marees' zurückgehen. Dabei
würde sich zeigen, daß in diesen Prinzipien Gesetze der Plastik und klaren Durch-
bildung der isolierten Gestalt in die malerische Gestaltung eines einheitlichen Raum-,
Farben- und Lichtzusammenhanges hineingetragen sind und verursacht haben, daß
die Kunst des H. v. Marees oft nicht zum Ziele gelangen konnte, weil seine hohe
malerische Begabung seinen plastischen Prinzipien Opfer bringen mußte. Wenn
sich dieser Zwiespalt, der in der Kunst einer großen Persönlichkeit wie H. v. Marees
zu tragischen Konflikten führen mußte, in das Schaffen eines achtbaren, aber kleinen
Talentes wie das Volkmanns einmischt, so mag man das Gesuchte und Akademische
seiner Kunst damit entschuldigen, daß er durch eine strenge Lehre irregeleitet ist.
Da er aber in keinem Werke von dem Modell und Naturvorbild oder, was schlimmer
ist, von einem künstlerischen Vorbild loskommt, so wird das Triviale des Gegen-
standes durch die Bemühungen um klassische Veredelung nur um so fühlbarer.
Bilder wie Weißer Hirsch, Idyll (Die bunte Kuh) sind bestenfalls Reklameschilder
für Sanatorien oder Sommerfrischen, aber keine Kunstwerke. Der Künstler hat sich
Zcitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. V. 39
bestimmung der Kunst, die Charakteristiken der einzelnen Kunstzweige usw. Auf
ihnen bauend erörtert er die epische, lyrische und dramatische Bilddarstellung, be-
handelt Lessings Untersuchungen über die Grenzen der Malerei und Poesie, be-
spricht die äußere Bilderscheinung und widmet endlich der Unterscheidung über-
irdischer Wesen im Bilde einige Worte. Der zweite Teil wendet nun die gewon-
nenen allgemeinen Ergebnisse auf das Poetische in den biblischen Darstellungen
Rembrandts an, die drei große Perioden erkennen lassen. »In den Anfang der
Kunsttätigkeit Rembrandts, in die dreißiger Jahre gehört die stark dramatische
Darstellungsweise, die Bevorzugung heftiger Affekte. Rembrandt ist in dieser Zeit
Barockmaler im eigensten, aber auch im eigenen Sinne seiner Kunst. Das Mimische
steht durchaus im Vordergrund, das Mienenspiel, die Gesten sind die Hauptaus-
drucksfaktoren inneren Erlebens.« Ende der dreißiger Jahre und in den vierziger
Jahren vollzieht sich eine Wandlung. »Das psychologische Interesse bekommt die
Oberhand. Regungen der Seele, innere Konflikte, die sich der Wiedergabe im
mimischen Ausdruck entziehen, verlangen Gestaltung.« In der Spätzeit des Meisters
tritt ein nochmaliger Wandel ein. »Es gibt keinen Dualismus mehr zwischen Inhalt
und Form, allesrist in einem und eins in allem — Verschwimmen und ein leises
Klingen weicher Stimmungen — höchste Verallgemeinerung des Inhalts bis zur
musikalisch konzipierten Synthese.«
Die Arbeit stellt sich als ein interessanter Versuch dar, gleichsam aus der
Ästhetik heraus den Entwicklungsgang eines Künstlers vor Augen zu führen und
die Eigenart seiner Kunst zu erläutern. Allerdings geht es nicht ohne mancherlei
Gewaltsamkeiten, denn bei einigen in der Arbeit durchgeführten Unterscheidungen
ist man sich des Trennenden recht wenig bewußt und unterliegt sogar der Ver-
suchung, durch Umkehrung zu beweisen, daß die Tatsachen in das entgegengesetzte
Schema sich ebensogut einfinden würden. So hätte man vielleicht von einer Disser-
tation mehr positive, gründliche Durcharbeitung und Sichtung, und weniger kühne
Hypothesen gewünscht; aber wie gesagt: das Werk bleibt als ein Versuch inter-
essant trotz aller recht offen liegender Mängel.
Prag. Emil Utitz.
Waldemar v. Wasielewsky, Arthu r Vol km ann. München und Leipzig,
R. Piper & Co., 1908. 8°. 70 S. 26 Tafeln.
Wollte man den ästhetischen Gehalt der Kunst Arthur Volkmanns ausschöpfen,
müßte man auf die Prinzipien der Kunsttheorie Hans v. Marees' zurückgehen. Dabei
würde sich zeigen, daß in diesen Prinzipien Gesetze der Plastik und klaren Durch-
bildung der isolierten Gestalt in die malerische Gestaltung eines einheitlichen Raum-,
Farben- und Lichtzusammenhanges hineingetragen sind und verursacht haben, daß
die Kunst des H. v. Marees oft nicht zum Ziele gelangen konnte, weil seine hohe
malerische Begabung seinen plastischen Prinzipien Opfer bringen mußte. Wenn
sich dieser Zwiespalt, der in der Kunst einer großen Persönlichkeit wie H. v. Marees
zu tragischen Konflikten führen mußte, in das Schaffen eines achtbaren, aber kleinen
Talentes wie das Volkmanns einmischt, so mag man das Gesuchte und Akademische
seiner Kunst damit entschuldigen, daß er durch eine strenge Lehre irregeleitet ist.
Da er aber in keinem Werke von dem Modell und Naturvorbild oder, was schlimmer
ist, von einem künstlerischen Vorbild loskommt, so wird das Triviale des Gegen-
standes durch die Bemühungen um klassische Veredelung nur um so fühlbarer.
Bilder wie Weißer Hirsch, Idyll (Die bunte Kuh) sind bestenfalls Reklameschilder
für Sanatorien oder Sommerfrischen, aber keine Kunstwerke. Der Künstler hat sich
Zcitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. V. 39