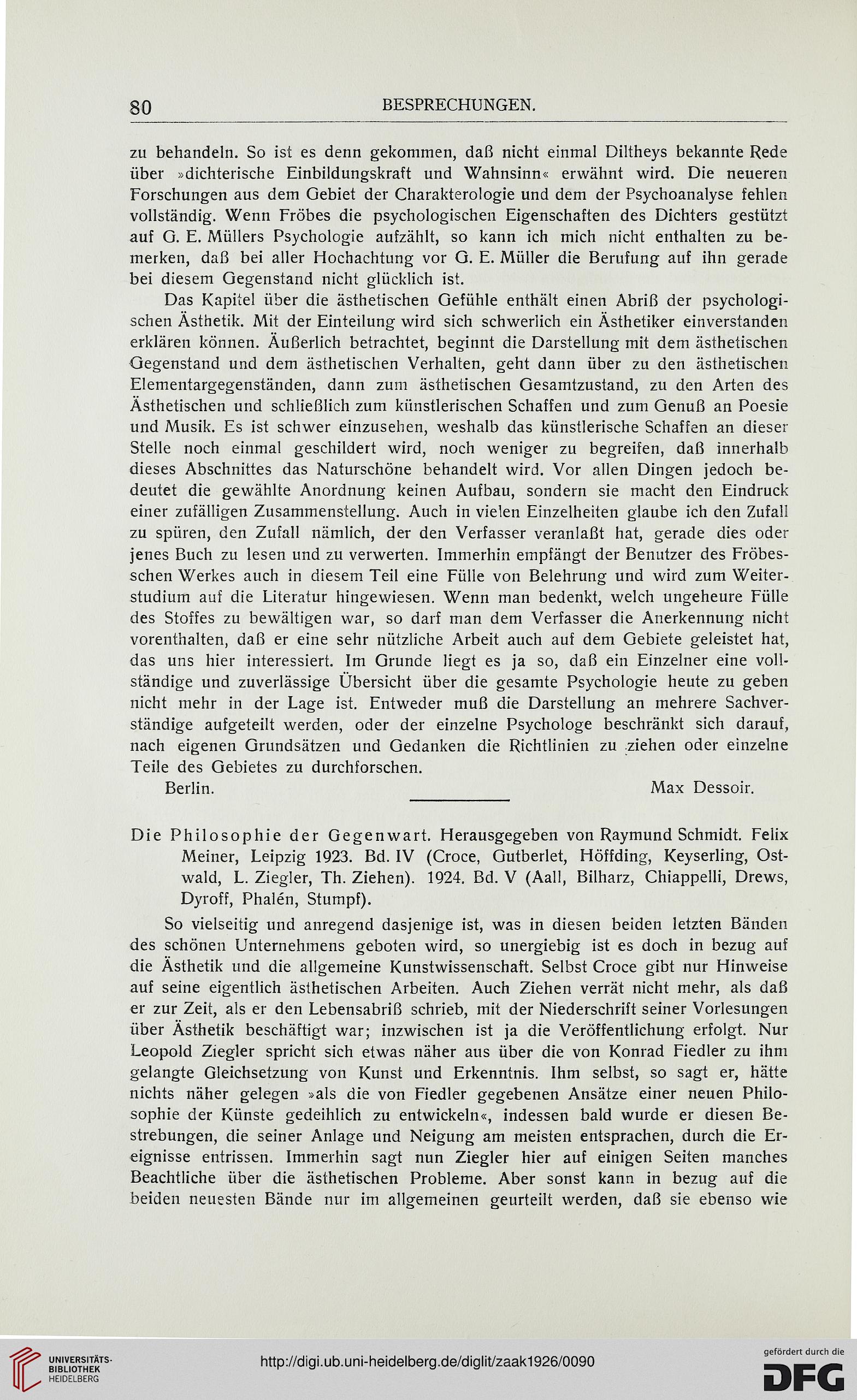80
BESPRECHUNGEN.
zu behandeln. So ist es denn gekommen, daß nicht einmal Diltheys bekannte Rede
über »dichtetische Einbildungskraft und Wahnsinn« erwähnt wird. Die neueren
Forschungen aus dem Gebiet der Charakterologie und dem der Psychoanalyse fehlen
vollständig. Wenn Fröbes die psychologischen Eigenschaften des Dichters gestützt
auf G. E. Müllers Psychologie aufzählt, so kann ich mich nicht enthalten zu be-
merken, daß bei aller Hochachtung vor G. E. Müller die Berufung auf ihn gerade
bei diesem Gegenstand nicht glücklich ist.
Das Kapitel über die ästhetischen Gefühle enthält einen Abriß der psychologi-
schen Ästhetik. Mit der Einteilung wird sich schwerlich ein Ästhetiker einverstanden
erklären können. Äußerlich betrachtet, beginnt die Darstellung mit dem ästhetischen
Gegenstand und dem ästhetischen Verhalten, geht dann über zu den ästhetischen
Elementargegenständen, dann zum ästhetischen Gesamtzustand, zu den Arten des
Ästhetischen und schließlich zum künstlerischen Schaffen und zum Genuß an Poesie
und Musik. Es ist schwer einzusehen, weshalb das künstlerische Schaffen an dieser
Stelle noch einmal geschildert wird, noch weniger zu begreifen, daß innerhalb
dieses Abschnittes das Naturschöne behandelt wird. Vor allen Dingen jedoch be-
deutet die gewählte Anordnung keinen Aufbau, sondern sie macht den Eindruck
einer zufälligen Zusammenstellung. Auch in vielen Einzelheiten glaube ich den Zufall
zu spüren, den Zufall nämlich, der den Verfasser veranlaßt hat, gerade dies oder
jenes Buch zu lesen und zu verwerten. Immerhin empfängt der Benutzer des Fröbes-
schen Werkes auch in diesem Teil eine Fülle von Belehrung und wird zum Weiter-
studium auf die Literatur hingewiesen. Wenn man bedenkt, welch ungeheure Fülle
des Stoffes zu bewältigen war, so darf man dem Verfasser die Anerkennung nicht
vorenthalten, daß er eine sehr nützliche Arbeit auch auf dem Gebiete geleistet hat,
das uns hier interessiert. Im Grunde liegt es ja so, daß ein Einzelner eine voll-
ständige und zuverlässige Übersicht über die gesamte Psychologie heute zu geben
nicht mehr in der Lage ist. Entweder muß die Darstellung an mehrere Sachver-
ständige aufgeteilt werden, oder der einzelne Psychologe beschränkt sich darauf,
nach eigenen Grundsätzen und Gedanken die Richtlinien zu ziehen oder einzelne
Teile des Gebietes zu durchforschen.
Berlin. Max Dessoir.
Die Philosophie der Gegenwart. Herausgegeben von Raymund Schmidt. Felix
Meiner, Leipzig 1923. Bd. IV (Croce, Gutberiet, Höffding, Keyserling, Ost-
wald, L. Ziegler, Th. Ziehen). 1924. Bd. V (Aal!, Bilharz, Chiappelli, Drews,
Dyroff, Phalen, Stumpf).
So vielseitig und anregend dasjenige ist, was in diesen beiden letzten Bänden
des schönen Unternehmens geboten wird, so unergiebig ist es doch in bezug auf
die Ästhetik und die allgemeine Kunstwissenschaft. Selbst Croce gibt nur Hinweise
auf seine eigentlich ästhetischen Arbeiten. Auch Ziehen verrät nicht mehr, als daß
er zur Zeit, als er den Lebensabriß schrieb, mit der Niederschrift seiner Vorlesungen
über Ästhetik beschäftigt war; inzwischen ist ja die Veröffentlichung erfolgt. Nur
Leopold Ziegler spricht sich etwas näher aus über die von Konrad Fiedler zu ihm
gelangte Gleichsetzung von Kunst und Erkenntnis. Ihm selbst, so sagt er, hätte
nichts näher gelegen »als die von Fiedler gegebenen Ansätze einer neuen Philo-
sophie der Künste gedeihlich zu entwickeln«, indessen bald wurde er diesen Be-
strebungen, die seiner Anlage und Neigung am meisten entsprachen, durch die Er-
eignisse entrissen. Immerhin sagt nun Ziegler hier auf einigen Seiten manches
Beachtliche über die ästhetischen Probleme. Aber sonst kann in bezug auf die
beiden neuesten Bände nur im allgemeinen geurteilt werden, daß sie ebenso wie
BESPRECHUNGEN.
zu behandeln. So ist es denn gekommen, daß nicht einmal Diltheys bekannte Rede
über »dichtetische Einbildungskraft und Wahnsinn« erwähnt wird. Die neueren
Forschungen aus dem Gebiet der Charakterologie und dem der Psychoanalyse fehlen
vollständig. Wenn Fröbes die psychologischen Eigenschaften des Dichters gestützt
auf G. E. Müllers Psychologie aufzählt, so kann ich mich nicht enthalten zu be-
merken, daß bei aller Hochachtung vor G. E. Müller die Berufung auf ihn gerade
bei diesem Gegenstand nicht glücklich ist.
Das Kapitel über die ästhetischen Gefühle enthält einen Abriß der psychologi-
schen Ästhetik. Mit der Einteilung wird sich schwerlich ein Ästhetiker einverstanden
erklären können. Äußerlich betrachtet, beginnt die Darstellung mit dem ästhetischen
Gegenstand und dem ästhetischen Verhalten, geht dann über zu den ästhetischen
Elementargegenständen, dann zum ästhetischen Gesamtzustand, zu den Arten des
Ästhetischen und schließlich zum künstlerischen Schaffen und zum Genuß an Poesie
und Musik. Es ist schwer einzusehen, weshalb das künstlerische Schaffen an dieser
Stelle noch einmal geschildert wird, noch weniger zu begreifen, daß innerhalb
dieses Abschnittes das Naturschöne behandelt wird. Vor allen Dingen jedoch be-
deutet die gewählte Anordnung keinen Aufbau, sondern sie macht den Eindruck
einer zufälligen Zusammenstellung. Auch in vielen Einzelheiten glaube ich den Zufall
zu spüren, den Zufall nämlich, der den Verfasser veranlaßt hat, gerade dies oder
jenes Buch zu lesen und zu verwerten. Immerhin empfängt der Benutzer des Fröbes-
schen Werkes auch in diesem Teil eine Fülle von Belehrung und wird zum Weiter-
studium auf die Literatur hingewiesen. Wenn man bedenkt, welch ungeheure Fülle
des Stoffes zu bewältigen war, so darf man dem Verfasser die Anerkennung nicht
vorenthalten, daß er eine sehr nützliche Arbeit auch auf dem Gebiete geleistet hat,
das uns hier interessiert. Im Grunde liegt es ja so, daß ein Einzelner eine voll-
ständige und zuverlässige Übersicht über die gesamte Psychologie heute zu geben
nicht mehr in der Lage ist. Entweder muß die Darstellung an mehrere Sachver-
ständige aufgeteilt werden, oder der einzelne Psychologe beschränkt sich darauf,
nach eigenen Grundsätzen und Gedanken die Richtlinien zu ziehen oder einzelne
Teile des Gebietes zu durchforschen.
Berlin. Max Dessoir.
Die Philosophie der Gegenwart. Herausgegeben von Raymund Schmidt. Felix
Meiner, Leipzig 1923. Bd. IV (Croce, Gutberiet, Höffding, Keyserling, Ost-
wald, L. Ziegler, Th. Ziehen). 1924. Bd. V (Aal!, Bilharz, Chiappelli, Drews,
Dyroff, Phalen, Stumpf).
So vielseitig und anregend dasjenige ist, was in diesen beiden letzten Bänden
des schönen Unternehmens geboten wird, so unergiebig ist es doch in bezug auf
die Ästhetik und die allgemeine Kunstwissenschaft. Selbst Croce gibt nur Hinweise
auf seine eigentlich ästhetischen Arbeiten. Auch Ziehen verrät nicht mehr, als daß
er zur Zeit, als er den Lebensabriß schrieb, mit der Niederschrift seiner Vorlesungen
über Ästhetik beschäftigt war; inzwischen ist ja die Veröffentlichung erfolgt. Nur
Leopold Ziegler spricht sich etwas näher aus über die von Konrad Fiedler zu ihm
gelangte Gleichsetzung von Kunst und Erkenntnis. Ihm selbst, so sagt er, hätte
nichts näher gelegen »als die von Fiedler gegebenen Ansätze einer neuen Philo-
sophie der Künste gedeihlich zu entwickeln«, indessen bald wurde er diesen Be-
strebungen, die seiner Anlage und Neigung am meisten entsprachen, durch die Er-
eignisse entrissen. Immerhin sagt nun Ziegler hier auf einigen Seiten manches
Beachtliche über die ästhetischen Probleme. Aber sonst kann in bezug auf die
beiden neuesten Bände nur im allgemeinen geurteilt werden, daß sie ebenso wie