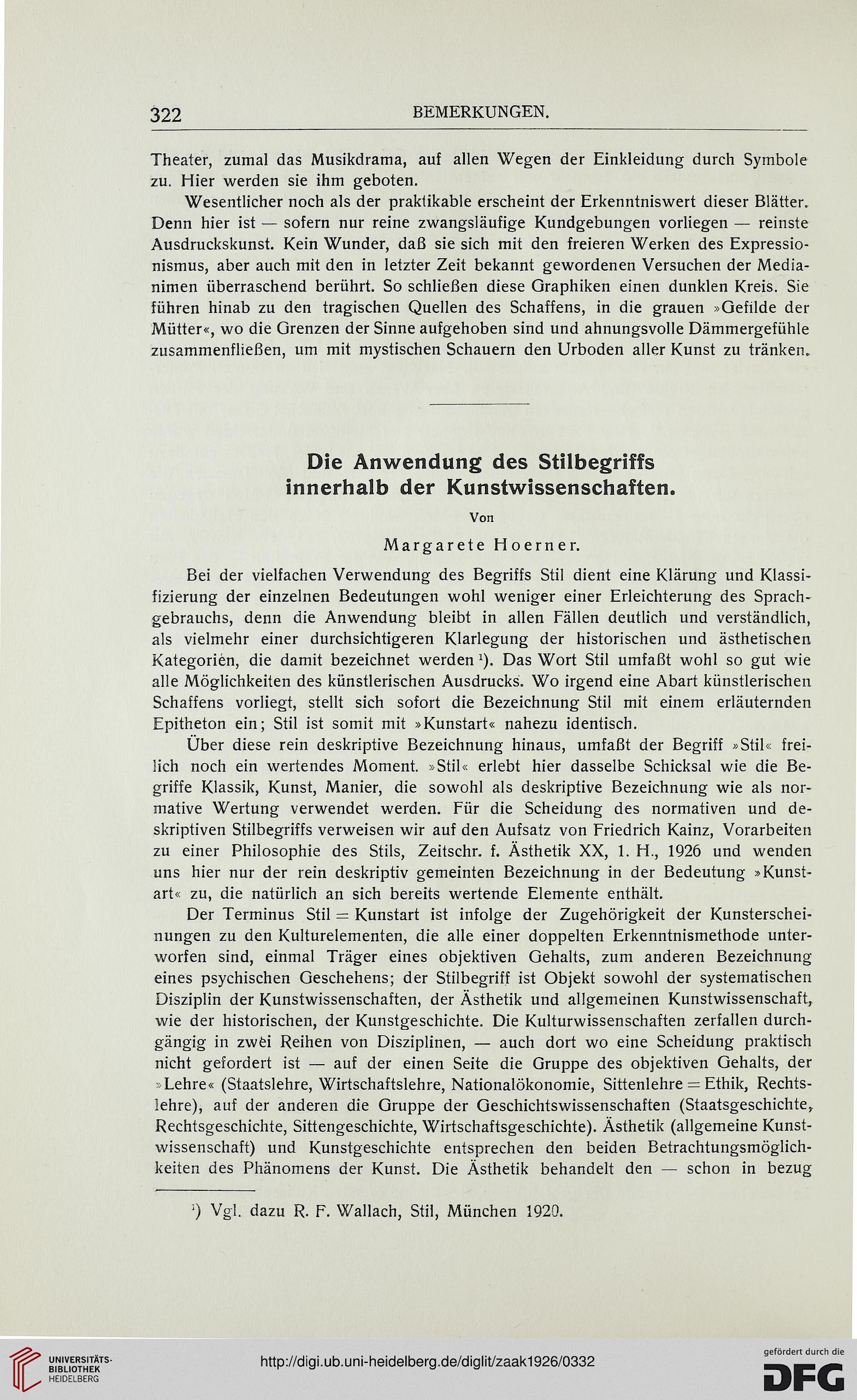322
BEMERKUNGEN.
Theater, zumal das Musikdrama, auf allen Wegen der Einkleidung durch Symbole
zu. Hier werden sie ihm geboten.
Wesentlicher noch als der praktikable erscheint der Erkenntniswert dieser Blätter.
Denn hier ist — sofern nur reine zwangsläufige Kundgebungen vorliegen — reinste
Ausdruckskunst. Kein Wunder, daß sie sich mit den freieren Werken des Expressio-
nismus, aber auch mit den in letzter Zeit bekannt gewordenen Versuchen der Media-
nimen überraschend berührt. So schließen diese Graphiken einen dunklen Kreis. Sie
führen hinab zu den tragischen Quellen des Schaffens, in die grauen »Gefilde der
Mütter«, wo die Grenzen der Sinne aufgehoben sind und ahnungsvolle Dämmergefühle
zusammenfließen, um mit mystischen Schauern den Urboden aller Kunst zu tränken.
Die Anwendung des Stilbegriffs
innerhalb der Kunstwissenschaften.
Von
Margarete Hoerner.
Bei der vielfachen Verwendung des Begriffs Stil dient eine Klärung und Klassi-
fizierung der einzelnen Bedeutungen wohl weniger einer Erleichterung des Sprach-
gebrauchs, denn die Anwendung bleibt in allen Fällen deutlich und verständlich,
als vielmehr einer durchsichtigeren Klarlegung der historischen und ästhetischen
Kategorien, die damit bezeichnet werden'). Das Wort Stil umfaßt wohl so gut wie
alle Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks. Wo irgend eine Abart künstlerischen
Schaffens vorliegt, stellt sich sofort die Bezeichnung Stil mit einem erläuternden
Epitheton ein; Stil ist somit mit »Kunstart« nahezu identisch.
Über diese rein deskriptive Bezeichnung hinaus, umfaßt der Begriff »Stil« frei-
lich noch ein wertendes Moment. »Stil« erlebt hier dasselbe Schicksal wie die Be-
griffe Klassik, Kunst, Manier, die sowohl als deskriptive Bezeichnung wie als nor-
mative Wertung verwendet werden. Für die Scheidung des normativen und de-
skriptiven Stilbegriffs verweisen wir auf den Aufsatz von Friedrich Kainz, Vorarbeiten
zu einer Philosophie des Stils, Zeitschr. f. Ästhetik XX, 1. H., 1926 und wenden
uns hier nur der rein deskriptiv gemeinten Bezeichnung in der Bedeutung »Kunst-
art« zu, die natürlich an sich bereits wertende Elemente enthält.
Der Terminus Stil = Kunstart ist infolge der Zugehörigkeit der Kunsterschei-
nungen zu den Kulturelementen, die alle einer doppelten Erkenntnismethode unter-
worfen sind, einmal Träger eines objektiven Gehalts, zum anderen Bezeichnung
eines psychischen Geschehens; der Stilbegriff ist Objekt sowohl der systematischen
Disziplin der Kunstwissenschaften, der Ästhetik und allgemeinen Kunstwissenschaft,
wie der historischen, der Kunstgeschichte. Die Kulturwissenschaften zerfallen durch-
gängig in zwei Reihen von Disziplinen, — auch dort wo eine Scheidung praktisch
nicht gefordert ist — auf der einen Seite die Gruppe des objektiven Gehalts, der
»Lehre« (Staatslehre, Wirtschaftslehre, Nationalökonomie, Sittenlehre = Ethik, Rechts-
lehre), auf der anderen die Gruppe der Geschichtswissenschaften (Staatsgeschichte,
Rechtsgeschichte, Sittengeschichte, Wirtschaftsgeschichte). Ästhetik (allgemeine Kunst-
wissenschaft) und Kunstgeschichte entsprechen den beiden Betrachtungsmöglich-
keiten des Phänomens der Kunst. Die Ästhetik behandelt den — schon in bezug
:) Vgl. dazu R. F. Wallach, Stil, München 1920.
BEMERKUNGEN.
Theater, zumal das Musikdrama, auf allen Wegen der Einkleidung durch Symbole
zu. Hier werden sie ihm geboten.
Wesentlicher noch als der praktikable erscheint der Erkenntniswert dieser Blätter.
Denn hier ist — sofern nur reine zwangsläufige Kundgebungen vorliegen — reinste
Ausdruckskunst. Kein Wunder, daß sie sich mit den freieren Werken des Expressio-
nismus, aber auch mit den in letzter Zeit bekannt gewordenen Versuchen der Media-
nimen überraschend berührt. So schließen diese Graphiken einen dunklen Kreis. Sie
führen hinab zu den tragischen Quellen des Schaffens, in die grauen »Gefilde der
Mütter«, wo die Grenzen der Sinne aufgehoben sind und ahnungsvolle Dämmergefühle
zusammenfließen, um mit mystischen Schauern den Urboden aller Kunst zu tränken.
Die Anwendung des Stilbegriffs
innerhalb der Kunstwissenschaften.
Von
Margarete Hoerner.
Bei der vielfachen Verwendung des Begriffs Stil dient eine Klärung und Klassi-
fizierung der einzelnen Bedeutungen wohl weniger einer Erleichterung des Sprach-
gebrauchs, denn die Anwendung bleibt in allen Fällen deutlich und verständlich,
als vielmehr einer durchsichtigeren Klarlegung der historischen und ästhetischen
Kategorien, die damit bezeichnet werden'). Das Wort Stil umfaßt wohl so gut wie
alle Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks. Wo irgend eine Abart künstlerischen
Schaffens vorliegt, stellt sich sofort die Bezeichnung Stil mit einem erläuternden
Epitheton ein; Stil ist somit mit »Kunstart« nahezu identisch.
Über diese rein deskriptive Bezeichnung hinaus, umfaßt der Begriff »Stil« frei-
lich noch ein wertendes Moment. »Stil« erlebt hier dasselbe Schicksal wie die Be-
griffe Klassik, Kunst, Manier, die sowohl als deskriptive Bezeichnung wie als nor-
mative Wertung verwendet werden. Für die Scheidung des normativen und de-
skriptiven Stilbegriffs verweisen wir auf den Aufsatz von Friedrich Kainz, Vorarbeiten
zu einer Philosophie des Stils, Zeitschr. f. Ästhetik XX, 1. H., 1926 und wenden
uns hier nur der rein deskriptiv gemeinten Bezeichnung in der Bedeutung »Kunst-
art« zu, die natürlich an sich bereits wertende Elemente enthält.
Der Terminus Stil = Kunstart ist infolge der Zugehörigkeit der Kunsterschei-
nungen zu den Kulturelementen, die alle einer doppelten Erkenntnismethode unter-
worfen sind, einmal Träger eines objektiven Gehalts, zum anderen Bezeichnung
eines psychischen Geschehens; der Stilbegriff ist Objekt sowohl der systematischen
Disziplin der Kunstwissenschaften, der Ästhetik und allgemeinen Kunstwissenschaft,
wie der historischen, der Kunstgeschichte. Die Kulturwissenschaften zerfallen durch-
gängig in zwei Reihen von Disziplinen, — auch dort wo eine Scheidung praktisch
nicht gefordert ist — auf der einen Seite die Gruppe des objektiven Gehalts, der
»Lehre« (Staatslehre, Wirtschaftslehre, Nationalökonomie, Sittenlehre = Ethik, Rechts-
lehre), auf der anderen die Gruppe der Geschichtswissenschaften (Staatsgeschichte,
Rechtsgeschichte, Sittengeschichte, Wirtschaftsgeschichte). Ästhetik (allgemeine Kunst-
wissenschaft) und Kunstgeschichte entsprechen den beiden Betrachtungsmöglich-
keiten des Phänomens der Kunst. Die Ästhetik behandelt den — schon in bezug
:) Vgl. dazu R. F. Wallach, Stil, München 1920.