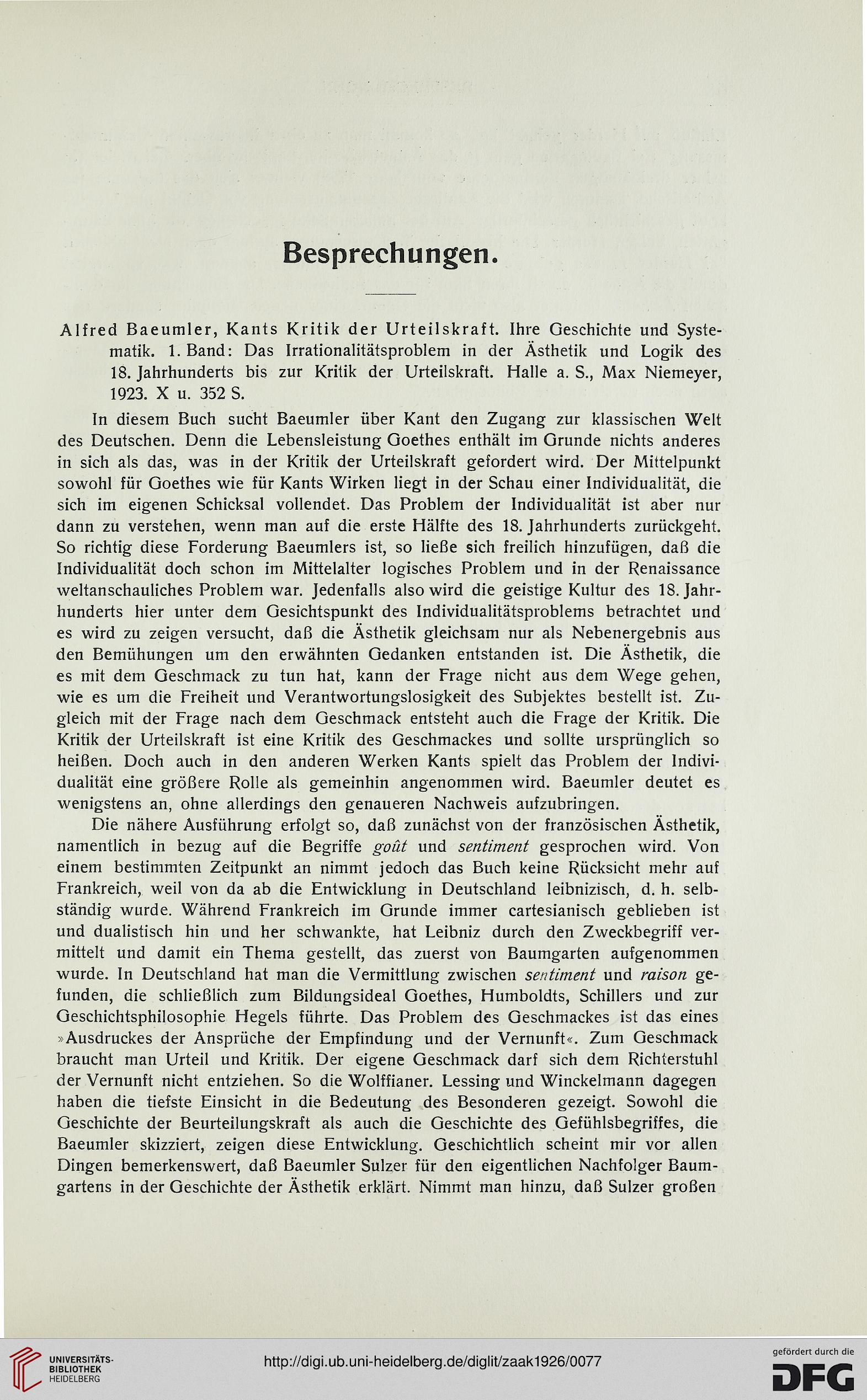Besprechungen.
Alfred Baeumler, Kants Kritik der Urteilskraft. Ihre Geschichte und Syste-
matik. 1. Band: Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des
18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft. Halle a. S., Max Niemeyer,
1923. X u. 352 S.
In diesem Buch sucht Baeumler über Kant den Zugang zur klassischen Welt
des Deutschen. Denn die Lebensleistung Goethes enthält im Grunde nichts anderes
in sich als das, was in der Kritik der Urteilskraft gefordert wird. Der Mittelpunkt
sowohl für Goethes wie für Kants Wirken liegt in der Schau einer Individualität, die
sich im eigenen Schicksal vollendet. Das Problem der Individualität ist aber nur
dann zu verstehen, wenn man auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückgeht.
So richtig diese Forderung Baeumlers ist, so ließe sich freilich hinzufügen, daß die
Individualität doch schon im Mittelalter logisches Problem und in der Renaissance
weltanschauliches Problem war. Jedenfalls also wird die geistige Kultur des 18. Jahr-
hunderts hier unter dem Gesichtspunkt des Individualitätsproblems betrachtet und
es wird zu zeigen versucht, daß die Ästhetik gleichsam nur als Nebenergebnis aus
den Bemühungen um den erwähnten Gedanken entstanden ist. Die Ästhetik, die
es mit dem Geschmack zu tun hat, kann der Frage nicht aus dem Wege gehen,
wie es um die Freiheit und Verantwortungslosigkeit des Subjektes bestellt ist. Zu-
gleich mit der Frage nach dem Geschmack entsteht auch die Frage der Kritik. Die
Kritik der Urteilskraft ist eine Kritik des Geschmackes und sollte ursprünglich so
heißen. Doch auch in den anderen Werken Kants spielt das Problem der Indivi-
dualität eine größere Rolle als gemeinhin angenommen wird. Baeumler deutet es
wenigstens an, ohne allerdings den genaueren Nachweis aufzubringen.
Die nähere Ausführung erfolgt so, daß zunächst von der französischen Ästhetik,
namentlich in bezug auf die Begriffe goüt und sentiment gesprochen wird. Von
einem bestimmten Zeitpunkt an nimmt jedoch das Buch keine Rücksicht mehr auf
Frankreich, weil von da ab die Entwicklung in Deutschland leibnizisch, d. h. selb-
ständig wurde. Während Frankreich im Grunde immer cartesianisch geblieben ist
und dualistisch hin und her schwankte, hat Leibniz durch den Zweckbegriff ver-
mittelt und damit ein Thema gestellt, das zuerst von Baumgarten aufgenommen
wurde. In Deutschland hat man die Vermittlung zwischen sentiment und raison ge-
funden, die schließlich zum Bildungsideal Goethes, Humboldts, Schillers und zur
Geschichtsphilosophie Hegels führte. Das Problem des Geschmackes ist das eines
Ausdruckes der Ansprüche der Empfindung und der Vernunft«. Zum Geschmack
braucht man Urteil und Kritik. Der eigene Geschmack darf sich dem Richterstuhl
der Vernunft nicht entziehen. So die Wolffianer. Lessing und Winckelmann dagegen
haben die tiefste Einsicht in die Bedeutung des Besonderen gezeigt. Sowohl die
Geschichte der Beurteilungskraft als auch die Geschichte des Gefühlsbegriffes, die
Baeumler skizziert, zeigen diese Entwicklung. Geschichtlich scheint mir vor allen
Dingen bemerkenswert, daß Baeumler Sulzer für den eigentlichen Nachfolger Baum-
gartens in der Geschichte der Ästhetik erklärt. Nimmt man hinzu, daß Sulzer großen
Alfred Baeumler, Kants Kritik der Urteilskraft. Ihre Geschichte und Syste-
matik. 1. Band: Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des
18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft. Halle a. S., Max Niemeyer,
1923. X u. 352 S.
In diesem Buch sucht Baeumler über Kant den Zugang zur klassischen Welt
des Deutschen. Denn die Lebensleistung Goethes enthält im Grunde nichts anderes
in sich als das, was in der Kritik der Urteilskraft gefordert wird. Der Mittelpunkt
sowohl für Goethes wie für Kants Wirken liegt in der Schau einer Individualität, die
sich im eigenen Schicksal vollendet. Das Problem der Individualität ist aber nur
dann zu verstehen, wenn man auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückgeht.
So richtig diese Forderung Baeumlers ist, so ließe sich freilich hinzufügen, daß die
Individualität doch schon im Mittelalter logisches Problem und in der Renaissance
weltanschauliches Problem war. Jedenfalls also wird die geistige Kultur des 18. Jahr-
hunderts hier unter dem Gesichtspunkt des Individualitätsproblems betrachtet und
es wird zu zeigen versucht, daß die Ästhetik gleichsam nur als Nebenergebnis aus
den Bemühungen um den erwähnten Gedanken entstanden ist. Die Ästhetik, die
es mit dem Geschmack zu tun hat, kann der Frage nicht aus dem Wege gehen,
wie es um die Freiheit und Verantwortungslosigkeit des Subjektes bestellt ist. Zu-
gleich mit der Frage nach dem Geschmack entsteht auch die Frage der Kritik. Die
Kritik der Urteilskraft ist eine Kritik des Geschmackes und sollte ursprünglich so
heißen. Doch auch in den anderen Werken Kants spielt das Problem der Indivi-
dualität eine größere Rolle als gemeinhin angenommen wird. Baeumler deutet es
wenigstens an, ohne allerdings den genaueren Nachweis aufzubringen.
Die nähere Ausführung erfolgt so, daß zunächst von der französischen Ästhetik,
namentlich in bezug auf die Begriffe goüt und sentiment gesprochen wird. Von
einem bestimmten Zeitpunkt an nimmt jedoch das Buch keine Rücksicht mehr auf
Frankreich, weil von da ab die Entwicklung in Deutschland leibnizisch, d. h. selb-
ständig wurde. Während Frankreich im Grunde immer cartesianisch geblieben ist
und dualistisch hin und her schwankte, hat Leibniz durch den Zweckbegriff ver-
mittelt und damit ein Thema gestellt, das zuerst von Baumgarten aufgenommen
wurde. In Deutschland hat man die Vermittlung zwischen sentiment und raison ge-
funden, die schließlich zum Bildungsideal Goethes, Humboldts, Schillers und zur
Geschichtsphilosophie Hegels führte. Das Problem des Geschmackes ist das eines
Ausdruckes der Ansprüche der Empfindung und der Vernunft«. Zum Geschmack
braucht man Urteil und Kritik. Der eigene Geschmack darf sich dem Richterstuhl
der Vernunft nicht entziehen. So die Wolffianer. Lessing und Winckelmann dagegen
haben die tiefste Einsicht in die Bedeutung des Besonderen gezeigt. Sowohl die
Geschichte der Beurteilungskraft als auch die Geschichte des Gefühlsbegriffes, die
Baeumler skizziert, zeigen diese Entwicklung. Geschichtlich scheint mir vor allen
Dingen bemerkenswert, daß Baeumler Sulzer für den eigentlichen Nachfolger Baum-
gartens in der Geschichte der Ästhetik erklärt. Nimmt man hinzu, daß Sulzer großen