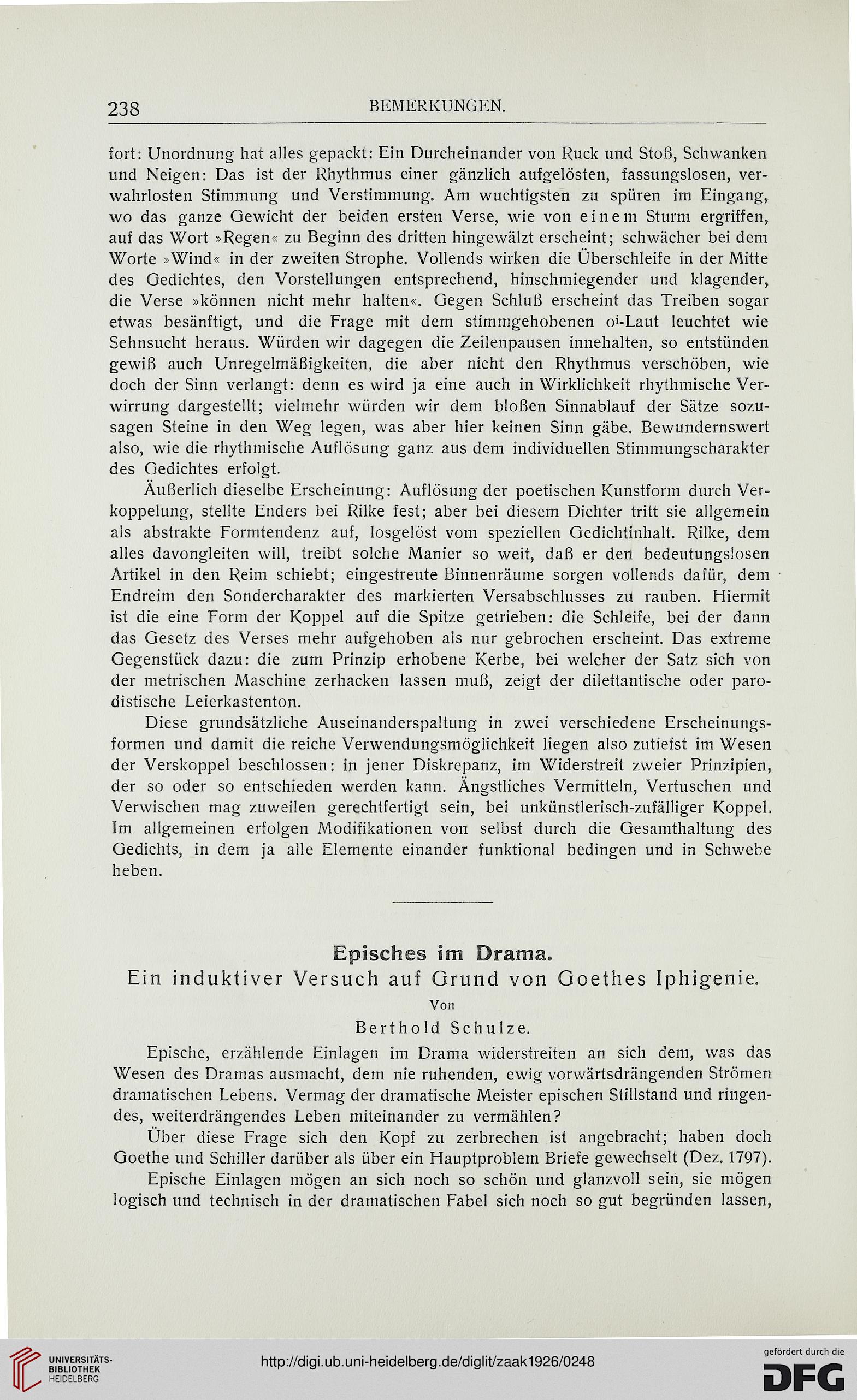238
BEMERKUNGEN.
fort: Unordnung hat alles gepackt: Ein Durcheinander von Ruck und Stoß, Schwanken
und Neigen: Das ist der Rhythmus einer gänzlich aufgelösten, fassungslosen, ver-
wahrlosten Stimmung und Verstimmung. Am wuchtigsten zu spüren im Eingang,
wo das ganze Gewicht der beiden ersten Verse, wie von einem Sturm ergriffen,
auf das Wort »Regen« zu Beginn des dritten hingewälzt erscheint; schwächer bei dem
Worte »Wind« in der zweiten Strophe. Vollends wirken die Überschleife in der Mitte
des Gedichtes, den Vorstellungen entsprechend, hinschmiegender und klagender,
die Verse »können nicht mehr halten«. Gegen Schluß erscheint das Treiben sogar
etwas besänftigt, und die Frage mit dem stimmgehobenen o'-Laut leuchtet wie
Sehnsucht heraus. Würden wir dagegen die Zeilenpausen innehalten, so entstünden
gewiß auch Unregelmäßigkeiten, die aber nicht den Rhythmus verschöben, wie
doch der Sinn verlangt: denn es wird ja eine auch in Wirklichkeit rhythmische Ver-
wirrung dargestellt; vielmehr würden wir dem bloßen Sinnablauf der Sätze sozu-
sagen Steine in den Weg legen, was aber hier keinen Sinn gäbe. Bewundernswert
also, wie die rhythmische Auflösung ganz aus dem individuellen Stimmungscharakter
des Gedichtes erfolgt.
Äußerlich dieselbe Erscheinung: Auflösung der poetischen Kunstform durch Ver-
koppelung, stellte Enders bei Rilke fest; aber bei diesem Dichter tritt sie allgemein
als abstrakte Formtendenz auf, losgelöst vom speziellen Gedichtinhalt. Rilke, dem
alles davongleiten will, treibt solche Manier so weit, daß er den bedeutungslosen
Artikel in den Reim schiebt; eingestreute Binnenräume sorgen vollends dafür, dem
Endreim den Sondercharakter des markierten Versabschlusses zu rauben. Hiermit
ist die eine Form der Koppel auf die Spitze getrieben: die Schleife, bei der dann
das Gesetz des Verses mehr aufgehoben als nur gebrochen erscheint. Das extreme
Gegenstück dazu: die zum Prinzip erhobene Kerbe, bei welcher der Satz sich von
der metrischen Maschine zerhacken lassen muß, zeigt der dilettantische oder paro-
distische Leierkastenton.
Diese grundsätzliche Auseinanderspaltung in zwei verschiedene Erscheinungs-
formen und damit die reiche Verwendungsmöglichkeit liegen also zutiefst im Wesen
der Verskoppel beschlossen: in jener Diskrepanz, im Widerstreit zweier Prinzipien,
der so oder so entschieden werden kann. Ängstliches Vermitteln, Vertuschen und
Verwischen mag zuweilen gerechtfertigt sein, bei unkünstlerisch-zufälliger Koppel.
Im allgemeinen erfolgen Modifikationen von selbst durch die Gesamthaltung des
Gedichts, in dem ja alle Elemente einander funktional bedingen und in Schwebe
heben.
Episches im Drama.
Ein induktiver Versuch auf Grund von Goethes Iphigenie.
Von
Berthold Schulze.
Epische, erzählende Einlagen im Drama widerstreiten an sich dem, was das
Wesen des Dramas ausmacht, dem nie ruhenden, ewig vorwärtsdrängenden Strömen
dramatischen Lebens. Vermag der dramatische Meister epischen Stillstand und ringen-
des, weiterdrängendes Leben miteinander zu vermählen?
Über diese Frage sich den Kopf zu zerbrechen ist angebracht; haben doch
Goethe und Schiller darüber als über ein Hauptproblem Briefe gewechselt (Dez. 1797).
Epische Einlagen mögen an sich noch so schön und glanzvoll sein, sie mögen
logisch und technisch in der dramatischen Fabel sich noch so gut begründen lassen,
BEMERKUNGEN.
fort: Unordnung hat alles gepackt: Ein Durcheinander von Ruck und Stoß, Schwanken
und Neigen: Das ist der Rhythmus einer gänzlich aufgelösten, fassungslosen, ver-
wahrlosten Stimmung und Verstimmung. Am wuchtigsten zu spüren im Eingang,
wo das ganze Gewicht der beiden ersten Verse, wie von einem Sturm ergriffen,
auf das Wort »Regen« zu Beginn des dritten hingewälzt erscheint; schwächer bei dem
Worte »Wind« in der zweiten Strophe. Vollends wirken die Überschleife in der Mitte
des Gedichtes, den Vorstellungen entsprechend, hinschmiegender und klagender,
die Verse »können nicht mehr halten«. Gegen Schluß erscheint das Treiben sogar
etwas besänftigt, und die Frage mit dem stimmgehobenen o'-Laut leuchtet wie
Sehnsucht heraus. Würden wir dagegen die Zeilenpausen innehalten, so entstünden
gewiß auch Unregelmäßigkeiten, die aber nicht den Rhythmus verschöben, wie
doch der Sinn verlangt: denn es wird ja eine auch in Wirklichkeit rhythmische Ver-
wirrung dargestellt; vielmehr würden wir dem bloßen Sinnablauf der Sätze sozu-
sagen Steine in den Weg legen, was aber hier keinen Sinn gäbe. Bewundernswert
also, wie die rhythmische Auflösung ganz aus dem individuellen Stimmungscharakter
des Gedichtes erfolgt.
Äußerlich dieselbe Erscheinung: Auflösung der poetischen Kunstform durch Ver-
koppelung, stellte Enders bei Rilke fest; aber bei diesem Dichter tritt sie allgemein
als abstrakte Formtendenz auf, losgelöst vom speziellen Gedichtinhalt. Rilke, dem
alles davongleiten will, treibt solche Manier so weit, daß er den bedeutungslosen
Artikel in den Reim schiebt; eingestreute Binnenräume sorgen vollends dafür, dem
Endreim den Sondercharakter des markierten Versabschlusses zu rauben. Hiermit
ist die eine Form der Koppel auf die Spitze getrieben: die Schleife, bei der dann
das Gesetz des Verses mehr aufgehoben als nur gebrochen erscheint. Das extreme
Gegenstück dazu: die zum Prinzip erhobene Kerbe, bei welcher der Satz sich von
der metrischen Maschine zerhacken lassen muß, zeigt der dilettantische oder paro-
distische Leierkastenton.
Diese grundsätzliche Auseinanderspaltung in zwei verschiedene Erscheinungs-
formen und damit die reiche Verwendungsmöglichkeit liegen also zutiefst im Wesen
der Verskoppel beschlossen: in jener Diskrepanz, im Widerstreit zweier Prinzipien,
der so oder so entschieden werden kann. Ängstliches Vermitteln, Vertuschen und
Verwischen mag zuweilen gerechtfertigt sein, bei unkünstlerisch-zufälliger Koppel.
Im allgemeinen erfolgen Modifikationen von selbst durch die Gesamthaltung des
Gedichts, in dem ja alle Elemente einander funktional bedingen und in Schwebe
heben.
Episches im Drama.
Ein induktiver Versuch auf Grund von Goethes Iphigenie.
Von
Berthold Schulze.
Epische, erzählende Einlagen im Drama widerstreiten an sich dem, was das
Wesen des Dramas ausmacht, dem nie ruhenden, ewig vorwärtsdrängenden Strömen
dramatischen Lebens. Vermag der dramatische Meister epischen Stillstand und ringen-
des, weiterdrängendes Leben miteinander zu vermählen?
Über diese Frage sich den Kopf zu zerbrechen ist angebracht; haben doch
Goethe und Schiller darüber als über ein Hauptproblem Briefe gewechselt (Dez. 1797).
Epische Einlagen mögen an sich noch so schön und glanzvoll sein, sie mögen
logisch und technisch in der dramatischen Fabel sich noch so gut begründen lassen,