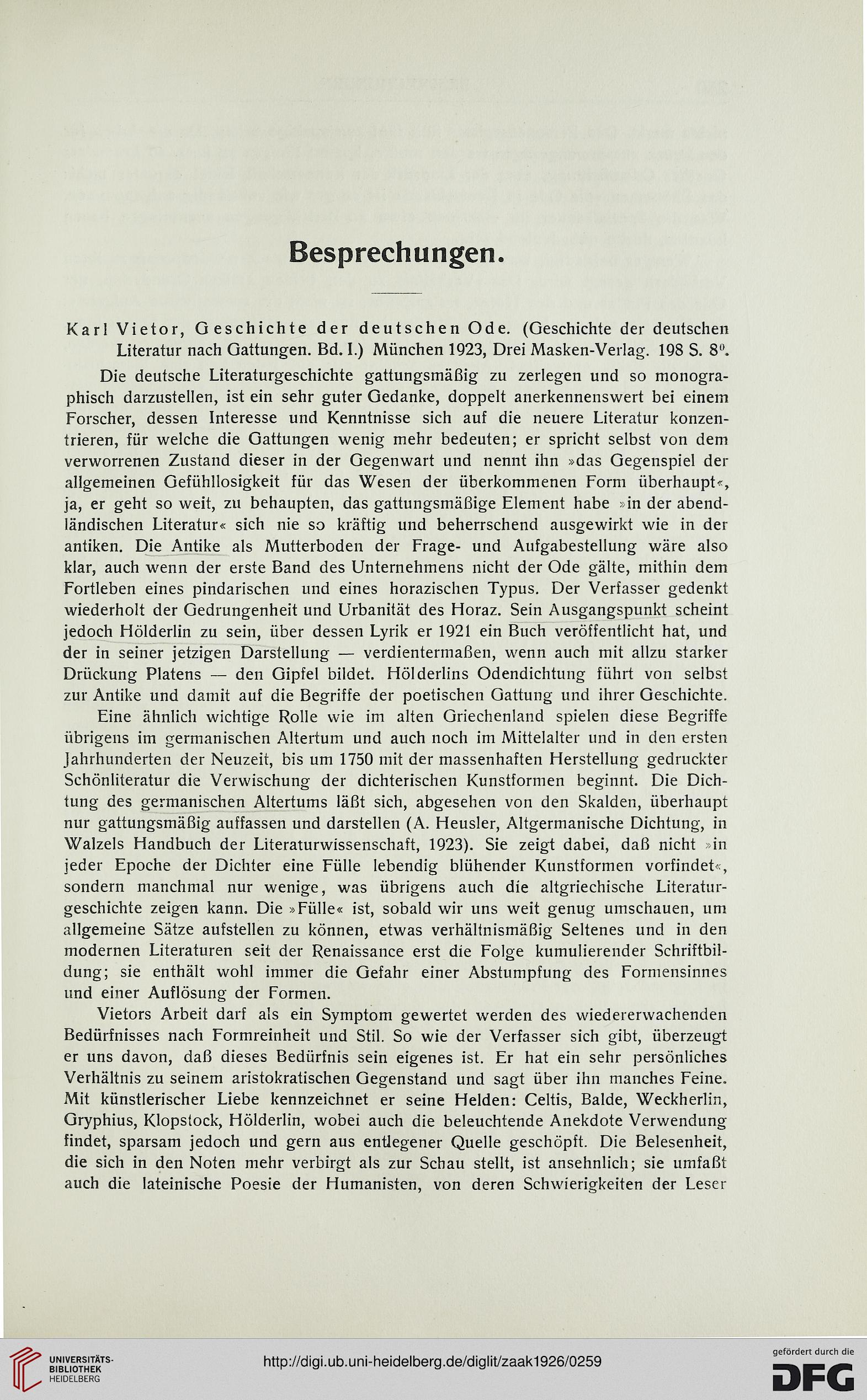Besprechungen.
Karl Vietor, Geschichte der deutschen Ode. (Geschichte der deutschen
Literatur nach Gattungen. Bd. I.) München 1923, Drei Masken-Verlag. 198 S. 8".
Die deutsche Literaturgeschichte gattungsmäßig zu zerlegen und so monogra-
phisch darzustellen, ist ein sehr guter Gedanke, doppelt anerkennenswert bei einem
Forscher, dessen Interesse und Kenntnisse sich auf die neuere Literatur konzen-
trieren, für welche die Gattungen wenig mehr bedeuten; er spricht selbst von dem
verworrenen Zustand dieser in der Gegenwart und nennt ihn »das Gegenspiel der
allgemeinen Gefühllosigkeit für das Wesen der überkommenen Form überhaupt^,
ja, er geht so weit, zu behaupten, das gattungsmäßige Element habe in der abend-
ländischen Literatur« sich nie so kräftig und beherrschend ausgewirkt wie in der
antiken. Die Antike als Mutterboden der Frage- und Aufgabestellung wäre also
klar, auch wenn der erste Band des Unternehmens nicht der Ode gälte, mithin dem
Fortleben eines pindarischen und eines horazischen Typus. Der Verfasser gedenkt
wiederholt der Gedrungenheit und Urbanität des Horaz. Sein Ausgangspunkt scheint
jedoch Hölderlin zu sein, über dessen Lyrik er 1921 ein Buch veröffentlicht hat, und
der in seiner jetzigen Darstellung — verdientermaßen, wenn auch mit allzu starker
Drückung Platens — den Gipfel bildet. Hölderlins Odendichtung führt von selbst
zur Antike und damit auf die Begriffe der poetischen Gattung und ihrer Geschichte.
Eine ähnlich wichtige Rolle wie im alten Griechenland spielen diese Begriffe
übrigens im germanischen Altertum und auch noch im Mittelalter und in den ersten
Jahrhunderten der Neuzeit, bis um 1750 mit der massenhaften Herstellung gedruckter
Schönliteratur die Verwischung der dichterischen Kunstformen beginnt. Die Dich-
tung des germanischen Altertums läßt sich, abgesehen von den Skalden, überhaupt
nur gattungsmäßig auffassen und darstellen (A. Heusler, Altgermanische Dichtung, in
Walzels Handbuch der Literaturwissenschaft, 1923). Sie zeigt dabei, daß nicht -in
jeder Epoche der Dichter eine Fülle lebendig blühender Kunstformen vorfindet«,
sondern manchmal nur wenige, was übrigens auch die altgriechische Literatur-
geschichte zeigen kann. Die »Fülle« ist, sobald wir uns weit genug umschauen, um
allgemeine Sätze aufstellen zu können, etwas verhältnismäßig Seltenes und in den
modernen Literaturen seit der Renaissance erst die Folge kumulierender Schriftbil-
dung; sie enthält wohl immer die Gefahr einer Abstumpfung des Formensinnes
und einer Auflösung der Formen.
Vietors Arbeit darf als ein Symptom gewertet werden des wiedererwachenden
Bedürfnisses nach Formreinheit und Stil. So wie der Verfasser sich gibt, überzeugt
er uns davon, daß dieses Bedürfnis sein eigenes ist. Er hat ein sehr persönliches
Verhältnis zu seinem aristokratischen Gegenstand und sagt über ihn manches Feine.
Mit künstlerischer Liebe kennzeichnet er seine Helden: Celtis, Balde, Weckherlin,
Gryphius, Klopstock, Hölderlin, wobei auch die beleuchtende Anekdote Verwendung
findet, sparsam jedoch und gern aus entlegener Quelle geschöpft. Die Belesenheit,
die sich in den Noten mehr verbirgt als zur Schau stellt, ist ansehnlich; sie umfaßt
auch die lateinische Poesie der Humanisten, von deren Schwierigkeiten der Leser
Karl Vietor, Geschichte der deutschen Ode. (Geschichte der deutschen
Literatur nach Gattungen. Bd. I.) München 1923, Drei Masken-Verlag. 198 S. 8".
Die deutsche Literaturgeschichte gattungsmäßig zu zerlegen und so monogra-
phisch darzustellen, ist ein sehr guter Gedanke, doppelt anerkennenswert bei einem
Forscher, dessen Interesse und Kenntnisse sich auf die neuere Literatur konzen-
trieren, für welche die Gattungen wenig mehr bedeuten; er spricht selbst von dem
verworrenen Zustand dieser in der Gegenwart und nennt ihn »das Gegenspiel der
allgemeinen Gefühllosigkeit für das Wesen der überkommenen Form überhaupt^,
ja, er geht so weit, zu behaupten, das gattungsmäßige Element habe in der abend-
ländischen Literatur« sich nie so kräftig und beherrschend ausgewirkt wie in der
antiken. Die Antike als Mutterboden der Frage- und Aufgabestellung wäre also
klar, auch wenn der erste Band des Unternehmens nicht der Ode gälte, mithin dem
Fortleben eines pindarischen und eines horazischen Typus. Der Verfasser gedenkt
wiederholt der Gedrungenheit und Urbanität des Horaz. Sein Ausgangspunkt scheint
jedoch Hölderlin zu sein, über dessen Lyrik er 1921 ein Buch veröffentlicht hat, und
der in seiner jetzigen Darstellung — verdientermaßen, wenn auch mit allzu starker
Drückung Platens — den Gipfel bildet. Hölderlins Odendichtung führt von selbst
zur Antike und damit auf die Begriffe der poetischen Gattung und ihrer Geschichte.
Eine ähnlich wichtige Rolle wie im alten Griechenland spielen diese Begriffe
übrigens im germanischen Altertum und auch noch im Mittelalter und in den ersten
Jahrhunderten der Neuzeit, bis um 1750 mit der massenhaften Herstellung gedruckter
Schönliteratur die Verwischung der dichterischen Kunstformen beginnt. Die Dich-
tung des germanischen Altertums läßt sich, abgesehen von den Skalden, überhaupt
nur gattungsmäßig auffassen und darstellen (A. Heusler, Altgermanische Dichtung, in
Walzels Handbuch der Literaturwissenschaft, 1923). Sie zeigt dabei, daß nicht -in
jeder Epoche der Dichter eine Fülle lebendig blühender Kunstformen vorfindet«,
sondern manchmal nur wenige, was übrigens auch die altgriechische Literatur-
geschichte zeigen kann. Die »Fülle« ist, sobald wir uns weit genug umschauen, um
allgemeine Sätze aufstellen zu können, etwas verhältnismäßig Seltenes und in den
modernen Literaturen seit der Renaissance erst die Folge kumulierender Schriftbil-
dung; sie enthält wohl immer die Gefahr einer Abstumpfung des Formensinnes
und einer Auflösung der Formen.
Vietors Arbeit darf als ein Symptom gewertet werden des wiedererwachenden
Bedürfnisses nach Formreinheit und Stil. So wie der Verfasser sich gibt, überzeugt
er uns davon, daß dieses Bedürfnis sein eigenes ist. Er hat ein sehr persönliches
Verhältnis zu seinem aristokratischen Gegenstand und sagt über ihn manches Feine.
Mit künstlerischer Liebe kennzeichnet er seine Helden: Celtis, Balde, Weckherlin,
Gryphius, Klopstock, Hölderlin, wobei auch die beleuchtende Anekdote Verwendung
findet, sparsam jedoch und gern aus entlegener Quelle geschöpft. Die Belesenheit,
die sich in den Noten mehr verbirgt als zur Schau stellt, ist ansehnlich; sie umfaßt
auch die lateinische Poesie der Humanisten, von deren Schwierigkeiten der Leser