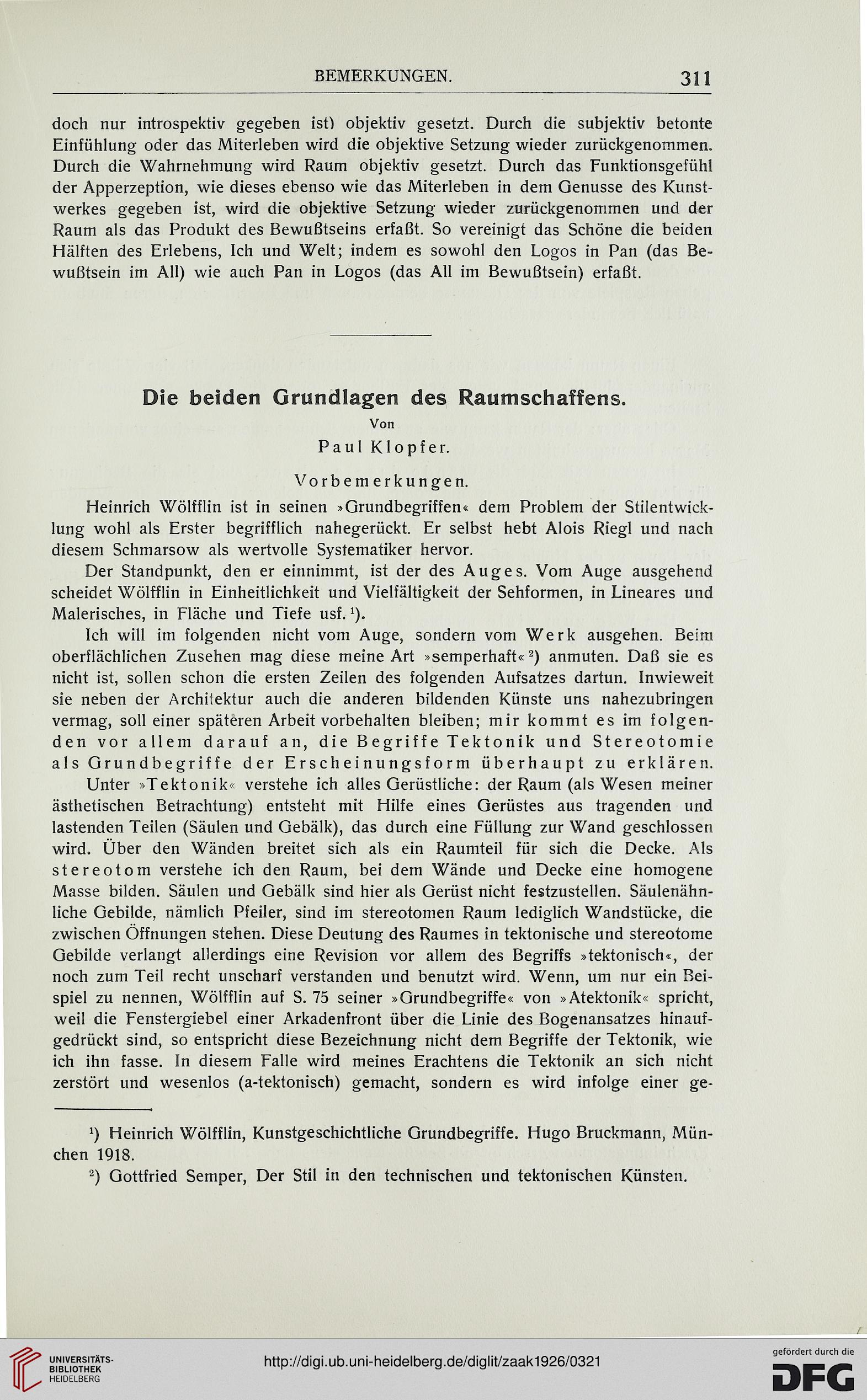BEMERKUNGEN.
311
doch nur introspektiv gegeben ist) objektiv gesetzt. Durch die subjektiv betonte
Einfühlung oder das Miterleben wird die objektive Setzung wieder zurückgenommen.
Durch die Wahrnehmung wird Raum objektiv gesetzt. Durch das Funktionsgefühl
der Apperzeption, wie dieses ebenso wie das Miterleben in dem Genüsse des Kunst-
werkes gegeben ist, wird die objektive Setzung wieder zurückgenommen und der
Raum als das Produkt des Bewußtseins erfaßt. So vereinigt das Schöne die beiden
Hälften des Erlebens, Ich und Welt; indem es sowohl den Logos in Pan (das Be-
wußtsein im All) wie auch Pan in Logos (das All im Bewußtsein) erfaßt.
Die beiden Grundlagen des Raum Schaffens.
Von
Paul Klopfer.
Vorbemerkungen.
Heinrich Wölfflin ist in seinen »Grundbegriffen« dem Problem der Stilentwick-
lung wohl als Erster begrifflich nahegerückt. Er selbst hebt Alois Riegl und nach
diesem Schmarsow als wertvolle Systematiker hervor.
Der Standpunkt, den er einnimmt, ist der des Auges. Vom Auge ausgehend
scheidet Wölfflin in Einheitlichkeit und Vielfältigkeit der Sehformen, in Lineares und
Malerisches, in Fläche und Tiefe usf.!).
Ich will im folgenden nicht vom Auge, sondern vom Werk ausgehen. Beim
oberflächlichen Zusehen mag diese meine Art »semperhaft«2) anmuten. Daß sie es
nicht ist, sollen schon die ersten Zeilen des folgenden Aufsatzes dartun. Inwieweit
sie neben der Architektur auch die anderen bildenden Künste uns nahezubringen
vermag, soll einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben; mir kommt es im folgen-
den vor allem darauf an, die Begriffe Tektonik und Stereotomie
als Grundbegriffe der Erscheinungsform überhaupt zu erklären.
Unter »Tektonik< verstehe ich alles Gerüstliche: der Raum (als Wesen meiner
ästhetischen Betrachtung) entsteht mit Hilfe eines Gerüstes aus tragenden und
lastenden Teilen (Säulen und Gebälk), das durch eine Füllung zur Wand geschlossen
wird. Über den Wänden breitet sich als ein Raumteil für sich die Decke. Als
stereotom verstehe ich den Raum, bei dem Wände und Decke eine homogene
Masse bilden. Säulen und Gebälk sind hier als Gerüst nicht festzustellen. Säulenähn-
liche Gebilde, nämlich Pfeiler, sind im stereotomen Raum lediglich Wandstücke, die
zwischen Öffnungen stehen. Diese Deutung des Raumes in tektonische und stereotome
Gebilde verlangt allerdings eine Revision vor allem des Begriffs »tektonisch«, der
noch zum Teil recht unscharf verstanden und benutzt wird. Wenn, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, Wölfflin auf S. 75 seiner »Grundbegriffe« von »Atektonik« spricht,
weil die Fenstergiebel einer Arkadenfront über die Linie des Bogenansatzes hinauf-
gedrückt sind, so entspricht diese Bezeichnung nicht dem Begriffe der Tektonik, wie
ich ihn fasse. In diesem Falle wird meines Erachtens die Tektonik an sich nicht
zerstört und wesenlos (a-tektonisch) gemacht, sondern es wird infolge einer ge-
*) Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Hugo Bruckmann, Mün-
chen 1918.
2) Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten.
311
doch nur introspektiv gegeben ist) objektiv gesetzt. Durch die subjektiv betonte
Einfühlung oder das Miterleben wird die objektive Setzung wieder zurückgenommen.
Durch die Wahrnehmung wird Raum objektiv gesetzt. Durch das Funktionsgefühl
der Apperzeption, wie dieses ebenso wie das Miterleben in dem Genüsse des Kunst-
werkes gegeben ist, wird die objektive Setzung wieder zurückgenommen und der
Raum als das Produkt des Bewußtseins erfaßt. So vereinigt das Schöne die beiden
Hälften des Erlebens, Ich und Welt; indem es sowohl den Logos in Pan (das Be-
wußtsein im All) wie auch Pan in Logos (das All im Bewußtsein) erfaßt.
Die beiden Grundlagen des Raum Schaffens.
Von
Paul Klopfer.
Vorbemerkungen.
Heinrich Wölfflin ist in seinen »Grundbegriffen« dem Problem der Stilentwick-
lung wohl als Erster begrifflich nahegerückt. Er selbst hebt Alois Riegl und nach
diesem Schmarsow als wertvolle Systematiker hervor.
Der Standpunkt, den er einnimmt, ist der des Auges. Vom Auge ausgehend
scheidet Wölfflin in Einheitlichkeit und Vielfältigkeit der Sehformen, in Lineares und
Malerisches, in Fläche und Tiefe usf.!).
Ich will im folgenden nicht vom Auge, sondern vom Werk ausgehen. Beim
oberflächlichen Zusehen mag diese meine Art »semperhaft«2) anmuten. Daß sie es
nicht ist, sollen schon die ersten Zeilen des folgenden Aufsatzes dartun. Inwieweit
sie neben der Architektur auch die anderen bildenden Künste uns nahezubringen
vermag, soll einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben; mir kommt es im folgen-
den vor allem darauf an, die Begriffe Tektonik und Stereotomie
als Grundbegriffe der Erscheinungsform überhaupt zu erklären.
Unter »Tektonik< verstehe ich alles Gerüstliche: der Raum (als Wesen meiner
ästhetischen Betrachtung) entsteht mit Hilfe eines Gerüstes aus tragenden und
lastenden Teilen (Säulen und Gebälk), das durch eine Füllung zur Wand geschlossen
wird. Über den Wänden breitet sich als ein Raumteil für sich die Decke. Als
stereotom verstehe ich den Raum, bei dem Wände und Decke eine homogene
Masse bilden. Säulen und Gebälk sind hier als Gerüst nicht festzustellen. Säulenähn-
liche Gebilde, nämlich Pfeiler, sind im stereotomen Raum lediglich Wandstücke, die
zwischen Öffnungen stehen. Diese Deutung des Raumes in tektonische und stereotome
Gebilde verlangt allerdings eine Revision vor allem des Begriffs »tektonisch«, der
noch zum Teil recht unscharf verstanden und benutzt wird. Wenn, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, Wölfflin auf S. 75 seiner »Grundbegriffe« von »Atektonik« spricht,
weil die Fenstergiebel einer Arkadenfront über die Linie des Bogenansatzes hinauf-
gedrückt sind, so entspricht diese Bezeichnung nicht dem Begriffe der Tektonik, wie
ich ihn fasse. In diesem Falle wird meines Erachtens die Tektonik an sich nicht
zerstört und wesenlos (a-tektonisch) gemacht, sondern es wird infolge einer ge-
*) Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Hugo Bruckmann, Mün-
chen 1918.
2) Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten.