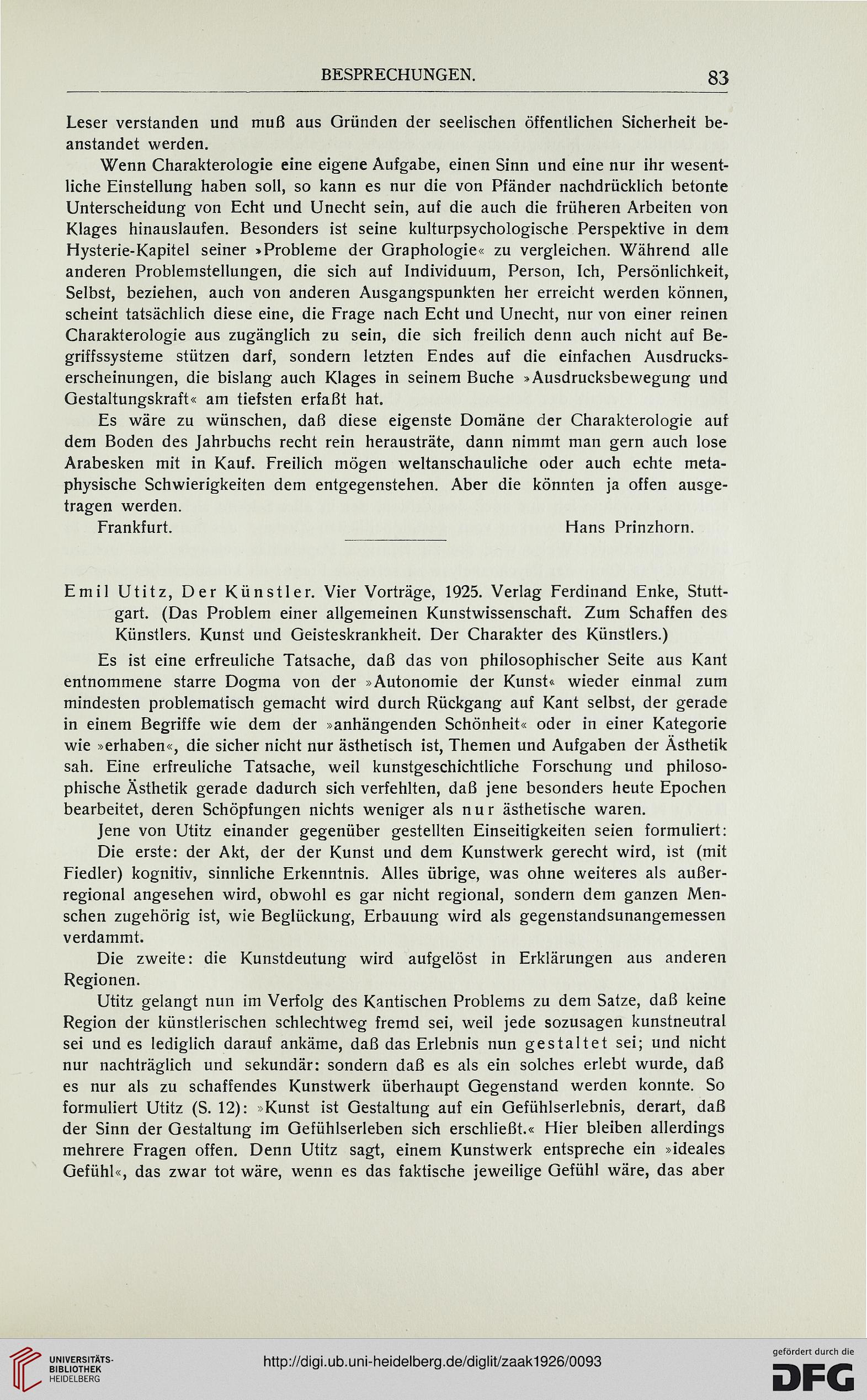BESPRECHUNGEN.
83
Leser verstanden und muß aus Gründen der seelischen öffentlichen Sicherheit be-
anstandet werden.
Wenn Charakterologie eine eigene Aufgabe, einen Sinn und eine nur ihr wesent-
liche Einstellung haben soll, so kann es nur die von Pfänder nachdrücklich betonte
Unterscheidung von Echt und Unecht sein, auf die auch die früheren Arbeiten von
Klages hinauslaufen. Besonders ist seine kulturpsychologische Perspektive in dem
Hysterie-Kapitel seiner »Probleme der Graphologie« zu vergleichen. Während alle
anderen Problemstellungen, die sich auf Individuum, Person, Ich, Persönlichkeit,
Selbst, beziehen, auch von anderen Ausgangspunkten her erreicht werden können,
scheint tatsächlich diese eine, die Frage nach Echt und Unecht, nur von einer reinen
Charakterologie aus zugänglich zu sein, die sich freilich denn auch nicht auf Be-
griffssysteme stützen darf, sondern letzten Endes auf die einfachen Ausdrucks-
erscheinungen, die bislang auch Klages in seinem Buche »Ausdrucksbewegung und
Gestaltungskraft« am tiefsten erfaßt hat.
Es wäre zu wünschen, daß diese eigenste Domäne der Charakterologie auf
dem Boden des Jahrbuchs recht rein herausträte, dann nimmt man gern auch lose
Arabesken mit in Kauf. Freilich mögen weltanschauliche oder auch echte meta-
physische Schwierigkeiten dem entgegenstehen. Aber die könnten ja offen ausge-
tragen werden.
Frankfurt. Hans Prinzhorn.
Emil Utitz, Der Künstler. Vier Vorträge, 1925. Verlag Ferdinand Enke, Stutt-
gart. (Das Problem einer allgemeinen Kunstwissenschaft. Zum Schaffen des
Künstlers. Kunst und Geisteskrankheit. Der Charakter des Künstlers.)
Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß das von philosophischer Seite aus Kant
entnommene starre Dogma von der »Autonomie der Kunst« wieder einmal zum
mindesten problematisch gemacht wird durch Rückgang auf Kant selbst, der gerade
in einem Begriffe wie dem der »anhängenden Schönheit« oder in einer Kategorie
wie »erhaben«, die sicher nicht nur ästhetisch ist, Themen und Aufgaben der Ästhetik
sah. Eine erfreuliche Tatsache, weil kunstgeschichtliche Forschung und philoso-
phische Ästhetik gerade dadurch sich verfehlten, daß jene besonders heute Epochen
bearbeitet, deren Schöpfungen nichts weniger als nur ästhetische waren.
Jene von Utitz einander gegenüber gestellten Einseitigkeiten seien formuliert:
Die erste: der Akt, der der Kunst und dem Kunstwerk gerecht wird, ist (mit
Fiedler) kognitiv, sinnliche Erkenntnis. Alles übrige, was ohne weiteres als außer-
regional angesehen wird, obwohl es gar nicht regional, sondern dem ganzen Men-
schen zugehörig ist, wie Beglückung, Erbauung wird als gegenstandsunangemessen
verdammt.
Die zweite: die Kunstdeutung wird aufgelöst in Erklärungen aus anderen
Regionen.
Utitz gelangt nun im Verfolg des Kantischen Problems zu dem Satze, daß keine
Region der künstlerischen schlechtweg fremd sei, weil jede sozusagen kunstneutral
sei und es lediglich darauf ankäme, daß das Erlebnis nun gestaltet sei; und nicht
nur nachträglich und sekundär: sondern daß es als ein solches erlebt wurde, daß
es nur als zu schaffendes Kunstwerk überhaupt Gegenstand werden konnte. So
formuliert Utitz (S. 12): »Kunst ist Gestaltung auf ein Gefühlserlebnis, derart, daß
der Sinn der Gestaltung im Gefühlserleben sich erschließt.« Hier bleiben allerdings
mehrere Fragen offen. Denn Utitz sagt, einem Kunstwerk entspreche ein »ideales
Gefühl«, das zwar tot wäre, wenn es das faktische jeweilige Gefühl wäre, das aber
83
Leser verstanden und muß aus Gründen der seelischen öffentlichen Sicherheit be-
anstandet werden.
Wenn Charakterologie eine eigene Aufgabe, einen Sinn und eine nur ihr wesent-
liche Einstellung haben soll, so kann es nur die von Pfänder nachdrücklich betonte
Unterscheidung von Echt und Unecht sein, auf die auch die früheren Arbeiten von
Klages hinauslaufen. Besonders ist seine kulturpsychologische Perspektive in dem
Hysterie-Kapitel seiner »Probleme der Graphologie« zu vergleichen. Während alle
anderen Problemstellungen, die sich auf Individuum, Person, Ich, Persönlichkeit,
Selbst, beziehen, auch von anderen Ausgangspunkten her erreicht werden können,
scheint tatsächlich diese eine, die Frage nach Echt und Unecht, nur von einer reinen
Charakterologie aus zugänglich zu sein, die sich freilich denn auch nicht auf Be-
griffssysteme stützen darf, sondern letzten Endes auf die einfachen Ausdrucks-
erscheinungen, die bislang auch Klages in seinem Buche »Ausdrucksbewegung und
Gestaltungskraft« am tiefsten erfaßt hat.
Es wäre zu wünschen, daß diese eigenste Domäne der Charakterologie auf
dem Boden des Jahrbuchs recht rein herausträte, dann nimmt man gern auch lose
Arabesken mit in Kauf. Freilich mögen weltanschauliche oder auch echte meta-
physische Schwierigkeiten dem entgegenstehen. Aber die könnten ja offen ausge-
tragen werden.
Frankfurt. Hans Prinzhorn.
Emil Utitz, Der Künstler. Vier Vorträge, 1925. Verlag Ferdinand Enke, Stutt-
gart. (Das Problem einer allgemeinen Kunstwissenschaft. Zum Schaffen des
Künstlers. Kunst und Geisteskrankheit. Der Charakter des Künstlers.)
Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß das von philosophischer Seite aus Kant
entnommene starre Dogma von der »Autonomie der Kunst« wieder einmal zum
mindesten problematisch gemacht wird durch Rückgang auf Kant selbst, der gerade
in einem Begriffe wie dem der »anhängenden Schönheit« oder in einer Kategorie
wie »erhaben«, die sicher nicht nur ästhetisch ist, Themen und Aufgaben der Ästhetik
sah. Eine erfreuliche Tatsache, weil kunstgeschichtliche Forschung und philoso-
phische Ästhetik gerade dadurch sich verfehlten, daß jene besonders heute Epochen
bearbeitet, deren Schöpfungen nichts weniger als nur ästhetische waren.
Jene von Utitz einander gegenüber gestellten Einseitigkeiten seien formuliert:
Die erste: der Akt, der der Kunst und dem Kunstwerk gerecht wird, ist (mit
Fiedler) kognitiv, sinnliche Erkenntnis. Alles übrige, was ohne weiteres als außer-
regional angesehen wird, obwohl es gar nicht regional, sondern dem ganzen Men-
schen zugehörig ist, wie Beglückung, Erbauung wird als gegenstandsunangemessen
verdammt.
Die zweite: die Kunstdeutung wird aufgelöst in Erklärungen aus anderen
Regionen.
Utitz gelangt nun im Verfolg des Kantischen Problems zu dem Satze, daß keine
Region der künstlerischen schlechtweg fremd sei, weil jede sozusagen kunstneutral
sei und es lediglich darauf ankäme, daß das Erlebnis nun gestaltet sei; und nicht
nur nachträglich und sekundär: sondern daß es als ein solches erlebt wurde, daß
es nur als zu schaffendes Kunstwerk überhaupt Gegenstand werden konnte. So
formuliert Utitz (S. 12): »Kunst ist Gestaltung auf ein Gefühlserlebnis, derart, daß
der Sinn der Gestaltung im Gefühlserleben sich erschließt.« Hier bleiben allerdings
mehrere Fragen offen. Denn Utitz sagt, einem Kunstwerk entspreche ein »ideales
Gefühl«, das zwar tot wäre, wenn es das faktische jeweilige Gefühl wäre, das aber