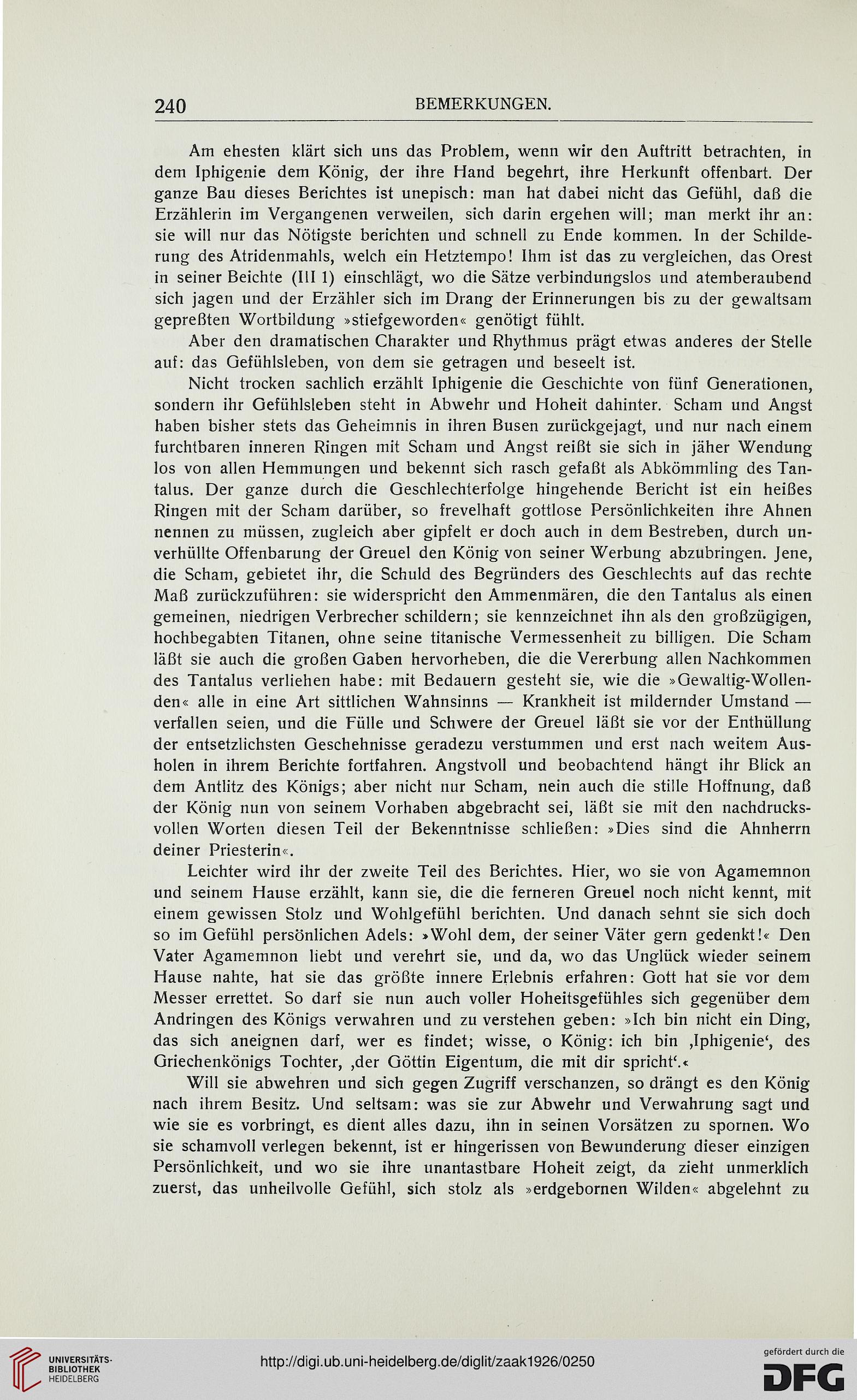240
BEMERKUNGEN.
Am ehesten klärt sich uns das Problem, wenn wir den Auftritt betrachten, in
dem Iphigenie dem König, der ihre Hand begehrt, ihre Herkunft offenbart. Der
ganze Bau dieses Berichtes ist unepisch: man hat dabei nicht das Gefühl, daß die
Erzählerin im Vergangenen verweilen, sich darin ergehen will; man merkt ihr an:
sie will nur das Nötigste berichten und schnell zu Ende kommen. In der Schilde-
rung des Atridenmahls, welch ein Hetztempo! Ihm ist das zu vergleichen, das Orest
in seiner Beichte (III 1) einschlägt, wo die Sätze verbindungslos und atemberaubend
sich jagen und der Erzähler sich im Drang der Erinnerungen bis zu der gewaltsam
gepreßten Wortbildung »stiefgeworden« genötigt fühlt.
Aber den dramatischen Charakter und Rhythmus prägt etwas anderes der Stelle
auf: das Gefühlsleben, von dem sie getragen und beseelt ist.
Nicht trocken sachlich erzählt Iphigenie die Geschichte von fünf Generationen,
sondern ihr Gefühlsleben steht in Abwehr und Hoheit dahinter. Scham und Angst
haben bisher stets das Geheimnis in ihren Busen zurückgejagt, und nur nach einem
furchtbaren inneren Ringen mit Scham und Angst reißt sie sich in jäher Wendung
los von allen Hemmungen und bekennt sich rasch gefaßt als Abkömmling des Tan-
talus. Der ganze durch die Geschlechterfolge hingehende Bericht ist ein heißes
Ringen mit der Scham darüber, so frevelhaft gottlose Persönlichkeiten ihre Ahnen
nennen zu müssen, zugleich aber gipfelt er doch auch in dem Bestreben, durch un-
verhüllte Offenbarung der Greuel den König von seiner Werbung abzubringen. Jene,
die Scham, gebietet ihr, die Schuld des Begründers des Geschlechts auf das rechte
Maß zurückzuführen: sie widerspricht den Ammenmären, die den Tantalus als einen
gemeinen, niedrigen Verbrecher schildern; sie kennzeichnet ihn als den großzügigen,
hochbegabten Titanen, ohne seine titanische Vermessenheit zu billigen. Die Scham
läßt sie auch die großen Gaben hervorheben, die die Vererbung allen Nachkommen
des Tantalus verliehen habe: mit Bedauern gesteht sie, wie die »Gewaltig-Wollen-
den« alle in eine Art sittlichen Wahnsinns — Krankheit ist mildernder Umstand —
verfallen seien, und die Fülle und Schwere der Greuel läßt sie vor der Enthüllung
der entsetzlichsten Geschehnisse geradezu verstummen und erst nach weitem Aus-
holen in ihrem Berichte fortfahren. Angstvoll und beobachtend hängt ihr Blick an
dem Antlitz des Königs; aber nicht nur Scham, nein auch die stille Hoffnung, daß
der König nun von seinem Vorhaben abgebracht sei, läßt sie mit den nachdrucks-
vollen Worten diesen Teil der Bekenntnisse schließen: »Dies sind die Ahnherrn
deiner Priesterin«.
Leichter wird ihr der zweite Teil des Berichtes. Hier, wo sie von Agamemnon
und seinem Hause erzählt, kann sie, die die ferneren Greuel noch nicht kennt, mit
einem gewissen Stolz und Wohlgefühl berichten. Und danach sehnt sie sich doch
so im Gefühl persönlichen Adels: »Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt!« Den
Vater Agamemnon liebt und verehrt sie, und da, wo das Unglück wieder seinem
Hause nahte, hat sie das größte innere Erlebnis erfahren: Gott hat sie vor dem
Messer errettet. So darf sie nun auch voller Hoheitsgefühles sich gegenüber dem
Andringen des Königs verwahren und zu verstehen geben: »Ich bin nicht ein Ding,
das sich aneignen darf, wer es findet; wisse, o König: ich bin Iphigenie', des
Griechenkönigs Tochter, ,der Göttin Eigentum, die mit dir spricht'.«
Will sie abwehren und sich gegen Zugriff verschanzen, so drängt es den König
nach ihrem Besitz. Und seltsam: was sie zur Abwehr und Verwahrung sagt und
wie sie es vorbringt, es dient alles dazu, ihn in seinen Vorsätzen zu spornen. Wo
sie schamvoll verlegen bekennt, ist er hingerissen von Bewunderung dieser einzigen
Persönlichkeit, und wo sie ihre unantastbare Hoheit zeigt, da zieht unmerklich
zuerst, das unheilvolle Gefühl, sich stolz als »erdgebornen Wilden« abgelehnt zu
BEMERKUNGEN.
Am ehesten klärt sich uns das Problem, wenn wir den Auftritt betrachten, in
dem Iphigenie dem König, der ihre Hand begehrt, ihre Herkunft offenbart. Der
ganze Bau dieses Berichtes ist unepisch: man hat dabei nicht das Gefühl, daß die
Erzählerin im Vergangenen verweilen, sich darin ergehen will; man merkt ihr an:
sie will nur das Nötigste berichten und schnell zu Ende kommen. In der Schilde-
rung des Atridenmahls, welch ein Hetztempo! Ihm ist das zu vergleichen, das Orest
in seiner Beichte (III 1) einschlägt, wo die Sätze verbindungslos und atemberaubend
sich jagen und der Erzähler sich im Drang der Erinnerungen bis zu der gewaltsam
gepreßten Wortbildung »stiefgeworden« genötigt fühlt.
Aber den dramatischen Charakter und Rhythmus prägt etwas anderes der Stelle
auf: das Gefühlsleben, von dem sie getragen und beseelt ist.
Nicht trocken sachlich erzählt Iphigenie die Geschichte von fünf Generationen,
sondern ihr Gefühlsleben steht in Abwehr und Hoheit dahinter. Scham und Angst
haben bisher stets das Geheimnis in ihren Busen zurückgejagt, und nur nach einem
furchtbaren inneren Ringen mit Scham und Angst reißt sie sich in jäher Wendung
los von allen Hemmungen und bekennt sich rasch gefaßt als Abkömmling des Tan-
talus. Der ganze durch die Geschlechterfolge hingehende Bericht ist ein heißes
Ringen mit der Scham darüber, so frevelhaft gottlose Persönlichkeiten ihre Ahnen
nennen zu müssen, zugleich aber gipfelt er doch auch in dem Bestreben, durch un-
verhüllte Offenbarung der Greuel den König von seiner Werbung abzubringen. Jene,
die Scham, gebietet ihr, die Schuld des Begründers des Geschlechts auf das rechte
Maß zurückzuführen: sie widerspricht den Ammenmären, die den Tantalus als einen
gemeinen, niedrigen Verbrecher schildern; sie kennzeichnet ihn als den großzügigen,
hochbegabten Titanen, ohne seine titanische Vermessenheit zu billigen. Die Scham
läßt sie auch die großen Gaben hervorheben, die die Vererbung allen Nachkommen
des Tantalus verliehen habe: mit Bedauern gesteht sie, wie die »Gewaltig-Wollen-
den« alle in eine Art sittlichen Wahnsinns — Krankheit ist mildernder Umstand —
verfallen seien, und die Fülle und Schwere der Greuel läßt sie vor der Enthüllung
der entsetzlichsten Geschehnisse geradezu verstummen und erst nach weitem Aus-
holen in ihrem Berichte fortfahren. Angstvoll und beobachtend hängt ihr Blick an
dem Antlitz des Königs; aber nicht nur Scham, nein auch die stille Hoffnung, daß
der König nun von seinem Vorhaben abgebracht sei, läßt sie mit den nachdrucks-
vollen Worten diesen Teil der Bekenntnisse schließen: »Dies sind die Ahnherrn
deiner Priesterin«.
Leichter wird ihr der zweite Teil des Berichtes. Hier, wo sie von Agamemnon
und seinem Hause erzählt, kann sie, die die ferneren Greuel noch nicht kennt, mit
einem gewissen Stolz und Wohlgefühl berichten. Und danach sehnt sie sich doch
so im Gefühl persönlichen Adels: »Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt!« Den
Vater Agamemnon liebt und verehrt sie, und da, wo das Unglück wieder seinem
Hause nahte, hat sie das größte innere Erlebnis erfahren: Gott hat sie vor dem
Messer errettet. So darf sie nun auch voller Hoheitsgefühles sich gegenüber dem
Andringen des Königs verwahren und zu verstehen geben: »Ich bin nicht ein Ding,
das sich aneignen darf, wer es findet; wisse, o König: ich bin Iphigenie', des
Griechenkönigs Tochter, ,der Göttin Eigentum, die mit dir spricht'.«
Will sie abwehren und sich gegen Zugriff verschanzen, so drängt es den König
nach ihrem Besitz. Und seltsam: was sie zur Abwehr und Verwahrung sagt und
wie sie es vorbringt, es dient alles dazu, ihn in seinen Vorsätzen zu spornen. Wo
sie schamvoll verlegen bekennt, ist er hingerissen von Bewunderung dieser einzigen
Persönlichkeit, und wo sie ihre unantastbare Hoheit zeigt, da zieht unmerklich
zuerst, das unheilvolle Gefühl, sich stolz als »erdgebornen Wilden« abgelehnt zu