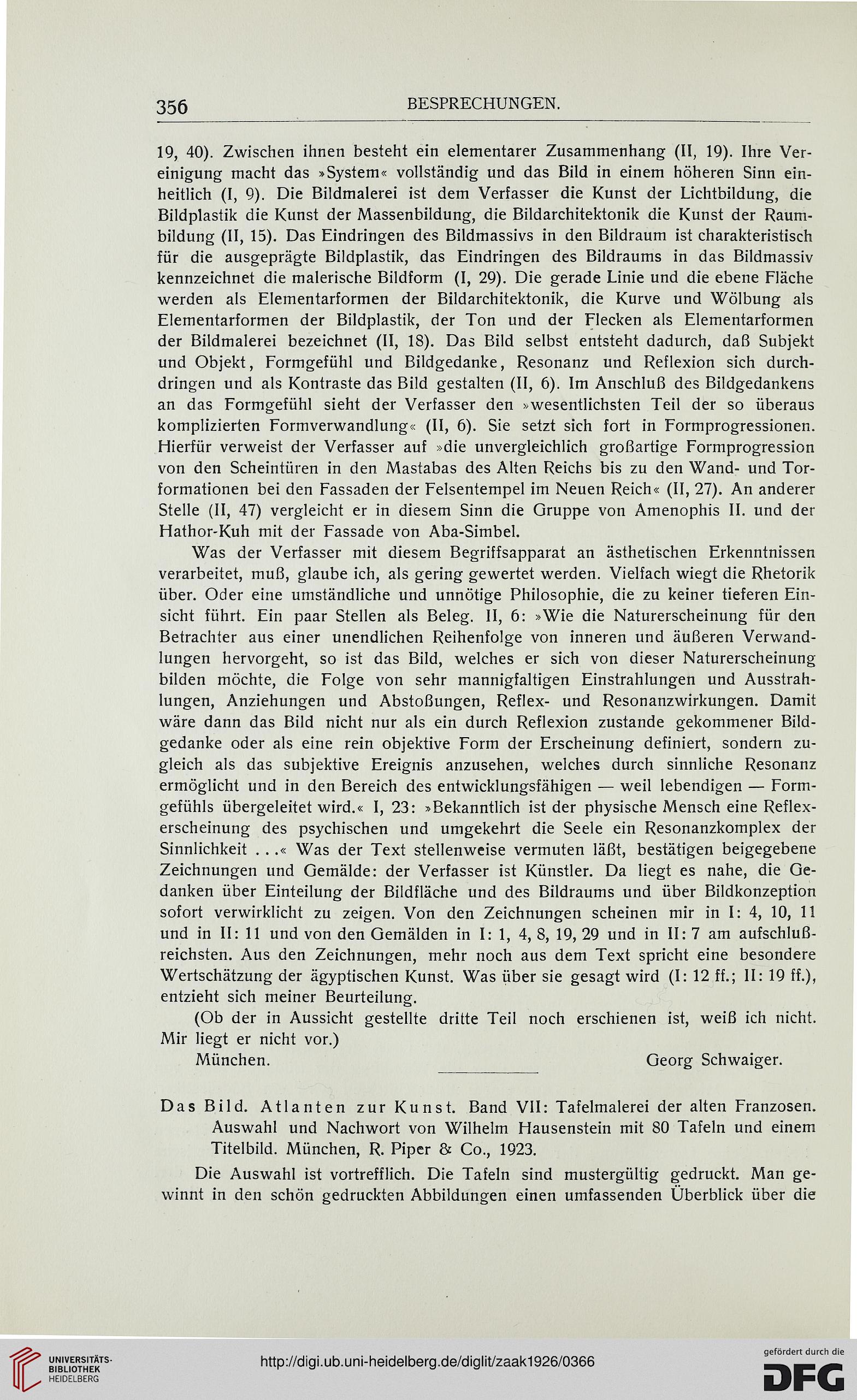356
BESPRECHUNGEN.
19, 40). Zwischen ihnen besteht ein elementarer Zusammenhang (II, 19). Ihre Ver-
einigung macht das »System« vollständig und das Bild in einem höheren Sinn ein-
heitlich (I, 9). Die Bildmalerei ist dem Verfasser die Kunst der Lichtbildung, die
Bildplastik die Kunst der Massenbildung, die Bildarchitektonik die Kunst der Raum-
bildung (II, 15). Das Eindringen des Bildmassivs in den Bildraum ist charakteristisch
für die ausgeprägte Bildplastik, das Eindringen des Bildraums in das Bildmassiv
kennzeichnet die malerische Bildform (I, 29). Die gerade Linie und die ebene Fläche
werden als Elementarformen der Bildarchitektonik, die Kurve und Wölbung als
Elementarformen der Bildplastik, der Ton und der Flecken als Elementarformen
der Bildmalerei bezeichnet (II, 18). Das Bild selbst entsteht dadurch, daß Subjekt
und Objekt, Formgefühl und Bildgedanke, Resonanz und Reflexion sich durch-
dringen und als Kontraste das Bild gestalten (II, 6). Im Anschluß des Bildgedankens
an das Formgefühl sieht der Verfasser den »wesentlichsten Teil der so überaus
komplizierten Formverwandlung« (II, 6). Sie setzt sich fort in Formprogressionen.
Hierfür verweist der Verfasser auf »die unvergleichlich großartige Formprogression
von den Scheintüren in den Mastabas des Alten Reichs bis zu den Wand- und Tor-
formationen bei den Fassaden der Felsentempel im Neuen Reich« (II, 27). An anderer
Stelle (II, 47) vergleicht er in diesem Sinn die Gruppe von Amenophis II. und der
Hathor-Kuh mit der Fassade von Aba-Simbel.
Was der Verfasser mit diesem Begriffsapparat an ästhetischen Erkenntnissen
verarbeitet, muß, glaube ich, als gering gewertet werden. Vielfach wiegt die Rhetorik
über. Oder eine umständliche und unnötige Philosophie, die zu keiner tieferen Ein-
sicht führt. Ein paar Stellen als Beleg. II, 6: »Wie die Naturerscheinung für den
Betrachter aus einer unendlichen Reihenfolge von inneren und äußeren Verwand-
lungen hervorgeht, so ist das Bild, welches er sich von dieser Naturerscheinung
bilden möchte, die Folge von sehr mannigfaltigen Einstrahlungen und Ausstrah-
lungen, Anziehungen und Abstoßungen, Reflex- und Resonanzwirkungen. Damit
wäre dann das Bild nicht nur als ein durch Reflexion zustande gekommener Bild-
gedanke oder als eine rein objektive Form der Erscheinung definiert, sondern zu-
gleich als das subjektive Ereignis anzusehen, welches durch sinnliche Resonanz
ermöglicht und in den Bereich des entwicklungsfähigen — weil lebendigen — Form-
gefühls übergeleitet wird.« I, 23: »Bekanntlich ist der physische Mensch eine Reflex-
erscheinung des psychischen und umgekehrt die Seele ein Resonanzkomplex der
Sinnlichkeit . ..« Was der Text stellenweise vermuten läßt, bestätigen beigegebene
Zeichnungen und Gemälde: der Verfasser ist Künstler. Da liegt es nahe, die Ge-
danken über Einteilung der Bildfläche und des Bildraums und über Bildkonzeption
sofort verwirklicht zu zeigen. Von den Zeichnungen scheinen mir in I: 4, 10, 11
und in II: 11 und von den Gemälden in 1:1, 4, 8, 19, 29 und in II: 7 am aufschluß-
reichsten. Aus den Zeichnungen, mehr noch aus dem Text spricht eine besondere
Wertschätzung der ägyptischen Kunst. Was über sie gesagt wird (I: 12 ff.; II: 19 ff.),
entzieht sich meiner Beurteilung.
(Ob der in Aussicht gestellte dritte Teil noch erschienen ist, weiß ich nicht.
Mir liegt er nicht vor.)
München. Georg Schwaiger.
Das Bild. Atlanten zur Kunst. Band VII: Tafelmalerei der alten Franzosen.
Auswahl und Nachwort von Wilhelm Hausenstein mit 80 Tafeln und einem
Titelbild. München, R. Piper & Co., 1923.
Die Auswahl ist vortrefflich. Die Tafeln sind mustergültig gedruckt. Man ge-
winnt in den schön gedruckten Abbildungen einen umfassenden Überblick über die
BESPRECHUNGEN.
19, 40). Zwischen ihnen besteht ein elementarer Zusammenhang (II, 19). Ihre Ver-
einigung macht das »System« vollständig und das Bild in einem höheren Sinn ein-
heitlich (I, 9). Die Bildmalerei ist dem Verfasser die Kunst der Lichtbildung, die
Bildplastik die Kunst der Massenbildung, die Bildarchitektonik die Kunst der Raum-
bildung (II, 15). Das Eindringen des Bildmassivs in den Bildraum ist charakteristisch
für die ausgeprägte Bildplastik, das Eindringen des Bildraums in das Bildmassiv
kennzeichnet die malerische Bildform (I, 29). Die gerade Linie und die ebene Fläche
werden als Elementarformen der Bildarchitektonik, die Kurve und Wölbung als
Elementarformen der Bildplastik, der Ton und der Flecken als Elementarformen
der Bildmalerei bezeichnet (II, 18). Das Bild selbst entsteht dadurch, daß Subjekt
und Objekt, Formgefühl und Bildgedanke, Resonanz und Reflexion sich durch-
dringen und als Kontraste das Bild gestalten (II, 6). Im Anschluß des Bildgedankens
an das Formgefühl sieht der Verfasser den »wesentlichsten Teil der so überaus
komplizierten Formverwandlung« (II, 6). Sie setzt sich fort in Formprogressionen.
Hierfür verweist der Verfasser auf »die unvergleichlich großartige Formprogression
von den Scheintüren in den Mastabas des Alten Reichs bis zu den Wand- und Tor-
formationen bei den Fassaden der Felsentempel im Neuen Reich« (II, 27). An anderer
Stelle (II, 47) vergleicht er in diesem Sinn die Gruppe von Amenophis II. und der
Hathor-Kuh mit der Fassade von Aba-Simbel.
Was der Verfasser mit diesem Begriffsapparat an ästhetischen Erkenntnissen
verarbeitet, muß, glaube ich, als gering gewertet werden. Vielfach wiegt die Rhetorik
über. Oder eine umständliche und unnötige Philosophie, die zu keiner tieferen Ein-
sicht führt. Ein paar Stellen als Beleg. II, 6: »Wie die Naturerscheinung für den
Betrachter aus einer unendlichen Reihenfolge von inneren und äußeren Verwand-
lungen hervorgeht, so ist das Bild, welches er sich von dieser Naturerscheinung
bilden möchte, die Folge von sehr mannigfaltigen Einstrahlungen und Ausstrah-
lungen, Anziehungen und Abstoßungen, Reflex- und Resonanzwirkungen. Damit
wäre dann das Bild nicht nur als ein durch Reflexion zustande gekommener Bild-
gedanke oder als eine rein objektive Form der Erscheinung definiert, sondern zu-
gleich als das subjektive Ereignis anzusehen, welches durch sinnliche Resonanz
ermöglicht und in den Bereich des entwicklungsfähigen — weil lebendigen — Form-
gefühls übergeleitet wird.« I, 23: »Bekanntlich ist der physische Mensch eine Reflex-
erscheinung des psychischen und umgekehrt die Seele ein Resonanzkomplex der
Sinnlichkeit . ..« Was der Text stellenweise vermuten läßt, bestätigen beigegebene
Zeichnungen und Gemälde: der Verfasser ist Künstler. Da liegt es nahe, die Ge-
danken über Einteilung der Bildfläche und des Bildraums und über Bildkonzeption
sofort verwirklicht zu zeigen. Von den Zeichnungen scheinen mir in I: 4, 10, 11
und in II: 11 und von den Gemälden in 1:1, 4, 8, 19, 29 und in II: 7 am aufschluß-
reichsten. Aus den Zeichnungen, mehr noch aus dem Text spricht eine besondere
Wertschätzung der ägyptischen Kunst. Was über sie gesagt wird (I: 12 ff.; II: 19 ff.),
entzieht sich meiner Beurteilung.
(Ob der in Aussicht gestellte dritte Teil noch erschienen ist, weiß ich nicht.
Mir liegt er nicht vor.)
München. Georg Schwaiger.
Das Bild. Atlanten zur Kunst. Band VII: Tafelmalerei der alten Franzosen.
Auswahl und Nachwort von Wilhelm Hausenstein mit 80 Tafeln und einem
Titelbild. München, R. Piper & Co., 1923.
Die Auswahl ist vortrefflich. Die Tafeln sind mustergültig gedruckt. Man ge-
winnt in den schön gedruckten Abbildungen einen umfassenden Überblick über die