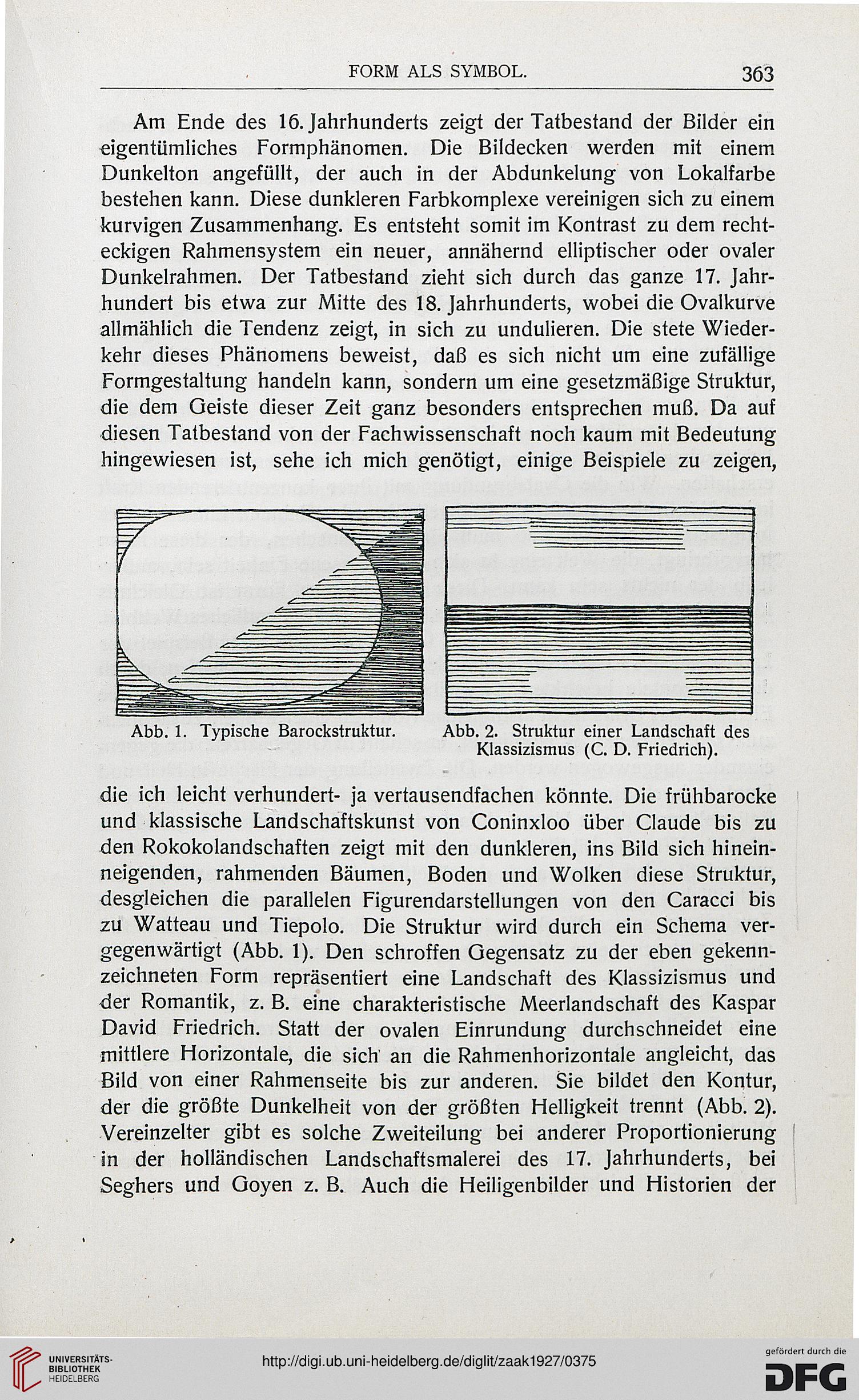FORM ALS SYMBOL.
363
Am Ende des 16. Jahrhunderts zeigt der Tatbestand der Bilder ein
eigentümliches Formphänomen. Die Bildecken werden mit einem
Dunkelton angefüllt, der auch in der Abdunkelung von Lokalfarbe
bestehen kann. Diese dunkleren Farbkomplexe vereinigen sich zu einem
kurvigen Zusammenhang. Es entsteht somit im Kontrast zu dem recht-
eckigen Rahmensystem ein neuer, annähernd elliptischer oder ovaler
Dunkelrahmen. Der Tatbestand zieht sich durch das ganze 17. Jahr-
hundert bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wobei die Ovalkurve
allmählich die Tendenz zeigt, in sich zu undulieren. Die stete Wieder-
kehr dieses Phänomens beweist, daß es sich nicht um eine zufällige
Formgestaltung handeln kann, sondern um eine gesetzmäßige Struktur,
die dem Geiste dieser Zeit ganz besonders entsprechen muß. Da auf
diesen Tatbestand von der Fachwissenschaft noch kaum mit Bedeutung
hingewiesen ist, sehe ich mich genötigt, einige Beispiele zu zeigen,
Abb. 1. Typische Barockstruktur. Abb. 2. Struktur einer Landschaft des
Klassizismus (C. D. Friedrich).
die ich leicht verhundert- ja vertausendfachen könnte. Die frühbarocke
und klassische Landschaftskunst von Coninxloo über Claude bis zu
den Rokokolandschaften zeigt mit den dunkleren, ins Bild sich hinein-
neigenden, rahmenden Bäumen, Boden und Wolken diese Struktur,
desgleichen die parallelen Figurendarstellungen von den Caracci bis
zu Watteau und Tiepolo. Die Struktur wird durch ein Schema ver-
gegenwärtigt (Abb. 1). Den schroffen Gegensatz zu der eben gekenn-
zeichneten Form repräsentiert eine Landschaft des Klassizismus und
der Romantik, z. B. eine charakteristische Meerlandschaft des Kaspar
David Friedrich. Statt der ovalen Einrundung durchschneidet eine
mittlere Horizontale, die sich an die Rahmenhorizontale angleicht, das
Bild von einer Rahmenseite bis zur anderen. Sie bildet den Kontur,
der die größte Dunkelheit von der größten Helligkeit trennt (Abb. 2).
Vereinzelter gibt es solche Zweiteilung bei anderer Proportionierung
in der holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts, bei
Seghers und Goyen z. B. Auch die Heiligenbilder und Historien der
363
Am Ende des 16. Jahrhunderts zeigt der Tatbestand der Bilder ein
eigentümliches Formphänomen. Die Bildecken werden mit einem
Dunkelton angefüllt, der auch in der Abdunkelung von Lokalfarbe
bestehen kann. Diese dunkleren Farbkomplexe vereinigen sich zu einem
kurvigen Zusammenhang. Es entsteht somit im Kontrast zu dem recht-
eckigen Rahmensystem ein neuer, annähernd elliptischer oder ovaler
Dunkelrahmen. Der Tatbestand zieht sich durch das ganze 17. Jahr-
hundert bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wobei die Ovalkurve
allmählich die Tendenz zeigt, in sich zu undulieren. Die stete Wieder-
kehr dieses Phänomens beweist, daß es sich nicht um eine zufällige
Formgestaltung handeln kann, sondern um eine gesetzmäßige Struktur,
die dem Geiste dieser Zeit ganz besonders entsprechen muß. Da auf
diesen Tatbestand von der Fachwissenschaft noch kaum mit Bedeutung
hingewiesen ist, sehe ich mich genötigt, einige Beispiele zu zeigen,
Abb. 1. Typische Barockstruktur. Abb. 2. Struktur einer Landschaft des
Klassizismus (C. D. Friedrich).
die ich leicht verhundert- ja vertausendfachen könnte. Die frühbarocke
und klassische Landschaftskunst von Coninxloo über Claude bis zu
den Rokokolandschaften zeigt mit den dunkleren, ins Bild sich hinein-
neigenden, rahmenden Bäumen, Boden und Wolken diese Struktur,
desgleichen die parallelen Figurendarstellungen von den Caracci bis
zu Watteau und Tiepolo. Die Struktur wird durch ein Schema ver-
gegenwärtigt (Abb. 1). Den schroffen Gegensatz zu der eben gekenn-
zeichneten Form repräsentiert eine Landschaft des Klassizismus und
der Romantik, z. B. eine charakteristische Meerlandschaft des Kaspar
David Friedrich. Statt der ovalen Einrundung durchschneidet eine
mittlere Horizontale, die sich an die Rahmenhorizontale angleicht, das
Bild von einer Rahmenseite bis zur anderen. Sie bildet den Kontur,
der die größte Dunkelheit von der größten Helligkeit trennt (Abb. 2).
Vereinzelter gibt es solche Zweiteilung bei anderer Proportionierung
in der holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts, bei
Seghers und Goyen z. B. Auch die Heiligenbilder und Historien der