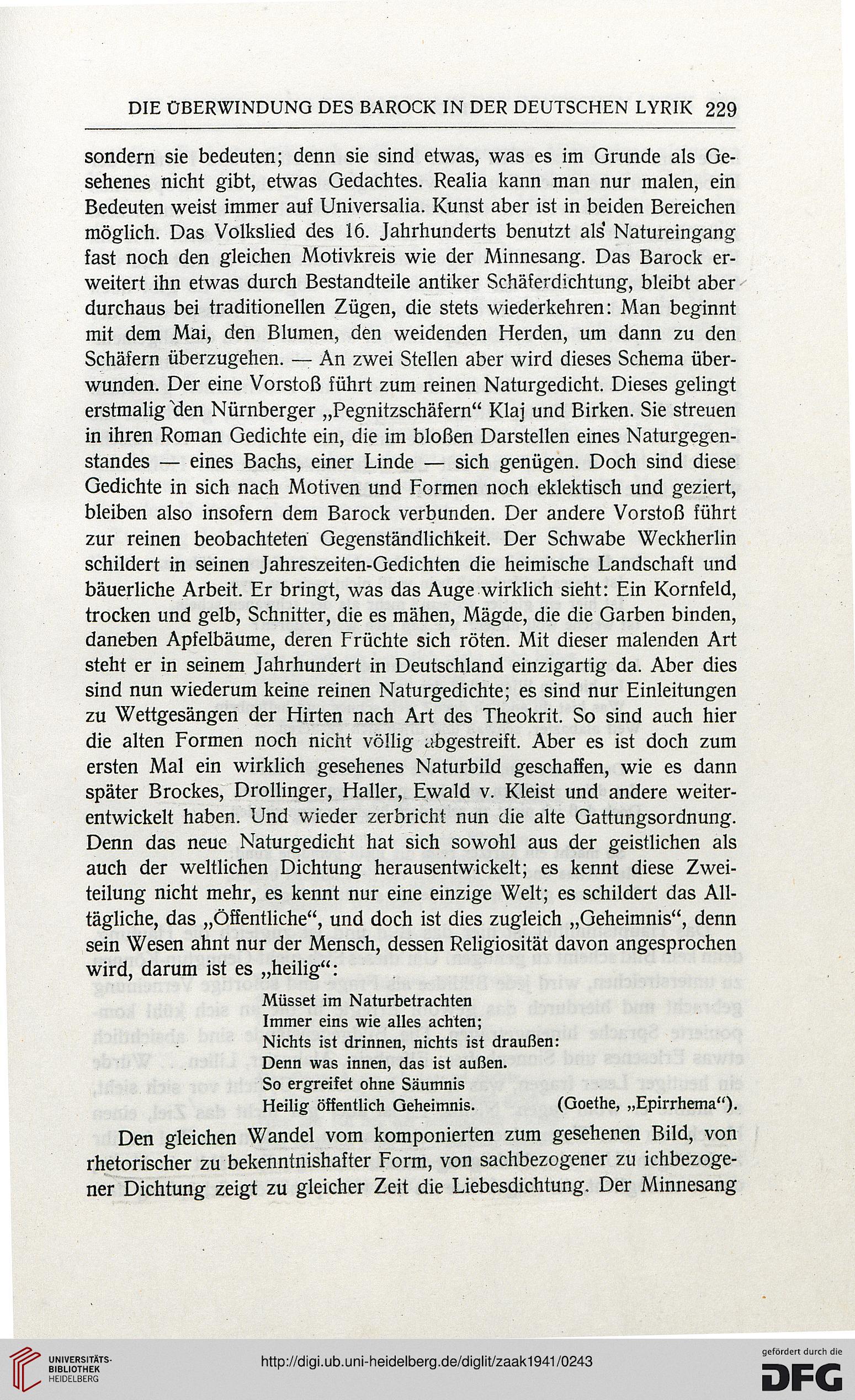DIE ÜBERWINDUNG DES BAROCK IN DER DEUTSCHEN LYRIK 229
sondern sie bedeuten; denn sie sind etwas, was es im Grunde als Ge-
sehenes nicht gibt, etwas Gedachtes. Realia kann man nur malen, ein
Bedeuten weist immer auf Universalia. Kunst aber ist in beiden Bereichen
möglich. Das Volkslied des 16. Jahrhunderts benutzt als Natureingang
fast noch den gleichen Motivkreis wie der Minnesang. Das Barock er-
weitert ihn etwas durch Bestandteile antiker Schäferdichtung, bleibt aber
durchaus bei traditionellen Zügen, die stets wiederkehren: Man beginnt
mit dem Mai, den Blumen, den weidenden Herden, um dann zu den
Schäfern überzugehen. — An zwei Stellen aber wird dieses Schema über-
wunden. Der eine Vorstoß führt zum reinen Naturgedicht. Dieses gelingt
erstmalig "den Nürnberger „Pegnitzschäfern" Klaj und Birken. Sie streuen
in ihren Roman Gedichte ein, die im bloßen Darstellen eines Naturgegen-
standes — eines Bachs, einer Linde — sich genügen. Doch sind diese
Gedichte in sich nach Motiven und Formen noch eklektisch und geziert,
bleiben also insofern dem Barock verbunden. Der andere Vorstoß führt
zur reinen beobachteten Gegenständlichkeit. Der Schwabe Weckherlin
schildert in seinen Jahreszeiten-Gedichten die heimische Landschaft und
bäuerliche Arbeit. Er bringt, was das Auge wirklich sieht: Ein Kornfeld,
trocken und gelb, Schnitter, die es mähen, Mägde, die die Garben binden,
daneben Apfelbäume, deren Früchte sich röten. Mit dieser malenden Art
steht er in seinem Jahrhundert in Deutschland einzigartig da. Aber dies
sind nun wiederum keine reinen Naturgedichte; es sind nur Einleitungen
zu Wettgesängen der Hirten nach Art des Theokrit. So sind auch hier
die alten Formen noch nicht völlig abgestreift. Aber es ist doch zum
ersten Mal ein wirklich gesehenes Naturbild geschaffen, wie es dann
später Brockes, Drollinger, Haller, Ewald v. Kleist und andere weiter-
entwickelt haben. Und wieder zerbricht nun die alte Gattungsordnung.
Denn das neue Naturgedicht hat sich sowohl aus der geistlichen als
auch der weltlichen Dichtung herausentwickelt; es kennt diese Zwei-
teilung nicht mehr, es kennt nur eine einzige Welt; es schildert das All-
tägliche, das „Öffentliche", und doch ist dies zugleich „Geheimnis", denn
sein Wesen ahnt nur der Mensch, dessen Religiosität davon angesprochen
wird, darum ist es „heilig":
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten;
: Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis. (Goethe, „Epirrhema").
Den gleichen Wandel vom komponierten zum gesehenen Bild, von
rhetorischer zu bekenntnishafter Form, von sachbezogener zu ichbezoge-
ner Dichtung zeigt zu gleicher Zeit die Liebesdichtung. Der Minnesang
sondern sie bedeuten; denn sie sind etwas, was es im Grunde als Ge-
sehenes nicht gibt, etwas Gedachtes. Realia kann man nur malen, ein
Bedeuten weist immer auf Universalia. Kunst aber ist in beiden Bereichen
möglich. Das Volkslied des 16. Jahrhunderts benutzt als Natureingang
fast noch den gleichen Motivkreis wie der Minnesang. Das Barock er-
weitert ihn etwas durch Bestandteile antiker Schäferdichtung, bleibt aber
durchaus bei traditionellen Zügen, die stets wiederkehren: Man beginnt
mit dem Mai, den Blumen, den weidenden Herden, um dann zu den
Schäfern überzugehen. — An zwei Stellen aber wird dieses Schema über-
wunden. Der eine Vorstoß führt zum reinen Naturgedicht. Dieses gelingt
erstmalig "den Nürnberger „Pegnitzschäfern" Klaj und Birken. Sie streuen
in ihren Roman Gedichte ein, die im bloßen Darstellen eines Naturgegen-
standes — eines Bachs, einer Linde — sich genügen. Doch sind diese
Gedichte in sich nach Motiven und Formen noch eklektisch und geziert,
bleiben also insofern dem Barock verbunden. Der andere Vorstoß führt
zur reinen beobachteten Gegenständlichkeit. Der Schwabe Weckherlin
schildert in seinen Jahreszeiten-Gedichten die heimische Landschaft und
bäuerliche Arbeit. Er bringt, was das Auge wirklich sieht: Ein Kornfeld,
trocken und gelb, Schnitter, die es mähen, Mägde, die die Garben binden,
daneben Apfelbäume, deren Früchte sich röten. Mit dieser malenden Art
steht er in seinem Jahrhundert in Deutschland einzigartig da. Aber dies
sind nun wiederum keine reinen Naturgedichte; es sind nur Einleitungen
zu Wettgesängen der Hirten nach Art des Theokrit. So sind auch hier
die alten Formen noch nicht völlig abgestreift. Aber es ist doch zum
ersten Mal ein wirklich gesehenes Naturbild geschaffen, wie es dann
später Brockes, Drollinger, Haller, Ewald v. Kleist und andere weiter-
entwickelt haben. Und wieder zerbricht nun die alte Gattungsordnung.
Denn das neue Naturgedicht hat sich sowohl aus der geistlichen als
auch der weltlichen Dichtung herausentwickelt; es kennt diese Zwei-
teilung nicht mehr, es kennt nur eine einzige Welt; es schildert das All-
tägliche, das „Öffentliche", und doch ist dies zugleich „Geheimnis", denn
sein Wesen ahnt nur der Mensch, dessen Religiosität davon angesprochen
wird, darum ist es „heilig":
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten;
: Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis. (Goethe, „Epirrhema").
Den gleichen Wandel vom komponierten zum gesehenen Bild, von
rhetorischer zu bekenntnishafter Form, von sachbezogener zu ichbezoge-
ner Dichtung zeigt zu gleicher Zeit die Liebesdichtung. Der Minnesang