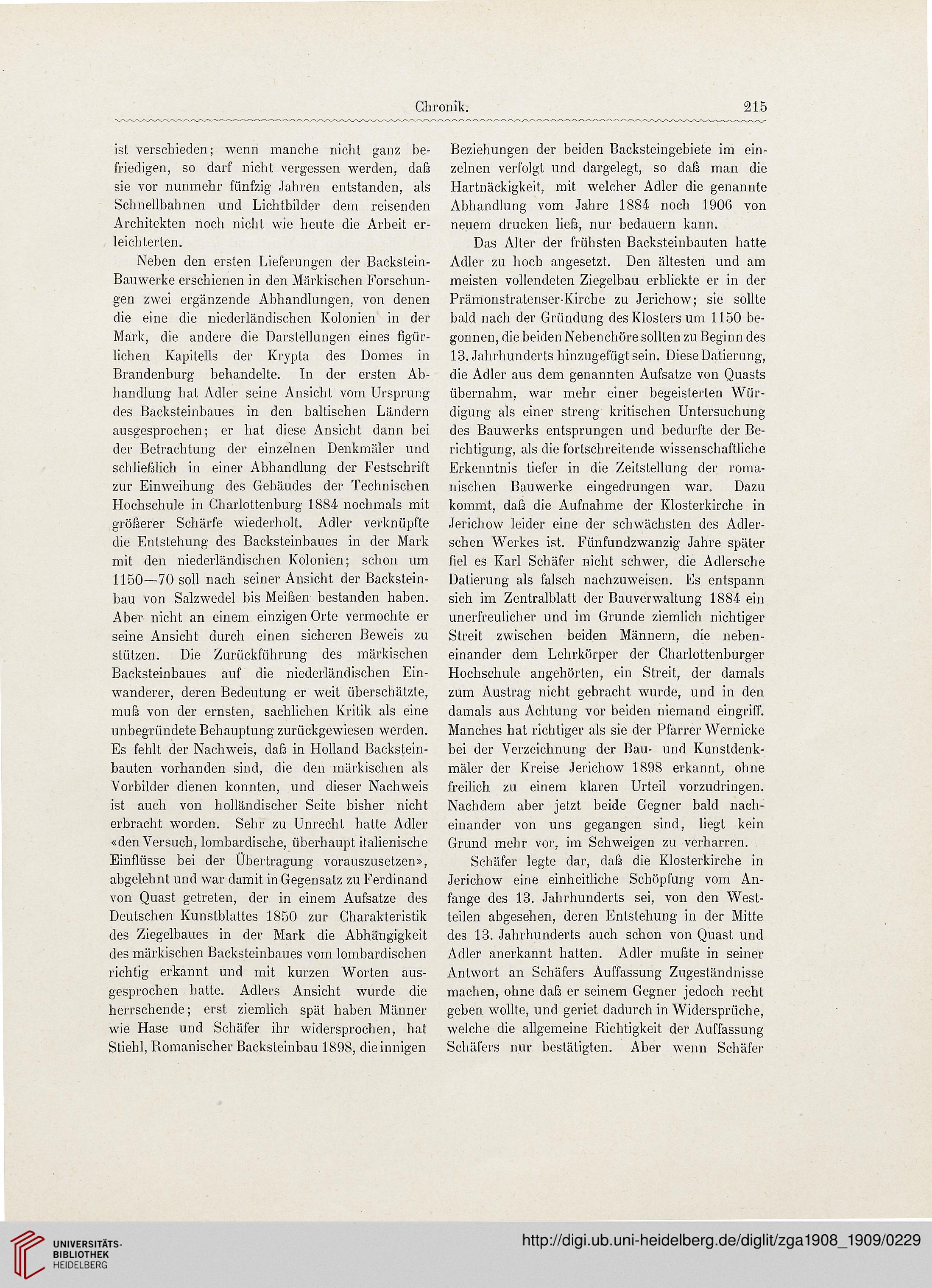Chronik.
215
ist verschieden; wenn manche nicht ganz be-
friedigen, so darf nicht vergessen werden, daß
sie vor nunmehr fünfzig Jahren entstanden, als
Schnellbahnen und Lichtbilder dem reisenden
Architekten noch nicht wie heute die Arbeit er-
leichterten.
Neben den ersten Lieferungen der Backstein-
Bauwerke erschienen in den Märkischen Forschun-
gen zwei ergänzende Abhandlungen, von denen
die eine die niederländischen Kolonien in der
Mark, die andere die Darstellungen eines figür-
lichen Kapitells der Krypta des Domes in
Brandenburg behandelte. In der ersten Ab-
handlung hat Adler seine Ansicht vom Ursprung
des Backsteinbaues in den baltischen Ländern
ausgesprochen; er hat diese Ansicht dann bei
der Betrachtung der einzelnen Denkmäler und
schließlich in einer Abhandlung der Festschrift
zur Einweihung des Gebäudes der Technischen
Hochschule in Charlottenburg 18S4 nochmals mit
größerer Schärfe wiederholt. Adler verknüpfte
die Entstehung des Backsteinbaues in der Mark
mit den niederländischen Kolonien; schon um
1150—70 soll nach seiner Ansicht der Backstein-
bau von Salzwedel bis Meißen bestanden haben.
Aber nicht an einem einzigen Orte vermochte ei-
serne Ansicht durch einen sicheren Beweis zu
stützen. Die Zurückführung des märkischen
Backsteinbaues auf die niederländischen Ein-
wanderer, deren Bedeutung er weit überschätzte,
muß von der ernsten, sachlichen Kritik als eine
unbegründete Behauptung zurückgewiesen werden.
Es fehlt der Nachweis, daß in Holland Backstein-
bauten vorhanden sind, die den märkischen als
Vorbilder dienen konnten, und dieser Nachweis
ist auch von holländischer Seite bisher nicht
erbracht worden. Sehr zu Unrecht hatte Adler
«den Versuch, lombardische, überhaupt italienische
Einflüsse bei der Übertragung vorauszusetzen»,
abgelehnt und war damit in Gegensatz zu Ferdinand
von Quast getreten, der in einem Aufsatze des
Deutschen Kunstblattes 1850 zur Charakteristik
des Ziegelbaues in der Mark die Abhängigkeit
des märkischen Backsteinbaues vom lombardischen
richtig erkannt und mit kurzen Worten aus-
gesprochen hatte. Adlers Ansicht wurde die
herrschende; erst ziemlich spät haben Männer
wie Hase und Schäfer ihr widersprochen, hat
Stiehl, Romanischer Backsteinbau 1898, die innigen
Beziehungen der beiden Backsteingebiete im ein-
zelnen verfolgt und dargelegt, so daß man die
Hartnäckigkeit, mit welcher Adler die genannte
Abhandlung vom Jahre 1884 noch 190G von
neuern drucken ließ, nur bedauern kann.
Das Alter der frühsten Backsteinbauten hatte
Adler zu hoch angesetzt. Den ältesten und am
meisten vollendeten Ziegelbau erblickte er in der
Prämonstratenser-Kirche zu Jerichow; sie sollte
bald nach der Gründung des Klosters um 1150 be-
gonnen, die beiden Nebenchöre sollten zu Beginn des
13. Jahrhunderts hinzugefügt sein. Diese Datierung,
die Adler aus dem genannten Aufsatze von Quasts
übernahm, war mehr einer begeisterten Wür-
digung als einer streng kritischen Untersuchung
des Bauwerks entsprungen und bedurfte der Be-
richtigung, als die fortschreitende wissenschaftliche
Erkenntnis tiefer in die Zeitstellung der roma-
nischen Bauwerke eingedrungen war. Dazu
kommt, daß die Aufnahme der Klosterkirche in
Jerichow leider eine der schwächsten des Adler-
schen Werkes ist. Fünfundzwanzig Jahre später
fiel es Karl Schäfer nicht schwer, die Adlersche
Datierung als falsch nachzuweisen. Es entspann
sich im Zentralblatt der Bauverwaltung 1884 ein
unerfreulicher und im Grunde ziemlich nichtiger
Streit zwischen beiden Männern, die neben-
einander dem Lehrkörper der Charlottenburger
Hochschule angehörten, ein Streit, der damals
zum Austrag nicht gebracht wurde, und in den
damals aus Achtung vor beiden niemand eingriff.
Manches hat richtiger als sie der Pfarrer Wernicke
bei der Verzeichnung der Bau- und Kunstdenk-
mäler der Kreise Jerichow 1898 erkannt, ohne
freilich zu einem klaren Urteil vorzudringen.
Nachdem aber jetzt beide Gegner bald nach-
einander von uns gegangen sind, liegt kein
Grund mehr vor, im Schweigen zu verharren.
Schäfer legte dar, daß die Klosterkirche in
Jerichow eine einheitliche Schöpfung vom An-
fange des 13. Jahrhunderts sei, von den West-
teilen abgesehen, deren Entstehung in der Mitte
des 13. Jahrhunderts auch schon von Quast und
Adler anerkannt hatten. Adler mußte in seiner
Antwort an Schäfers Auffassung Zugeständnisse
machen, ohne daß er seinem Gegner jedoch recht
geben wollte, und geriet dadurch in Widersprüche,
welche die allgemeine Richtigkeit der Auffassung
Schäfers nur bestätigten. Aber wenn Schäfer
215
ist verschieden; wenn manche nicht ganz be-
friedigen, so darf nicht vergessen werden, daß
sie vor nunmehr fünfzig Jahren entstanden, als
Schnellbahnen und Lichtbilder dem reisenden
Architekten noch nicht wie heute die Arbeit er-
leichterten.
Neben den ersten Lieferungen der Backstein-
Bauwerke erschienen in den Märkischen Forschun-
gen zwei ergänzende Abhandlungen, von denen
die eine die niederländischen Kolonien in der
Mark, die andere die Darstellungen eines figür-
lichen Kapitells der Krypta des Domes in
Brandenburg behandelte. In der ersten Ab-
handlung hat Adler seine Ansicht vom Ursprung
des Backsteinbaues in den baltischen Ländern
ausgesprochen; er hat diese Ansicht dann bei
der Betrachtung der einzelnen Denkmäler und
schließlich in einer Abhandlung der Festschrift
zur Einweihung des Gebäudes der Technischen
Hochschule in Charlottenburg 18S4 nochmals mit
größerer Schärfe wiederholt. Adler verknüpfte
die Entstehung des Backsteinbaues in der Mark
mit den niederländischen Kolonien; schon um
1150—70 soll nach seiner Ansicht der Backstein-
bau von Salzwedel bis Meißen bestanden haben.
Aber nicht an einem einzigen Orte vermochte ei-
serne Ansicht durch einen sicheren Beweis zu
stützen. Die Zurückführung des märkischen
Backsteinbaues auf die niederländischen Ein-
wanderer, deren Bedeutung er weit überschätzte,
muß von der ernsten, sachlichen Kritik als eine
unbegründete Behauptung zurückgewiesen werden.
Es fehlt der Nachweis, daß in Holland Backstein-
bauten vorhanden sind, die den märkischen als
Vorbilder dienen konnten, und dieser Nachweis
ist auch von holländischer Seite bisher nicht
erbracht worden. Sehr zu Unrecht hatte Adler
«den Versuch, lombardische, überhaupt italienische
Einflüsse bei der Übertragung vorauszusetzen»,
abgelehnt und war damit in Gegensatz zu Ferdinand
von Quast getreten, der in einem Aufsatze des
Deutschen Kunstblattes 1850 zur Charakteristik
des Ziegelbaues in der Mark die Abhängigkeit
des märkischen Backsteinbaues vom lombardischen
richtig erkannt und mit kurzen Worten aus-
gesprochen hatte. Adlers Ansicht wurde die
herrschende; erst ziemlich spät haben Männer
wie Hase und Schäfer ihr widersprochen, hat
Stiehl, Romanischer Backsteinbau 1898, die innigen
Beziehungen der beiden Backsteingebiete im ein-
zelnen verfolgt und dargelegt, so daß man die
Hartnäckigkeit, mit welcher Adler die genannte
Abhandlung vom Jahre 1884 noch 190G von
neuern drucken ließ, nur bedauern kann.
Das Alter der frühsten Backsteinbauten hatte
Adler zu hoch angesetzt. Den ältesten und am
meisten vollendeten Ziegelbau erblickte er in der
Prämonstratenser-Kirche zu Jerichow; sie sollte
bald nach der Gründung des Klosters um 1150 be-
gonnen, die beiden Nebenchöre sollten zu Beginn des
13. Jahrhunderts hinzugefügt sein. Diese Datierung,
die Adler aus dem genannten Aufsatze von Quasts
übernahm, war mehr einer begeisterten Wür-
digung als einer streng kritischen Untersuchung
des Bauwerks entsprungen und bedurfte der Be-
richtigung, als die fortschreitende wissenschaftliche
Erkenntnis tiefer in die Zeitstellung der roma-
nischen Bauwerke eingedrungen war. Dazu
kommt, daß die Aufnahme der Klosterkirche in
Jerichow leider eine der schwächsten des Adler-
schen Werkes ist. Fünfundzwanzig Jahre später
fiel es Karl Schäfer nicht schwer, die Adlersche
Datierung als falsch nachzuweisen. Es entspann
sich im Zentralblatt der Bauverwaltung 1884 ein
unerfreulicher und im Grunde ziemlich nichtiger
Streit zwischen beiden Männern, die neben-
einander dem Lehrkörper der Charlottenburger
Hochschule angehörten, ein Streit, der damals
zum Austrag nicht gebracht wurde, und in den
damals aus Achtung vor beiden niemand eingriff.
Manches hat richtiger als sie der Pfarrer Wernicke
bei der Verzeichnung der Bau- und Kunstdenk-
mäler der Kreise Jerichow 1898 erkannt, ohne
freilich zu einem klaren Urteil vorzudringen.
Nachdem aber jetzt beide Gegner bald nach-
einander von uns gegangen sind, liegt kein
Grund mehr vor, im Schweigen zu verharren.
Schäfer legte dar, daß die Klosterkirche in
Jerichow eine einheitliche Schöpfung vom An-
fange des 13. Jahrhunderts sei, von den West-
teilen abgesehen, deren Entstehung in der Mitte
des 13. Jahrhunderts auch schon von Quast und
Adler anerkannt hatten. Adler mußte in seiner
Antwort an Schäfers Auffassung Zugeständnisse
machen, ohne daß er seinem Gegner jedoch recht
geben wollte, und geriet dadurch in Widersprüche,
welche die allgemeine Richtigkeit der Auffassung
Schäfers nur bestätigten. Aber wenn Schäfer