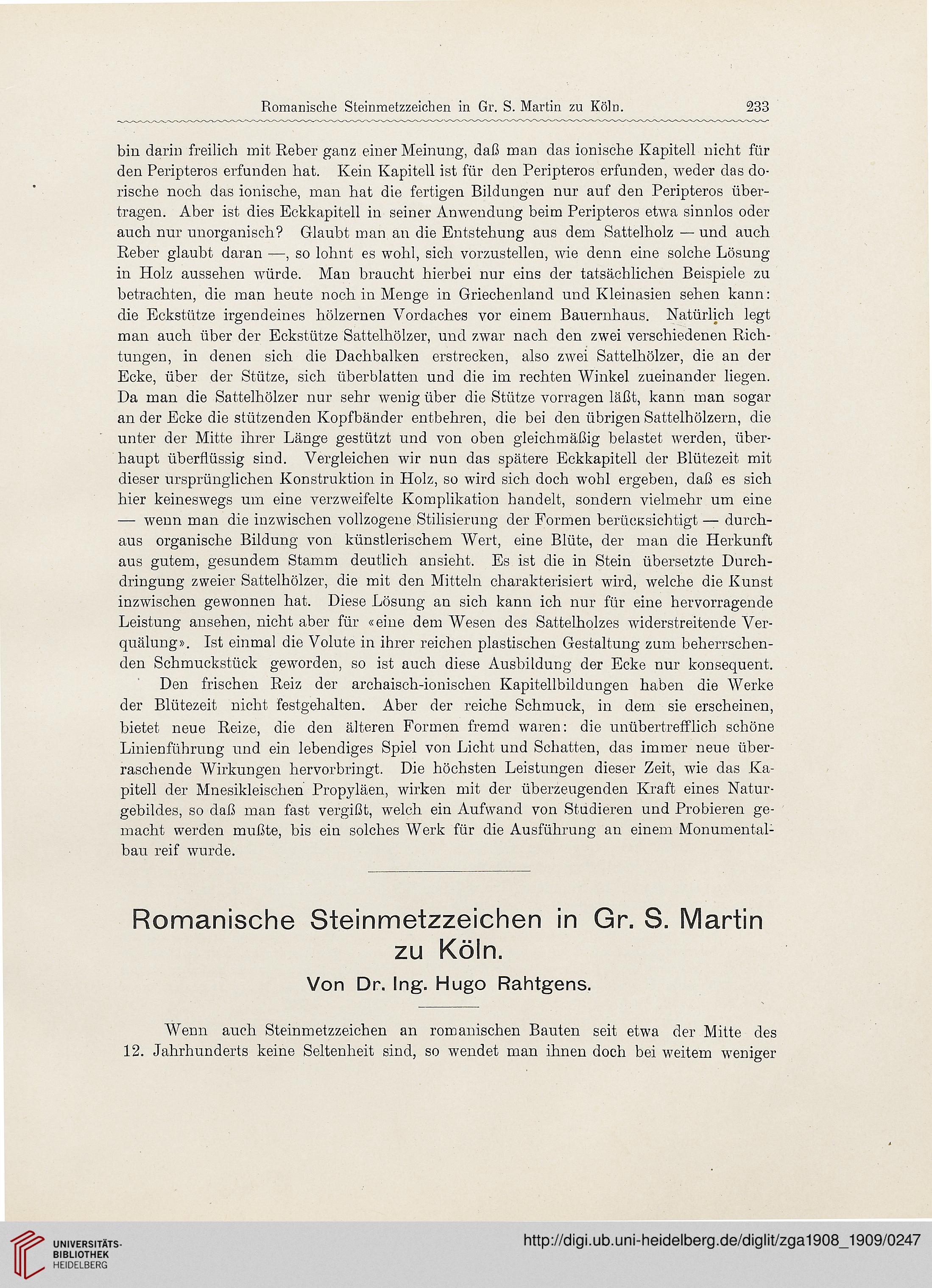Romanische Steinmetzzeichen in Gr. S. Martin zu Köln. 233
bin darin freilich mit Reber ganz einer Meinung, daß man das ionische Kapitell nicht für
den Peripteros erfunden hat. Kein Kapitell ist für den Peripteros erfunden, weder das do-
rische noch das ionische, man hat die fertigen Bildungen nur auf den Peripteros über-
tragen. Aber ist dies Eckkapitell in seiner Anwendung beim Peripteros etwa sinnlos oder
auch nur unorganisch? Glaubt man an die Entstehung aus dem Sattelholz — und auch
Reber glaubt daran —, so lohnt es wohl, sich vorzustellen, wie denn eine solche Lösung
in Holz aussehen würde. Man braucht hierbei nur eins der tatsächlichen Beispiele zu
betrachten, die man heute noch in Menge in Griechenland und Kleinasien sehen kann:
die Eckstütze irgendeines hölzernen Vordaches vor einem Bauernhaus. Natürlich legt
man auch über der Eckstütze Sattelhölzer, und zwar nach den zwei verschiedenen Rich-
tungen, in denen sich die Dachbalken erstrecken, also zwei Sattelhölzer, die an der
Ecke, über der Stütze, sich überblatten und die im rechten Winkel zueinander liegen.
Da man die Sattelhölzer nur sehr wenig über die Stütze vorragen läßt, kann man sogar
an der Ecke die stützenden Kopfbänder entbehren, die bei den übrigen Sattelhölzern, die
unter der Mitte ihrer Länge gestützt und von oben gleichmäßig belastet werden, über-
haupt überflüssig sind. Vergleichen wir nun das spätere Eckkapitell der Blütezeit mit
dieser ursprünglichen Konstruktion in Holz, so wird sich doch wohl ergeben, daß es sich
hier keineswegs um eine verzweifelte Komplikation handelt, sondern vielmehr um eine
— wenn man die inzwischen vollzogene Stilisierung der Formen berücKsicbtigt — durch-
aus organische Bildung von künstlerischem Wert, eine Blüte, der man die Herkunft
aus gutem, gesundem Stamm deutlich ansieht. Es ist die in Stein übersetzte Durch-
dringung zweier Sattelhölzer, die mit den Mitteln charakterisiert wird, welche die Kunst
inzwischen gewonnen hat. Diese Lösung an sich kann ich nur für eine hervorragende
Leistung ansehen, nicht aber für «eine dem Wesen des Sattelholzes widerstreitende Ver-
quälung». Ist einmal die Volute in ihrer reichen plastischen Gestaltung zum beherrschen-
den Schmuckstück geworden, so ist auch diese Ausbildung der Ecke nur konsequent.
Den frischen Reiz der archaisch-ionischen Kapitellbildungen haben die Werke
der Blütezeit nicht festgehalten. Aber der reiche Schmuck, in dem sie erscheinen,
bietet neue Reize, die den älteren Formen fremd waren: die unübertrefflich schöne
Linienführung und ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten, das immer neue über-
raschende Wirkungen hervorbringt. Die höchsten Leistungen dieser Zeit, wie das Ka-
pitell der Mnesikleischen Propyläen, wirken mit der überzeugenden Kraft eines Natur-
gebildes, so daß man fast vergißt, welch ein Aufwand von Studieren und Probieren ge-
macht werden mußte, bis ein solches Werk für die Ausführung au einem Monumental-
bau reif wurde.
Romanische Steinmetzzeichen in Gr. S. Martin
zu Köln.
Von Dr. Ing. Hugo Rahtgens.
Wenn auch Steinmetzzeichen an romanischen Bauten seit etwa der Mitte des
12. Jahrhunderts keine Seltenheit sind, so wendet man ihnen doch bei weitem weniger
bin darin freilich mit Reber ganz einer Meinung, daß man das ionische Kapitell nicht für
den Peripteros erfunden hat. Kein Kapitell ist für den Peripteros erfunden, weder das do-
rische noch das ionische, man hat die fertigen Bildungen nur auf den Peripteros über-
tragen. Aber ist dies Eckkapitell in seiner Anwendung beim Peripteros etwa sinnlos oder
auch nur unorganisch? Glaubt man an die Entstehung aus dem Sattelholz — und auch
Reber glaubt daran —, so lohnt es wohl, sich vorzustellen, wie denn eine solche Lösung
in Holz aussehen würde. Man braucht hierbei nur eins der tatsächlichen Beispiele zu
betrachten, die man heute noch in Menge in Griechenland und Kleinasien sehen kann:
die Eckstütze irgendeines hölzernen Vordaches vor einem Bauernhaus. Natürlich legt
man auch über der Eckstütze Sattelhölzer, und zwar nach den zwei verschiedenen Rich-
tungen, in denen sich die Dachbalken erstrecken, also zwei Sattelhölzer, die an der
Ecke, über der Stütze, sich überblatten und die im rechten Winkel zueinander liegen.
Da man die Sattelhölzer nur sehr wenig über die Stütze vorragen läßt, kann man sogar
an der Ecke die stützenden Kopfbänder entbehren, die bei den übrigen Sattelhölzern, die
unter der Mitte ihrer Länge gestützt und von oben gleichmäßig belastet werden, über-
haupt überflüssig sind. Vergleichen wir nun das spätere Eckkapitell der Blütezeit mit
dieser ursprünglichen Konstruktion in Holz, so wird sich doch wohl ergeben, daß es sich
hier keineswegs um eine verzweifelte Komplikation handelt, sondern vielmehr um eine
— wenn man die inzwischen vollzogene Stilisierung der Formen berücKsicbtigt — durch-
aus organische Bildung von künstlerischem Wert, eine Blüte, der man die Herkunft
aus gutem, gesundem Stamm deutlich ansieht. Es ist die in Stein übersetzte Durch-
dringung zweier Sattelhölzer, die mit den Mitteln charakterisiert wird, welche die Kunst
inzwischen gewonnen hat. Diese Lösung an sich kann ich nur für eine hervorragende
Leistung ansehen, nicht aber für «eine dem Wesen des Sattelholzes widerstreitende Ver-
quälung». Ist einmal die Volute in ihrer reichen plastischen Gestaltung zum beherrschen-
den Schmuckstück geworden, so ist auch diese Ausbildung der Ecke nur konsequent.
Den frischen Reiz der archaisch-ionischen Kapitellbildungen haben die Werke
der Blütezeit nicht festgehalten. Aber der reiche Schmuck, in dem sie erscheinen,
bietet neue Reize, die den älteren Formen fremd waren: die unübertrefflich schöne
Linienführung und ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten, das immer neue über-
raschende Wirkungen hervorbringt. Die höchsten Leistungen dieser Zeit, wie das Ka-
pitell der Mnesikleischen Propyläen, wirken mit der überzeugenden Kraft eines Natur-
gebildes, so daß man fast vergißt, welch ein Aufwand von Studieren und Probieren ge-
macht werden mußte, bis ein solches Werk für die Ausführung au einem Monumental-
bau reif wurde.
Romanische Steinmetzzeichen in Gr. S. Martin
zu Köln.
Von Dr. Ing. Hugo Rahtgens.
Wenn auch Steinmetzzeichen an romanischen Bauten seit etwa der Mitte des
12. Jahrhunderts keine Seltenheit sind, so wendet man ihnen doch bei weitem weniger