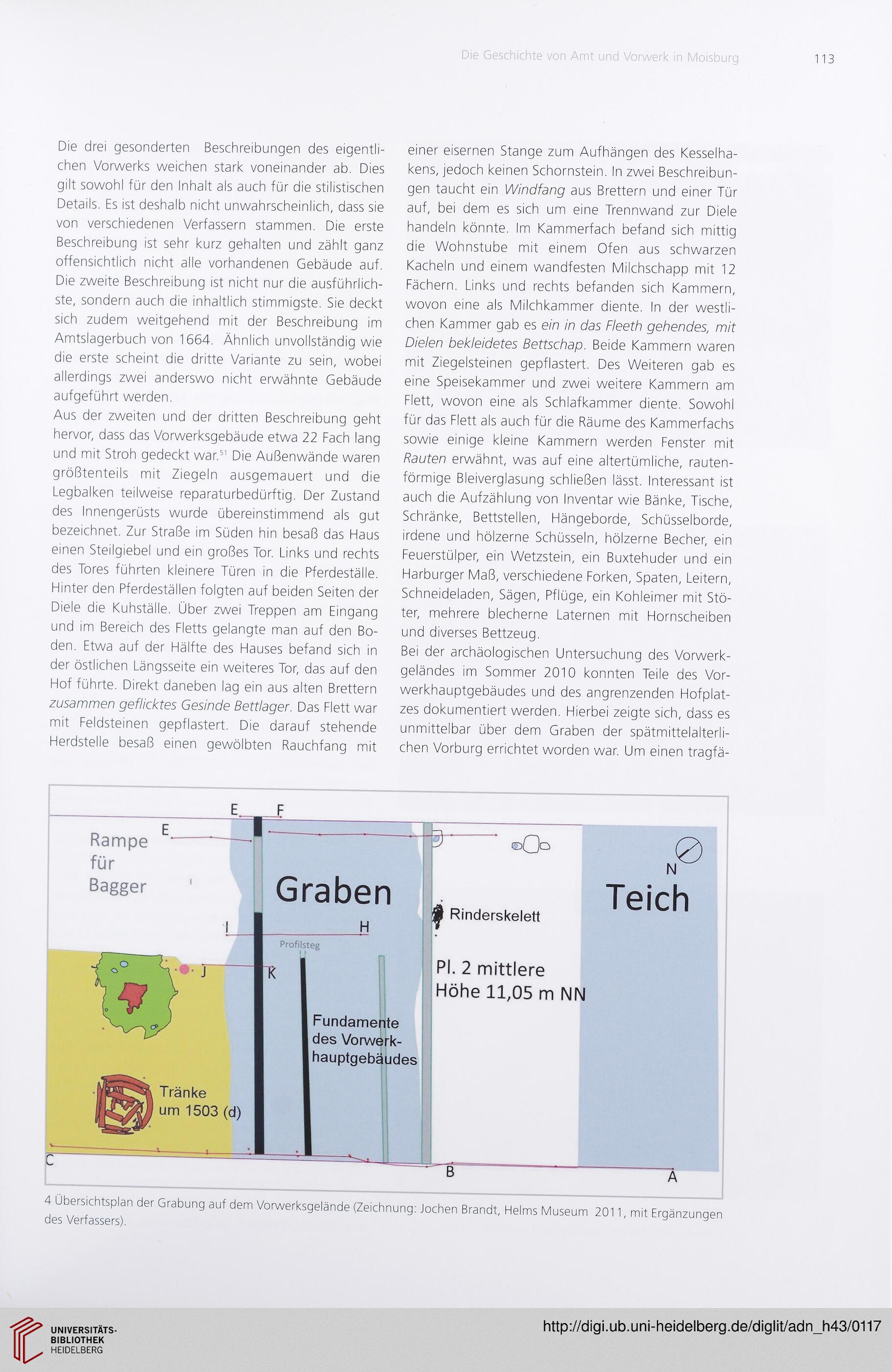Die Geschichte von Amt und Vorwerk in Moisburg
113
Die drei gesonderten Beschreibungen des eigentli-
chen Vorwerks weichen stark voneinander ab. Dies
gilt sowohl für den Inhalt als auch für die stilistischen
Details. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass sie
von verschiedenen Verfassern stammen. Die erste
Beschreibung ist sehr kurz gehalten und zählt ganz
offensichtlich nicht alle vorhandenen Gebäude auf.
Die zweite Beschreibung ist nicht nur die ausführlich-
ste, sondern auch die inhaltlich stimmigste. Sie deckt
sich zudem weitgehend mit der Beschreibung im
Amtslagerbuch von 1664. Ähnlich unvollständig wie
die erste scheint die dritte Variante zu sein, wobei
allerdings zwei anderswo nicht erwähnte Gebäude
aufgeführt werden.
Aus der zweiten und der dritten Beschreibung geht
hervor, dass das Vorwerksgebäude etwa 22 Fach lang
und mit Stroh gedeckt war.51 Die Außenwände waren
größtenteils mit Ziegeln ausgemauert und die
Legbalken teilweise reparaturbedürftig. Der Zustand
des Innengerüsts wurde übereinstimmend als gut
bezeichnet. Zur Straße im Süden hin besaß das Haus
einen Steilgiebel und ein großes Tor. Links und rechts
des Tores führten kleinere Türen in die Pferdeställe.
Hinter den Pferdeställen folgten auf beiden Seiten der
Diele die Kuhställe. Über zwei Treppen am Eingang
und im Bereich des Fletts gelangte man auf den Bo-
den. Etwa auf der Hälfte des Hauses befand sich in
der östlichen Längsseite ein weiteres Tor, das auf den
Hof führte. Direkt daneben lag ein aus alten Brettern
zusammen geflicktes Gesinde Bettlager. Das Flett war
mit Feldsteinen gepflastert. Die darauf stehende
Herdstelle besaß einen gewölbten Rauchfang mit
einer eisernen Stange zum Aufhängen des Kesselha-
kens, jedoch keinen Schornstein. In zwei Beschreibun-
gen taucht ein Windfang aus Brettern und einer Tür
auf, bei dem es sich um eine Trennwand zur Diele
handeln könnte. Im Kammerfach befand sich mittig
die Wohnstube mit einem Ofen aus schwarzen
Kacheln und einem wandfesten Milchschapp mit 12
Fächern. Links und rechts befanden sich Kammern,
wovon eine als Milchkammer diente. In der westli-
chen Kammer gab es ein in das Fleeth gehendes, mit
Dielen bekleidetes Bettschap. Beide Kammern waren
mit Ziegelsteinen gepflastert. Des Weiteren gab es
eine Speisekammer und zwei weitere Kammern am
Flett, wovon eine als Schlafkammer diente. Sowohl
für das Flett als auch für die Räume des Kammerfachs
sowie einige kleine Kammern werden Fenster mit
Rauten erwähnt, was auf eine altertümliche, rauten-
förmige Bleiverglasung schließen lässt. Interessant ist
auch die Aufzählung von Inventar wie Bänke, Tische,
Schränke, Bettstellen, Hängeborde, Schüsselborde,
irdene und hölzerne Schüsseln, hölzerne Becher, ein
Feuerstülper, ein Wetzstein, ein Buxtehuder und ein
Harburger Maß, verschiedene Forken, Spaten, Leitern,
Schneideladen, Sägen, Pflüge, ein Kohleimer mit Stö-
ter, mehrere blecherne Laternen mit Hornscheiben
und diverses Bettzeug.
Bei der archäologischen Untersuchung des Vorwerk-
geländes im Sommer 2010 konnten Teile des Vor-
werkhauptgebäudes und des angrenzenden Hofplat-
zes dokumentiert werden. Hierbei zeigte sich, dass es
unmittelbar über dem Graben der spätmittelalterli-
chen Vorburg errichtet worden war. Um einen tragfä-
Graben
Teich
Rinderskelett
H
Profilsteg
1L
B
A
’• J
Fundamente
des Vorwerk-
hauptgebäudes
Tränke
um 1503 (d)
PI. 2 mittlere
Höhe 11,05 m NN
Rampe
für
Bagger
4 Übersichtsplan der Grabung auf dem Vorwerksgelände (Zeichnung: Jochen Brandt, Helms Museum 2011, mit Ergänzungen
des Verfassers).
113
Die drei gesonderten Beschreibungen des eigentli-
chen Vorwerks weichen stark voneinander ab. Dies
gilt sowohl für den Inhalt als auch für die stilistischen
Details. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass sie
von verschiedenen Verfassern stammen. Die erste
Beschreibung ist sehr kurz gehalten und zählt ganz
offensichtlich nicht alle vorhandenen Gebäude auf.
Die zweite Beschreibung ist nicht nur die ausführlich-
ste, sondern auch die inhaltlich stimmigste. Sie deckt
sich zudem weitgehend mit der Beschreibung im
Amtslagerbuch von 1664. Ähnlich unvollständig wie
die erste scheint die dritte Variante zu sein, wobei
allerdings zwei anderswo nicht erwähnte Gebäude
aufgeführt werden.
Aus der zweiten und der dritten Beschreibung geht
hervor, dass das Vorwerksgebäude etwa 22 Fach lang
und mit Stroh gedeckt war.51 Die Außenwände waren
größtenteils mit Ziegeln ausgemauert und die
Legbalken teilweise reparaturbedürftig. Der Zustand
des Innengerüsts wurde übereinstimmend als gut
bezeichnet. Zur Straße im Süden hin besaß das Haus
einen Steilgiebel und ein großes Tor. Links und rechts
des Tores führten kleinere Türen in die Pferdeställe.
Hinter den Pferdeställen folgten auf beiden Seiten der
Diele die Kuhställe. Über zwei Treppen am Eingang
und im Bereich des Fletts gelangte man auf den Bo-
den. Etwa auf der Hälfte des Hauses befand sich in
der östlichen Längsseite ein weiteres Tor, das auf den
Hof führte. Direkt daneben lag ein aus alten Brettern
zusammen geflicktes Gesinde Bettlager. Das Flett war
mit Feldsteinen gepflastert. Die darauf stehende
Herdstelle besaß einen gewölbten Rauchfang mit
einer eisernen Stange zum Aufhängen des Kesselha-
kens, jedoch keinen Schornstein. In zwei Beschreibun-
gen taucht ein Windfang aus Brettern und einer Tür
auf, bei dem es sich um eine Trennwand zur Diele
handeln könnte. Im Kammerfach befand sich mittig
die Wohnstube mit einem Ofen aus schwarzen
Kacheln und einem wandfesten Milchschapp mit 12
Fächern. Links und rechts befanden sich Kammern,
wovon eine als Milchkammer diente. In der westli-
chen Kammer gab es ein in das Fleeth gehendes, mit
Dielen bekleidetes Bettschap. Beide Kammern waren
mit Ziegelsteinen gepflastert. Des Weiteren gab es
eine Speisekammer und zwei weitere Kammern am
Flett, wovon eine als Schlafkammer diente. Sowohl
für das Flett als auch für die Räume des Kammerfachs
sowie einige kleine Kammern werden Fenster mit
Rauten erwähnt, was auf eine altertümliche, rauten-
förmige Bleiverglasung schließen lässt. Interessant ist
auch die Aufzählung von Inventar wie Bänke, Tische,
Schränke, Bettstellen, Hängeborde, Schüsselborde,
irdene und hölzerne Schüsseln, hölzerne Becher, ein
Feuerstülper, ein Wetzstein, ein Buxtehuder und ein
Harburger Maß, verschiedene Forken, Spaten, Leitern,
Schneideladen, Sägen, Pflüge, ein Kohleimer mit Stö-
ter, mehrere blecherne Laternen mit Hornscheiben
und diverses Bettzeug.
Bei der archäologischen Untersuchung des Vorwerk-
geländes im Sommer 2010 konnten Teile des Vor-
werkhauptgebäudes und des angrenzenden Hofplat-
zes dokumentiert werden. Hierbei zeigte sich, dass es
unmittelbar über dem Graben der spätmittelalterli-
chen Vorburg errichtet worden war. Um einen tragfä-
Graben
Teich
Rinderskelett
H
Profilsteg
1L
B
A
’• J
Fundamente
des Vorwerk-
hauptgebäudes
Tränke
um 1503 (d)
PI. 2 mittlere
Höhe 11,05 m NN
Rampe
für
Bagger
4 Übersichtsplan der Grabung auf dem Vorwerksgelände (Zeichnung: Jochen Brandt, Helms Museum 2011, mit Ergänzungen
des Verfassers).