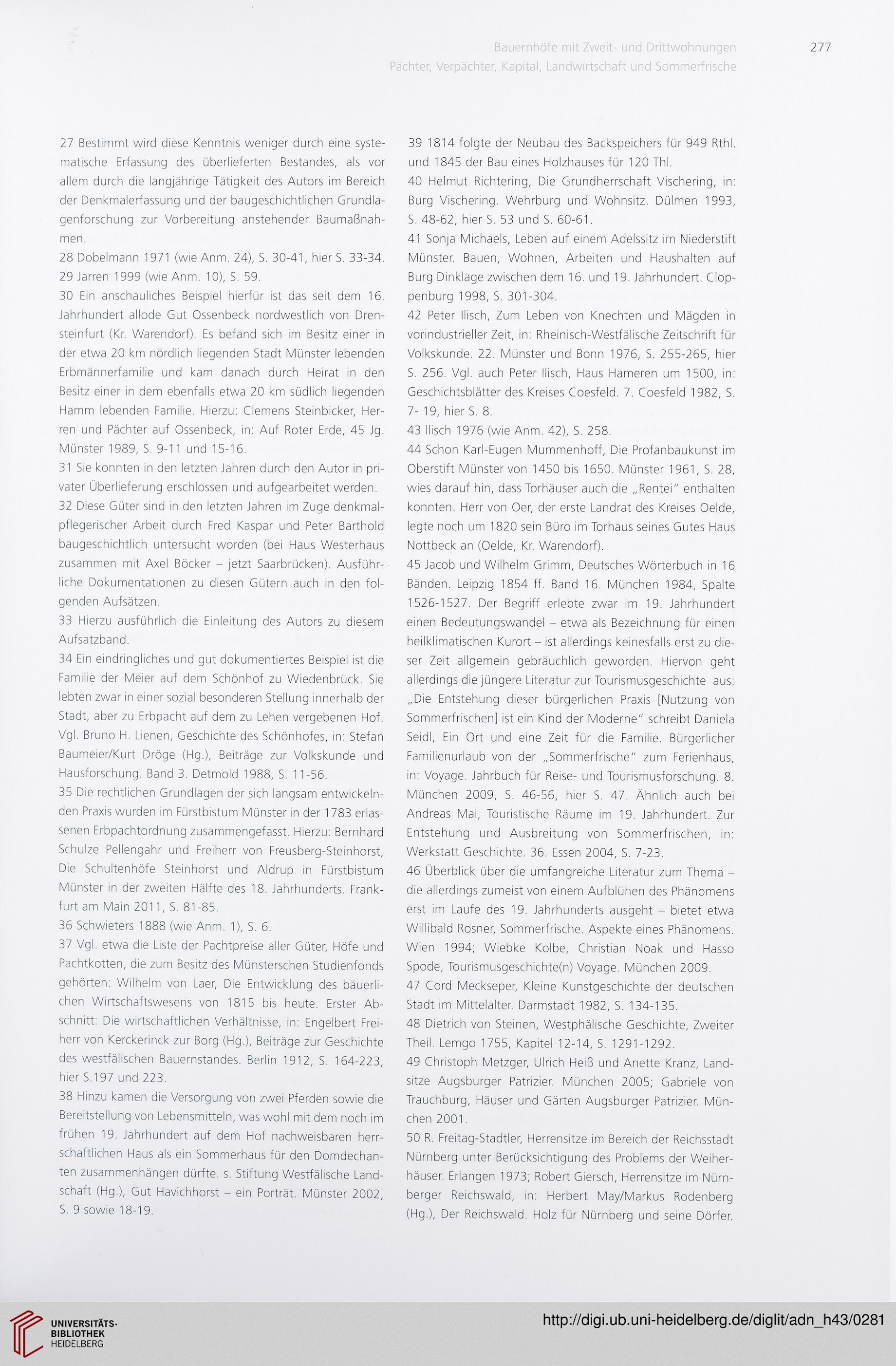Bauernhöfe mit Zweit- und Drittwohnungen
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
277
27 Bestimmt wird diese Kenntnis weniger durch eine syste-
matische Erfassung des überlieferten Bestandes, als vor
allem durch die langjährige Tätigkeit des Autors im Bereich
der Denkmalerfassung und der baugeschichtlichen Grundla-
genforschung zur Vorbereitung anstehender Baumaßnah-
men.
28 Dobelmann 1971 (wie Anm. 24), S. 30-41, hier S. 33-34.
29 Jarren 1999 (wie Anm. 10), S. 59.
30 Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das seit dem 16.
Jahrhundert allode Gut Ossenbeck nordwestlich von Dren-
steinfurt (Kr. Warendorf). Es befand sich im Besitz einer in
der etwa 20 km nördlich liegenden Stadt Münster lebenden
Erbmännerfamilie und kam danach durch Heirat in den
Besitz einer in dem ebenfalls etwa 20 km südlich liegenden
Hamm lebenden Familie. Hierzu: Clemens Steinbicker, Her-
ren und Pächter auf Ossenbeck, in: Auf Roter Erde, 45 Jg.
Münster 1989, S. 9-11 und 15-16.
31 Sie konnten in den letzten Jahren durch den Autor in pri-
vater Überlieferung erschlossen und aufgearbeitet werden.
32 Diese Güter sind in den letzten Jahren im Zuge denkmal-
pflegerischer Arbeit durch Fred Kaspar und Peter Barthold
baugeschichtlich untersucht worden (bei Haus Westerhaus
zusammen mit Axel Böcker - jetzt Saarbrücken). Ausführ-
liche Dokumentationen zu diesen Gütern auch in den fol-
genden Aufsätzen.
33 Hierzu ausführlich die Einleitung des Autors zu diesem
Aufsatzband.
34 Ein eindringliches und gut dokumentiertes Beispiel ist die
Familie der Meier auf dem Schönhof zu Wiedenbrück. Sie
lebten zwar in einer sozial besonderen Stellung innerhalb der
Stadt, aber zu Erbpacht auf dem zu Lehen vergebenen Hof.
Vgl. Bruno H. Lienen, Geschichte des Schönhofes, in: Stefan
Baumeier/Kurt Dröge (Hg.), Beiträge zur Volkskunde und
Hausforschung. Band 3. Detmold 1988, S. 11-56.
35 Die rechtlichen Grundlagen der sich langsam entwickeln-
den Praxis wurden im Fürstbistum Münster in der 1783 erlas-
senen Erbpachtordnung zusammengefasst. Hierzu: Bernhard
Schulze Pellengahr und Freiherr von Freusberg-Steinhorst,
Die Schultenhöfe Steinhorst und Aldrup in Fürstbistum
Münster in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Frank-
furt am Main 2011, S. 81-85.
36 Schwieters 1888 (wie Anm. 1), S. 6.
37 Vgl. etwa die Liste der Pachtpreise aller Güter, Höfe und
Pachtkotten, die zum Besitz des Münsterschen Studienfonds
gehörten: Wilhelm von Laer, Die Entwicklung des bäuerli-
chen Wirtschaftswesens von 1815 bis heute. Erster Ab-
schnitt: Die wirtschaftlichen Verhältnisse, in: Engelbert Frei-
herr von Kerckerinck zur Borg (Hg.), Beiträge zur Geschichte
des westfälischen Bauernstandes. Berlin 1912, S. 164-223,
hier S.197 und 223.
38 Hinzu kamen die Versorgung von zwei Pferden sowie die
Bereitstellung von Lebensmitteln, was wohl mit dem noch im
frühen 19. Jahrhundert auf dem Hof nachweisbaren herr-
schaftlichen Haus als ein Sommerhaus für den Domdechan-
ten Zusammenhängen dürfte, s. Stiftung Westfälische Land-
schaft (Hg.), Gut Havichhorst - ein Porträt. Münster 2002,
S. 9 sowie 18-19.
39 1814 folgte der Neubau des Backspeichers für 949 Rthl.
und 1845 der Bau eines Holzhauses für 120 Thl.
40 Helmut Richtering, Die Grundherrschaft Vischering, in:
Burg Vischering. Wehrburg und Wohnsitz. Dülmen 1993,
S. 48-62, hier S. 53 und S. 60-61.
41 Sonja Michaels, Leben auf einem Adelssitz im Niederstift
Münster. Bauen, Wohnen, Arbeiten und Haushalten auf
Burg Dinklage zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert. Clop-
penburg 1998, S. 301-304.
42 Peter llisch, Zum Leben von Knechten und Mägden in
vorindustrieller Zeit, in: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für
Volkskunde. 22. Münster und Bonn 1976, S. 255-265, hier
S. 256. Vgl. auch Peter llisch, Haus Hameren um 1500, in:
Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld. 7. Coesfeld 1982, S.
7- 19, hier S. 8.
43 llisch 1976 (wie Anm. 42), S. 258.
44 Schon Karl-Eugen Mummenhoff, Die Profanbaukunst im
Oberstift Münster von 1450 bis 1650. Münster 1961, S. 28,
wies darauf hin, dass Torhäuser auch die „Rentei" enthalten
konnten. Herr von Oer, der erste Landrat des Kreises Oelde,
legte noch um 1820 sein Büro im Torhaus seines Gutes Haus
Nottbeck an (Oelde, Kr. Warendorf).
45 Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch in 16
Bänden. Leipzig 1854 ff. Band 16. München 1984, Spalte
1526-1527. Der Begriff erlebte zwar im 19. Jahrhundert
einen Bedeutungswandel - etwa als Bezeichnung für einen
heilklimatischen Kurort - ist allerdings keinesfalls erst zu die-
ser Zeit allgemein gebräuchlich geworden. Hiervon geht
allerdings die jüngere Literatur zur Tourismusgeschichte aus:
„Die Entstehung dieser bürgerlichen Praxis [Nutzung von
Sommerfrischen] ist ein Kind der Moderne" schreibt Daniela
Seidl, Ein Ort und eine Zeit für die Familie. Bürgerlicher
Familienurlaub von der „Sommerfrische" zum Ferienhaus,
in: Voyage. Jahrbuch für Reise- und Tourismusforschung. 8.
München 2009, S. 46-56, hier S. 47. Ähnlich auch bei
Andreas Mai, Touristische Räume im 19. Jahrhundert. Zur
Entstehung und Ausbreitung von Sommerfrischen, in:
Werkstatt Geschichte. 36. Essen 2004, S. 7-23.
46 Überblick über die umfangreiche Literatur zum Thema -
die allerdings zumeist von einem Aufblühen des Phänomens
erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ausgeht - bietet etwa
Willibald Rosner, Sommerfrische. Aspekte eines Phänomens.
Wien 1994; Wiebke Kolbe, Christian Noak und Hasso
Spode, Tourismusgeschichte(n) Voyage. München 2009.
47 Cord Meckseper, Kleine Kunstgeschichte der deutschen
Stadt im Mittelalter. Darmstadt 1982, S. 134-135.
48 Dietrich von Steinen, Westphälische Geschichte, Zweiter
Theil. Lemgo 1755, Kapitel 12-14, S. 1291-1292.
49 Christoph Metzger, Ulrich Heiß und Anette Kranz, Land-
sitze Augsburger Patrizier. München 2005; Gabriele von
Trauchburg, Häuser und Gärten Augsburger Patrizier. Mün-
chen 2001.
50 R. Freitag-Stadtler, Herrensitze im Bereich der Reichsstadt
Nürnberg unter Berücksichtigung des Problems der Weiher-
häuser. Erlangen 1973; Robert Giersch, Herrensitze im Nürn-
berger Reichswald, in: Herbert May/Markus Rodenberg
(Hg.), Der Reichswald. Holz für Nürnberg und seine Dörfer.
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
277
27 Bestimmt wird diese Kenntnis weniger durch eine syste-
matische Erfassung des überlieferten Bestandes, als vor
allem durch die langjährige Tätigkeit des Autors im Bereich
der Denkmalerfassung und der baugeschichtlichen Grundla-
genforschung zur Vorbereitung anstehender Baumaßnah-
men.
28 Dobelmann 1971 (wie Anm. 24), S. 30-41, hier S. 33-34.
29 Jarren 1999 (wie Anm. 10), S. 59.
30 Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das seit dem 16.
Jahrhundert allode Gut Ossenbeck nordwestlich von Dren-
steinfurt (Kr. Warendorf). Es befand sich im Besitz einer in
der etwa 20 km nördlich liegenden Stadt Münster lebenden
Erbmännerfamilie und kam danach durch Heirat in den
Besitz einer in dem ebenfalls etwa 20 km südlich liegenden
Hamm lebenden Familie. Hierzu: Clemens Steinbicker, Her-
ren und Pächter auf Ossenbeck, in: Auf Roter Erde, 45 Jg.
Münster 1989, S. 9-11 und 15-16.
31 Sie konnten in den letzten Jahren durch den Autor in pri-
vater Überlieferung erschlossen und aufgearbeitet werden.
32 Diese Güter sind in den letzten Jahren im Zuge denkmal-
pflegerischer Arbeit durch Fred Kaspar und Peter Barthold
baugeschichtlich untersucht worden (bei Haus Westerhaus
zusammen mit Axel Böcker - jetzt Saarbrücken). Ausführ-
liche Dokumentationen zu diesen Gütern auch in den fol-
genden Aufsätzen.
33 Hierzu ausführlich die Einleitung des Autors zu diesem
Aufsatzband.
34 Ein eindringliches und gut dokumentiertes Beispiel ist die
Familie der Meier auf dem Schönhof zu Wiedenbrück. Sie
lebten zwar in einer sozial besonderen Stellung innerhalb der
Stadt, aber zu Erbpacht auf dem zu Lehen vergebenen Hof.
Vgl. Bruno H. Lienen, Geschichte des Schönhofes, in: Stefan
Baumeier/Kurt Dröge (Hg.), Beiträge zur Volkskunde und
Hausforschung. Band 3. Detmold 1988, S. 11-56.
35 Die rechtlichen Grundlagen der sich langsam entwickeln-
den Praxis wurden im Fürstbistum Münster in der 1783 erlas-
senen Erbpachtordnung zusammengefasst. Hierzu: Bernhard
Schulze Pellengahr und Freiherr von Freusberg-Steinhorst,
Die Schultenhöfe Steinhorst und Aldrup in Fürstbistum
Münster in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Frank-
furt am Main 2011, S. 81-85.
36 Schwieters 1888 (wie Anm. 1), S. 6.
37 Vgl. etwa die Liste der Pachtpreise aller Güter, Höfe und
Pachtkotten, die zum Besitz des Münsterschen Studienfonds
gehörten: Wilhelm von Laer, Die Entwicklung des bäuerli-
chen Wirtschaftswesens von 1815 bis heute. Erster Ab-
schnitt: Die wirtschaftlichen Verhältnisse, in: Engelbert Frei-
herr von Kerckerinck zur Borg (Hg.), Beiträge zur Geschichte
des westfälischen Bauernstandes. Berlin 1912, S. 164-223,
hier S.197 und 223.
38 Hinzu kamen die Versorgung von zwei Pferden sowie die
Bereitstellung von Lebensmitteln, was wohl mit dem noch im
frühen 19. Jahrhundert auf dem Hof nachweisbaren herr-
schaftlichen Haus als ein Sommerhaus für den Domdechan-
ten Zusammenhängen dürfte, s. Stiftung Westfälische Land-
schaft (Hg.), Gut Havichhorst - ein Porträt. Münster 2002,
S. 9 sowie 18-19.
39 1814 folgte der Neubau des Backspeichers für 949 Rthl.
und 1845 der Bau eines Holzhauses für 120 Thl.
40 Helmut Richtering, Die Grundherrschaft Vischering, in:
Burg Vischering. Wehrburg und Wohnsitz. Dülmen 1993,
S. 48-62, hier S. 53 und S. 60-61.
41 Sonja Michaels, Leben auf einem Adelssitz im Niederstift
Münster. Bauen, Wohnen, Arbeiten und Haushalten auf
Burg Dinklage zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert. Clop-
penburg 1998, S. 301-304.
42 Peter llisch, Zum Leben von Knechten und Mägden in
vorindustrieller Zeit, in: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für
Volkskunde. 22. Münster und Bonn 1976, S. 255-265, hier
S. 256. Vgl. auch Peter llisch, Haus Hameren um 1500, in:
Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld. 7. Coesfeld 1982, S.
7- 19, hier S. 8.
43 llisch 1976 (wie Anm. 42), S. 258.
44 Schon Karl-Eugen Mummenhoff, Die Profanbaukunst im
Oberstift Münster von 1450 bis 1650. Münster 1961, S. 28,
wies darauf hin, dass Torhäuser auch die „Rentei" enthalten
konnten. Herr von Oer, der erste Landrat des Kreises Oelde,
legte noch um 1820 sein Büro im Torhaus seines Gutes Haus
Nottbeck an (Oelde, Kr. Warendorf).
45 Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch in 16
Bänden. Leipzig 1854 ff. Band 16. München 1984, Spalte
1526-1527. Der Begriff erlebte zwar im 19. Jahrhundert
einen Bedeutungswandel - etwa als Bezeichnung für einen
heilklimatischen Kurort - ist allerdings keinesfalls erst zu die-
ser Zeit allgemein gebräuchlich geworden. Hiervon geht
allerdings die jüngere Literatur zur Tourismusgeschichte aus:
„Die Entstehung dieser bürgerlichen Praxis [Nutzung von
Sommerfrischen] ist ein Kind der Moderne" schreibt Daniela
Seidl, Ein Ort und eine Zeit für die Familie. Bürgerlicher
Familienurlaub von der „Sommerfrische" zum Ferienhaus,
in: Voyage. Jahrbuch für Reise- und Tourismusforschung. 8.
München 2009, S. 46-56, hier S. 47. Ähnlich auch bei
Andreas Mai, Touristische Räume im 19. Jahrhundert. Zur
Entstehung und Ausbreitung von Sommerfrischen, in:
Werkstatt Geschichte. 36. Essen 2004, S. 7-23.
46 Überblick über die umfangreiche Literatur zum Thema -
die allerdings zumeist von einem Aufblühen des Phänomens
erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ausgeht - bietet etwa
Willibald Rosner, Sommerfrische. Aspekte eines Phänomens.
Wien 1994; Wiebke Kolbe, Christian Noak und Hasso
Spode, Tourismusgeschichte(n) Voyage. München 2009.
47 Cord Meckseper, Kleine Kunstgeschichte der deutschen
Stadt im Mittelalter. Darmstadt 1982, S. 134-135.
48 Dietrich von Steinen, Westphälische Geschichte, Zweiter
Theil. Lemgo 1755, Kapitel 12-14, S. 1291-1292.
49 Christoph Metzger, Ulrich Heiß und Anette Kranz, Land-
sitze Augsburger Patrizier. München 2005; Gabriele von
Trauchburg, Häuser und Gärten Augsburger Patrizier. Mün-
chen 2001.
50 R. Freitag-Stadtler, Herrensitze im Bereich der Reichsstadt
Nürnberg unter Berücksichtigung des Problems der Weiher-
häuser. Erlangen 1973; Robert Giersch, Herrensitze im Nürn-
berger Reichswald, in: Herbert May/Markus Rodenberg
(Hg.), Der Reichswald. Holz für Nürnberg und seine Dörfer.