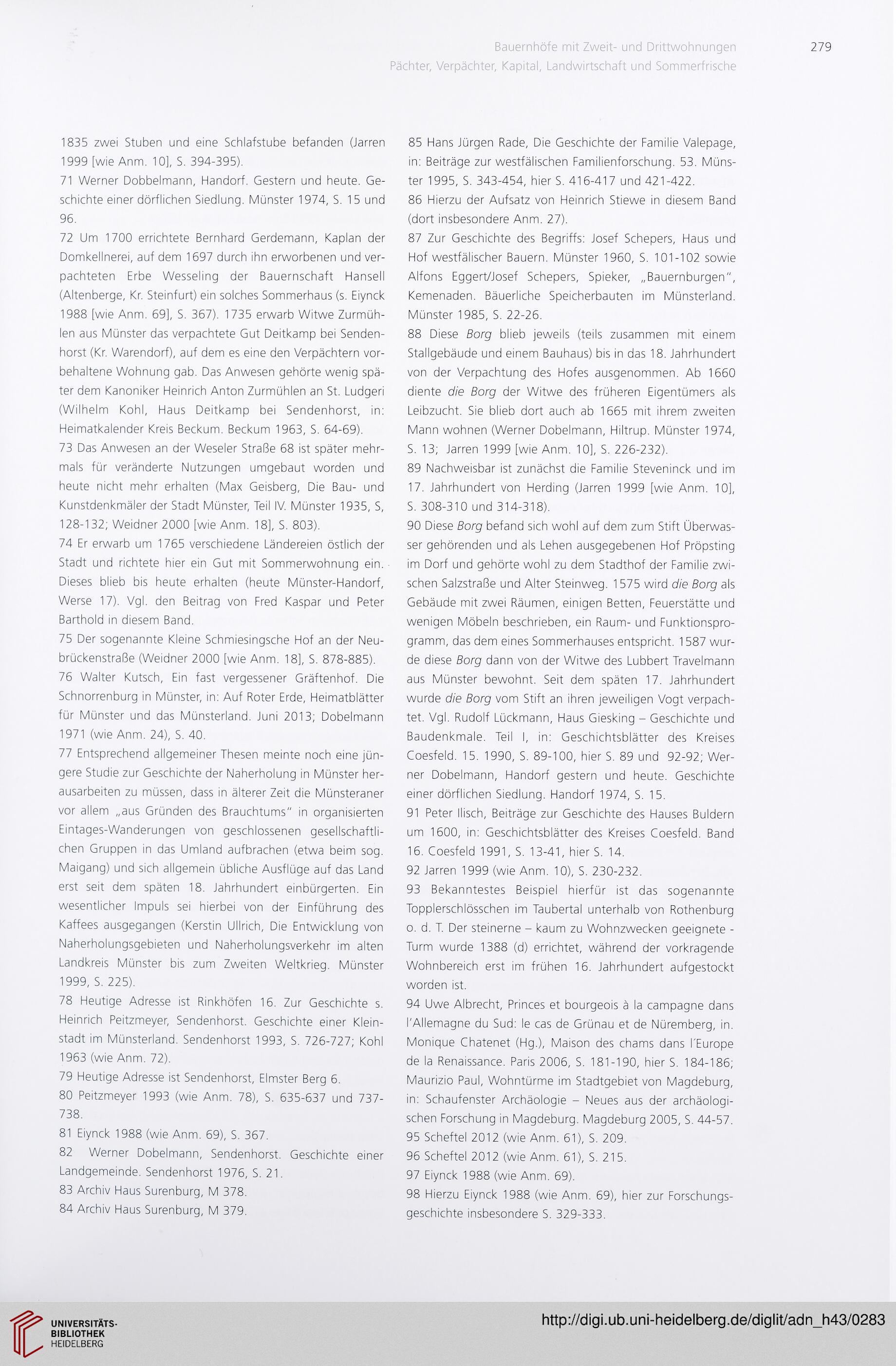Bauernhöfe mit Zweit- und Drittwohnungen
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
279
1835 zwei Stuben und eine Schlafstube befanden (Jarren
1999 [wie Anm. 10], S. 394-395).
71 Werner Dobbelmann, Handorf. Gestern und heute. Ge-
schichte einer dörflichen Siedlung. Münster 1974, S. 15 und
96.
72 Um 1700 errichtete Bernhard Gerdemann, Kaplan der
Domkellnerei, auf dem 1697 durch ihn erworbenen und ver-
pachteten Erbe Wesseling der Bauernschaft Hansell
(Altenberge, Kr. Steinfurt) ein solches Sommerhaus (s. Eiynck
1988 [wie Anm. 69], S. 367). 1735 erwarb Witwe Zurmüh-
len aus Münster das verpachtete Gut Deitkamp bei Senden-
horst (Kr. Warendorf), auf dem es eine den Verpächtern vor-
behaltene Wohnung gab. Das Anwesen gehörte wenig spä-
ter dem Kanoniker Heinrich Anton Zurmühlen an St. Ludgeri
(Wilhelm Kohl, Haus Deitkamp bei Sendenhorst, in:
Heimatkalender Kreis Beckum. Beckum 1963, S. 64-69).
73 Das Anwesen an der Weseler Straße 68 ist später mehr-
mals für veränderte Nutzungen umgebaut worden und
heute nicht mehr erhalten (Max Geisberg, Die Bau- und
Kunstdenkmäler der Stadt Münster, Teil IV. Münster 1935, S,
128-132; Weidner 2000 [wie Anm. 18], S. 803).
74 Er erwarb um 1765 verschiedene Ländereien östlich der
Stadt und richtete hier ein Gut mit Sommerwohnung ein.
Dieses blieb bis heute erhalten (heute Münster-Handorf,
Werse 17). Vgl. den Beitrag von Fred Kaspar und Peter
Barthold in diesem Band.
75 Der sogenannte Kleine Schmiesingsche Hof an der Neu-
brückenstraße (Weidner 2000 [wie Anm. 18], S. 878-885).
76 Walter Kutsch, Ein fast vergessener Gräftenhof. Die
Schnorrenburg in Münster, in: Auf Roter Erde, Heimatblätter
für Münster und das Münsterland. Juni 2013; Dobelmann
1971 (wie Anm. 24), S. 40.
77 Entsprechend allgemeiner Thesen meinte noch eine jün-
gere Studie zur Geschichte der Naherholung in Münster her-
ausarbeiten zu müssen, dass in älterer Zeit die Münsteraner
vor allem „aus Gründen des Brauchtums" in organisierten
Eintages-Wanderungen von geschlossenen gesellschaftli-
chen Gruppen in das Umland aufbrachen (etwa beim sog.
Maigang) und sich allgemein übliche Ausflüge auf das Land
erst seit dem späten 18. Jahrhundert einbürgerten. Ein
wesentlicher Impuls sei hierbei von der Einführung des
Kaffees ausgegangen (Kerstin Ullrich, Die Entwicklung von
Naherholungsgebieten und Naherholungsverkehr im alten
Landkreis Münster bis zum Zweiten Weltkrieg. Münster
1999, S. 225).
78 Heutige Adresse ist Rinkhöfen 16. Zur Geschichte s.
Heinrich Peitzmeyer, Sendenhorst. Geschichte einer Klein-
stadt im Münsterland. Sendenhorst 1993, S. 726-727; Kohl
1963 (wie Anm. 72).
79 Heutige Adresse ist Sendenhorst, Elmster Berg 6.
80 Peitzmeyer 1993 (wie Anm. 78), S. 635-637 und 737-
738.
81 Eiynck 1988 (wie Anm. 69), S. 367.
82 Werner Dobelmann, Sendenhorst. Geschichte einer
Landgemeinde. Sendenhorst 1976, S. 21.
83 Archiv Haus Surenburg, M 378.
84 Archiv Haus Surenburg, M 379.
85 Hans Jürgen Rade, Die Geschichte der Familie Valepage,
in: Beiträge zur westfälischen Familienforschung. 53. Müns-
ter 1995, S. 343-454, hier S. 416-417 und 421-422.
86 Hierzu der Aufsatz von Heinrich Stiewe in diesem Band
(dort insbesondere Anm. 27).
87 Zur Geschichte des Begriffs: Josef Schepers, Haus und
Hof westfälischer Bauern. Münster 1960, S. 101-102 sowie
Alfons Eggert/Josef Schepers, Spieker, „Bauernburgen",
Kemenaden. Bäuerliche Speicherbauten im Münsterland.
Münster 1985, S. 22-26.
88 Diese Borg blieb jeweils (teils zusammen mit einem
Stallgebäude und einem Bauhaus) bis in das 18. Jahrhundert
von der Verpachtung des Hofes ausgenommen. Ab 1660
diente die Borg der Witwe des früheren Eigentümers als
Leibzucht. Sie blieb dort auch ab 1665 mit ihrem zweiten
Mann wohnen (Werner Dobelmann, Hiltrup. Münster 1974,
S. 13; Jarren 1999 [wie Anm. 10], S. 226-232).
89 Nachweisbar ist zunächst die Familie Steveninck und im
17. Jahrhundert von Herding (Jarren 1999 [wie Anm. 10],
S. 308-310 und 314-318).
90 Diese Borg befand sich wohl auf dem zum Stift Oberwas-
ser gehörenden und als Lehen ausgegebenen Hof Pröpsting
im Dorf und gehörte wohl zu dem Stadthof der Familie zwi-
schen Salzstraße und Alter Steinweg. 1575 wird die Borg als
Gebäude mit zwei Räumen, einigen Betten, Feuerstätte und
wenigen Möbeln beschrieben, ein Raum- und Funktionspro-
gramm, das dem eines Sommerhauses entspricht. 1587 wur-
de diese Borg dann von der Witwe des Lubbert Travelmann
aus Münster bewohnt. Seit dem späten 17. Jahrhundert
wurde die Borg vom Stift an ihren jeweiligen Vogt verpach-
tet. Vgl. Rudolf Lückmann, Haus Giesking - Geschichte und
Baudenkmale. Teil I, in: Geschichtsblätter des Kreises
Coesfeld. 15. 1990, S. 89-100, hier S. 89 und 92-92; Wer-
ner Dobelmann, Handorf gestern und heute. Geschichte
einer dörflichen Siedlung. Handorf 1974, S. 15.
91 Peter llisch, Beiträge zur Geschichte des Hauses Buldern
um 1600, in: Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld. Band
16. Coesfeld 1991, S. 13-41, hier S. 14.
92 Jarren 1999 (wie Anm. 10), S. 230-232.
93 Bekanntestes Beispiel hierfür ist das sogenannte
Toppierschlösschen im Taubertal unterhalb von Rothenburg
o. d. T. Der steinerne - kaum zu Wohnzwecken geeignete -
Turm wurde 1388 (d) errichtet, während der vorkragende
Wohnbereich erst im frühen 16. Jahrhundert aufgestockt
worden ist.
94 Uwe Albrecht, Princes et bourgeois ä la Campagne dans
l'Allemagne du Sud: le cas de Grünau et de Nüremberg, in.
Monique Chatenet (Hg.), Maison des chams dans l'Europe
de la Renaissance. Paris 2006, S. 181-190, hier S. 184-186;
Maurizio Paul, Wohntürme im Stadtgebiet von Magdeburg,
in: Schaufenster Archäologie - Neues aus der archäologi-
schen Forschung in Magdeburg. Magdeburg 2005, S. 44-57.
95 Scheftel 2012 (wie Anm. 61), S. 209.
96 Scheftel 2012 (wie Anm. 61), S. 215.
97 Eiynck 1988 (wie Anm. 69).
98 Hierzu Eiynck 1988 (wie Anm. 69), hier zur Forschungs-
geschichte insbesondere S. 329-333.
Pächter, Verpächter, Kapital, Landwirtschaft und Sommerfrische
279
1835 zwei Stuben und eine Schlafstube befanden (Jarren
1999 [wie Anm. 10], S. 394-395).
71 Werner Dobbelmann, Handorf. Gestern und heute. Ge-
schichte einer dörflichen Siedlung. Münster 1974, S. 15 und
96.
72 Um 1700 errichtete Bernhard Gerdemann, Kaplan der
Domkellnerei, auf dem 1697 durch ihn erworbenen und ver-
pachteten Erbe Wesseling der Bauernschaft Hansell
(Altenberge, Kr. Steinfurt) ein solches Sommerhaus (s. Eiynck
1988 [wie Anm. 69], S. 367). 1735 erwarb Witwe Zurmüh-
len aus Münster das verpachtete Gut Deitkamp bei Senden-
horst (Kr. Warendorf), auf dem es eine den Verpächtern vor-
behaltene Wohnung gab. Das Anwesen gehörte wenig spä-
ter dem Kanoniker Heinrich Anton Zurmühlen an St. Ludgeri
(Wilhelm Kohl, Haus Deitkamp bei Sendenhorst, in:
Heimatkalender Kreis Beckum. Beckum 1963, S. 64-69).
73 Das Anwesen an der Weseler Straße 68 ist später mehr-
mals für veränderte Nutzungen umgebaut worden und
heute nicht mehr erhalten (Max Geisberg, Die Bau- und
Kunstdenkmäler der Stadt Münster, Teil IV. Münster 1935, S,
128-132; Weidner 2000 [wie Anm. 18], S. 803).
74 Er erwarb um 1765 verschiedene Ländereien östlich der
Stadt und richtete hier ein Gut mit Sommerwohnung ein.
Dieses blieb bis heute erhalten (heute Münster-Handorf,
Werse 17). Vgl. den Beitrag von Fred Kaspar und Peter
Barthold in diesem Band.
75 Der sogenannte Kleine Schmiesingsche Hof an der Neu-
brückenstraße (Weidner 2000 [wie Anm. 18], S. 878-885).
76 Walter Kutsch, Ein fast vergessener Gräftenhof. Die
Schnorrenburg in Münster, in: Auf Roter Erde, Heimatblätter
für Münster und das Münsterland. Juni 2013; Dobelmann
1971 (wie Anm. 24), S. 40.
77 Entsprechend allgemeiner Thesen meinte noch eine jün-
gere Studie zur Geschichte der Naherholung in Münster her-
ausarbeiten zu müssen, dass in älterer Zeit die Münsteraner
vor allem „aus Gründen des Brauchtums" in organisierten
Eintages-Wanderungen von geschlossenen gesellschaftli-
chen Gruppen in das Umland aufbrachen (etwa beim sog.
Maigang) und sich allgemein übliche Ausflüge auf das Land
erst seit dem späten 18. Jahrhundert einbürgerten. Ein
wesentlicher Impuls sei hierbei von der Einführung des
Kaffees ausgegangen (Kerstin Ullrich, Die Entwicklung von
Naherholungsgebieten und Naherholungsverkehr im alten
Landkreis Münster bis zum Zweiten Weltkrieg. Münster
1999, S. 225).
78 Heutige Adresse ist Rinkhöfen 16. Zur Geschichte s.
Heinrich Peitzmeyer, Sendenhorst. Geschichte einer Klein-
stadt im Münsterland. Sendenhorst 1993, S. 726-727; Kohl
1963 (wie Anm. 72).
79 Heutige Adresse ist Sendenhorst, Elmster Berg 6.
80 Peitzmeyer 1993 (wie Anm. 78), S. 635-637 und 737-
738.
81 Eiynck 1988 (wie Anm. 69), S. 367.
82 Werner Dobelmann, Sendenhorst. Geschichte einer
Landgemeinde. Sendenhorst 1976, S. 21.
83 Archiv Haus Surenburg, M 378.
84 Archiv Haus Surenburg, M 379.
85 Hans Jürgen Rade, Die Geschichte der Familie Valepage,
in: Beiträge zur westfälischen Familienforschung. 53. Müns-
ter 1995, S. 343-454, hier S. 416-417 und 421-422.
86 Hierzu der Aufsatz von Heinrich Stiewe in diesem Band
(dort insbesondere Anm. 27).
87 Zur Geschichte des Begriffs: Josef Schepers, Haus und
Hof westfälischer Bauern. Münster 1960, S. 101-102 sowie
Alfons Eggert/Josef Schepers, Spieker, „Bauernburgen",
Kemenaden. Bäuerliche Speicherbauten im Münsterland.
Münster 1985, S. 22-26.
88 Diese Borg blieb jeweils (teils zusammen mit einem
Stallgebäude und einem Bauhaus) bis in das 18. Jahrhundert
von der Verpachtung des Hofes ausgenommen. Ab 1660
diente die Borg der Witwe des früheren Eigentümers als
Leibzucht. Sie blieb dort auch ab 1665 mit ihrem zweiten
Mann wohnen (Werner Dobelmann, Hiltrup. Münster 1974,
S. 13; Jarren 1999 [wie Anm. 10], S. 226-232).
89 Nachweisbar ist zunächst die Familie Steveninck und im
17. Jahrhundert von Herding (Jarren 1999 [wie Anm. 10],
S. 308-310 und 314-318).
90 Diese Borg befand sich wohl auf dem zum Stift Oberwas-
ser gehörenden und als Lehen ausgegebenen Hof Pröpsting
im Dorf und gehörte wohl zu dem Stadthof der Familie zwi-
schen Salzstraße und Alter Steinweg. 1575 wird die Borg als
Gebäude mit zwei Räumen, einigen Betten, Feuerstätte und
wenigen Möbeln beschrieben, ein Raum- und Funktionspro-
gramm, das dem eines Sommerhauses entspricht. 1587 wur-
de diese Borg dann von der Witwe des Lubbert Travelmann
aus Münster bewohnt. Seit dem späten 17. Jahrhundert
wurde die Borg vom Stift an ihren jeweiligen Vogt verpach-
tet. Vgl. Rudolf Lückmann, Haus Giesking - Geschichte und
Baudenkmale. Teil I, in: Geschichtsblätter des Kreises
Coesfeld. 15. 1990, S. 89-100, hier S. 89 und 92-92; Wer-
ner Dobelmann, Handorf gestern und heute. Geschichte
einer dörflichen Siedlung. Handorf 1974, S. 15.
91 Peter llisch, Beiträge zur Geschichte des Hauses Buldern
um 1600, in: Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld. Band
16. Coesfeld 1991, S. 13-41, hier S. 14.
92 Jarren 1999 (wie Anm. 10), S. 230-232.
93 Bekanntestes Beispiel hierfür ist das sogenannte
Toppierschlösschen im Taubertal unterhalb von Rothenburg
o. d. T. Der steinerne - kaum zu Wohnzwecken geeignete -
Turm wurde 1388 (d) errichtet, während der vorkragende
Wohnbereich erst im frühen 16. Jahrhundert aufgestockt
worden ist.
94 Uwe Albrecht, Princes et bourgeois ä la Campagne dans
l'Allemagne du Sud: le cas de Grünau et de Nüremberg, in.
Monique Chatenet (Hg.), Maison des chams dans l'Europe
de la Renaissance. Paris 2006, S. 181-190, hier S. 184-186;
Maurizio Paul, Wohntürme im Stadtgebiet von Magdeburg,
in: Schaufenster Archäologie - Neues aus der archäologi-
schen Forschung in Magdeburg. Magdeburg 2005, S. 44-57.
95 Scheftel 2012 (wie Anm. 61), S. 209.
96 Scheftel 2012 (wie Anm. 61), S. 215.
97 Eiynck 1988 (wie Anm. 69).
98 Hierzu Eiynck 1988 (wie Anm. 69), hier zur Forschungs-
geschichte insbesondere S. 329-333.