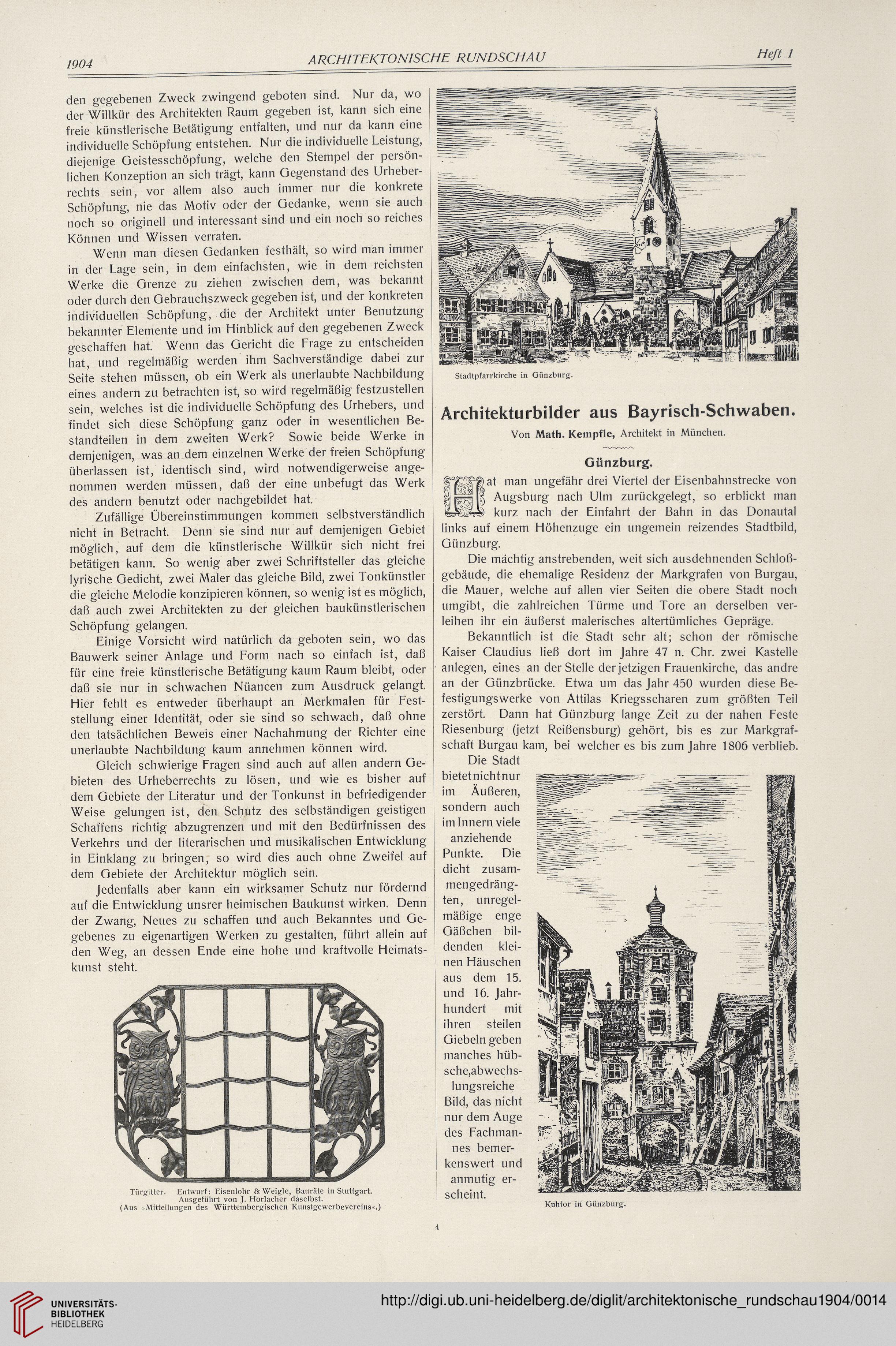1904
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 1
den gegebenen Zweck zwingend geboten sind. Nur da, wo
der Willkür des Architekten Raum gegeben ist, kann sich eine
freie künstlerische Betätigung entfalten, und nur da kann eine
individuelle Schöpfung entstehen. Nur die individuelle Leistung,
diejenige Geistesschöpfung, welche den Stempel der persön-
lichen Konzeption an sich trägt, kann Gegenstand des Urheber-
rechts sein, vor allem also auch immer nur die konkrete
Schöpfung, nie das Motiv oder der Gedanke, wenn sie auch
noch so originell und interessant sind und ein noch so reiches
Können und Wissen verraten.
Wenn man diesen Gedanken festhält, so wird man immer
in der Lage sein, in dem einfachsten, wie in dem reichsten
Werke die Grenze zu ziehen zwischen dem, was bekannt
oder durch den Gebrauchszweck gegeben ist, und der konkreten
individuellen Schöpfung, die der Architekt unter Benutzung
bekannter Elemente und im Hinblick auf den gegebenen Zweck
geschaffen hat. Wenn das Gericht die Frage zu entscheiden
hat, und regelmäßig werden ihm Sachverständige dabei zur
Seite stehen müssen, ob ein Werk als unerlaubte Nachbildung
eines andern zu betrachten ist, so wird regelmäßig festzustellen
sein, welches ist die individuelle Schöpfung des Urhebers, und
findet sich diese Schöpfung ganz oder in wesentlichen Be-
standteilen in dem zweiten Werk? Sowie beide Werke in
demjenigen, was an dem einzelnen Werke der freien Schöpfung-
überlassen ist, identisch sind, wird notwendigerweise ange-
nommen werden müssen, daß der eine unbefugt das Werk
des andern benutzt oder nachgebildet hat.
Zufällige Übereinstimmungen kommen selbstverständlich
nicht in Betracht. Denn sie sind nur auf demjenigen Gebiet
möglich, auf dem die künstlerische Willkür sich nicht frei
betätigen kann. So wenig aber zwei Schriftsteller das gleiche
lyrische Gedicht, zwei Maler das gleiche Bild, zwei Tonkünstler
die gleiche Melodie konzipieren können, so wenig ist es möglich,
daß auch zwei Architekten zu der gleichen baukünstlerischen
Schöpfung gelangen.
Einige Vorsicht wird natürlich da geboten sein, wo das
Bauwerk seiner Anlage und Form nach so einfach ist, daß
für eine freie künstlerische Betätigung kaum Raum bleibt, oder
daß sie nur in schwachen Nüancen zum Ausdruck gelangt.
Hier fehlt es entweder überhaupt an Merkmalen für Fest-
stellung einer Identität, oder sie sind so schwach, daß ohne
den tatsächlichen Beweis einer Nachahmung der Richter eine
unerlaubte Nachbildung kaum annehmen können wird.
Gleich schwierige Fragen sind auch auf allen andern Ge-
bieten des Urheberrechts zu lösen, und wie es bisher auf
dem Gebiete der Literatur und der Tonkunst in befriedigender
Weise gelungen ist, den Schutz des selbständigen geistigen
Schaffens richtig abzugrenzen und mit den Bedürfnissen des
Verkehrs und der literarischen und musikalischen Entwicklung
in Einklang zu bringen, so wird dies auch ohne Zweifel auf
dem Gebiete der Architektur möglich sein.
Jedenfalls aber kann ein wirksamer Schutz nur fördernd
auf die Entwicklung unsrer heimischen Baukunst wirken. Denn
der Zwang, Neues zu schaffen und auch Bekanntes und Ge-
gebenes zu eigenartigen Werken zu gestalten, führt allein auf
den Weg, an dessen Ende eine hohe und kraftvolle Heimats-
kunst steht.
Türgitter. Entwurf: Eisenlohr &Weigle, Bauräte in Stuttgart.
Ausgeführt von J. Horlacher daselbst.
(Aus »Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins«.)
Stadtpfarrkirche in Günzburg.
Architekturbilder aus Bayrisch-Schwaben.
Von Math. Kempfle, Architekt in München.
Günzburg.
at man ungefähr drei Viertel der Eisenbahnstrecke von
Augsburg nach Ulm zurückgelegt, so erblickt man
kurz nach der Einfahrt der Bahn in das Donautal
links auf einem Höhenzuge ein ungemein reizendes Stadtbild,
Günzburg.
Die mächtig anstrebenden, weit sich ausdehnenden Schloß-
gebäude, die ehemalige Residenz der Markgrafen von Burgau,
die Mauer, welche auf allen vier Seiten die obere Stadt noch
umgibt, die zahlreichen Türme und Tore an derselben ver-
leihen ihr ein äußerst malerisches altertümliches Gepräge.
Bekanntlich ist die Stadt sehr alt; schon der römische
Kaiser Claudius ließ dort im Jahre 47 n. Chr. zwei Kastelle
anlegen, eines an der Stelle der jetzigen Frauenkirche, das andre
an der Günzbrücke. Etwa um das Jahr 450 wurden diese Be-
festigungswerke von Attilas Kriegsscharen zum größten Teil
zerstört. Dann hat Günzburg lange Zeit zu der nahen Feste
Riesenburg (jetzt Reißensburg) gehört, bis es zur Markgraf-
schaft Burgau kam, bei welcher es bis zum Jahre 1806 verblieb.
Die Stadt
bietetnichtnur
im Äußeren,
sondern auch
im Innern viele
anziehende
Punkte. Die
dicht zusam¬
mengedräng¬
ten, unregel¬
mäßige enge
Gäßchen bil¬
denden klei¬
nen Häuschen
aus dem 15.
und 16. Jahr¬
hundert mit
ihren steilen
Giebeln geben
manches hüb¬
sche,abwechs¬
lungsreiche
Bild, das nicht
nur dem Auge
des Fachman¬
nes bemer¬
kenswert und
anmutig er¬
scheint.
Kuhtor in Günzburg.
4
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 1
den gegebenen Zweck zwingend geboten sind. Nur da, wo
der Willkür des Architekten Raum gegeben ist, kann sich eine
freie künstlerische Betätigung entfalten, und nur da kann eine
individuelle Schöpfung entstehen. Nur die individuelle Leistung,
diejenige Geistesschöpfung, welche den Stempel der persön-
lichen Konzeption an sich trägt, kann Gegenstand des Urheber-
rechts sein, vor allem also auch immer nur die konkrete
Schöpfung, nie das Motiv oder der Gedanke, wenn sie auch
noch so originell und interessant sind und ein noch so reiches
Können und Wissen verraten.
Wenn man diesen Gedanken festhält, so wird man immer
in der Lage sein, in dem einfachsten, wie in dem reichsten
Werke die Grenze zu ziehen zwischen dem, was bekannt
oder durch den Gebrauchszweck gegeben ist, und der konkreten
individuellen Schöpfung, die der Architekt unter Benutzung
bekannter Elemente und im Hinblick auf den gegebenen Zweck
geschaffen hat. Wenn das Gericht die Frage zu entscheiden
hat, und regelmäßig werden ihm Sachverständige dabei zur
Seite stehen müssen, ob ein Werk als unerlaubte Nachbildung
eines andern zu betrachten ist, so wird regelmäßig festzustellen
sein, welches ist die individuelle Schöpfung des Urhebers, und
findet sich diese Schöpfung ganz oder in wesentlichen Be-
standteilen in dem zweiten Werk? Sowie beide Werke in
demjenigen, was an dem einzelnen Werke der freien Schöpfung-
überlassen ist, identisch sind, wird notwendigerweise ange-
nommen werden müssen, daß der eine unbefugt das Werk
des andern benutzt oder nachgebildet hat.
Zufällige Übereinstimmungen kommen selbstverständlich
nicht in Betracht. Denn sie sind nur auf demjenigen Gebiet
möglich, auf dem die künstlerische Willkür sich nicht frei
betätigen kann. So wenig aber zwei Schriftsteller das gleiche
lyrische Gedicht, zwei Maler das gleiche Bild, zwei Tonkünstler
die gleiche Melodie konzipieren können, so wenig ist es möglich,
daß auch zwei Architekten zu der gleichen baukünstlerischen
Schöpfung gelangen.
Einige Vorsicht wird natürlich da geboten sein, wo das
Bauwerk seiner Anlage und Form nach so einfach ist, daß
für eine freie künstlerische Betätigung kaum Raum bleibt, oder
daß sie nur in schwachen Nüancen zum Ausdruck gelangt.
Hier fehlt es entweder überhaupt an Merkmalen für Fest-
stellung einer Identität, oder sie sind so schwach, daß ohne
den tatsächlichen Beweis einer Nachahmung der Richter eine
unerlaubte Nachbildung kaum annehmen können wird.
Gleich schwierige Fragen sind auch auf allen andern Ge-
bieten des Urheberrechts zu lösen, und wie es bisher auf
dem Gebiete der Literatur und der Tonkunst in befriedigender
Weise gelungen ist, den Schutz des selbständigen geistigen
Schaffens richtig abzugrenzen und mit den Bedürfnissen des
Verkehrs und der literarischen und musikalischen Entwicklung
in Einklang zu bringen, so wird dies auch ohne Zweifel auf
dem Gebiete der Architektur möglich sein.
Jedenfalls aber kann ein wirksamer Schutz nur fördernd
auf die Entwicklung unsrer heimischen Baukunst wirken. Denn
der Zwang, Neues zu schaffen und auch Bekanntes und Ge-
gebenes zu eigenartigen Werken zu gestalten, führt allein auf
den Weg, an dessen Ende eine hohe und kraftvolle Heimats-
kunst steht.
Türgitter. Entwurf: Eisenlohr &Weigle, Bauräte in Stuttgart.
Ausgeführt von J. Horlacher daselbst.
(Aus »Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins«.)
Stadtpfarrkirche in Günzburg.
Architekturbilder aus Bayrisch-Schwaben.
Von Math. Kempfle, Architekt in München.
Günzburg.
at man ungefähr drei Viertel der Eisenbahnstrecke von
Augsburg nach Ulm zurückgelegt, so erblickt man
kurz nach der Einfahrt der Bahn in das Donautal
links auf einem Höhenzuge ein ungemein reizendes Stadtbild,
Günzburg.
Die mächtig anstrebenden, weit sich ausdehnenden Schloß-
gebäude, die ehemalige Residenz der Markgrafen von Burgau,
die Mauer, welche auf allen vier Seiten die obere Stadt noch
umgibt, die zahlreichen Türme und Tore an derselben ver-
leihen ihr ein äußerst malerisches altertümliches Gepräge.
Bekanntlich ist die Stadt sehr alt; schon der römische
Kaiser Claudius ließ dort im Jahre 47 n. Chr. zwei Kastelle
anlegen, eines an der Stelle der jetzigen Frauenkirche, das andre
an der Günzbrücke. Etwa um das Jahr 450 wurden diese Be-
festigungswerke von Attilas Kriegsscharen zum größten Teil
zerstört. Dann hat Günzburg lange Zeit zu der nahen Feste
Riesenburg (jetzt Reißensburg) gehört, bis es zur Markgraf-
schaft Burgau kam, bei welcher es bis zum Jahre 1806 verblieb.
Die Stadt
bietetnichtnur
im Äußeren,
sondern auch
im Innern viele
anziehende
Punkte. Die
dicht zusam¬
mengedräng¬
ten, unregel¬
mäßige enge
Gäßchen bil¬
denden klei¬
nen Häuschen
aus dem 15.
und 16. Jahr¬
hundert mit
ihren steilen
Giebeln geben
manches hüb¬
sche,abwechs¬
lungsreiche
Bild, das nicht
nur dem Auge
des Fachman¬
nes bemer¬
kenswert und
anmutig er¬
scheint.
Kuhtor in Günzburg.
4