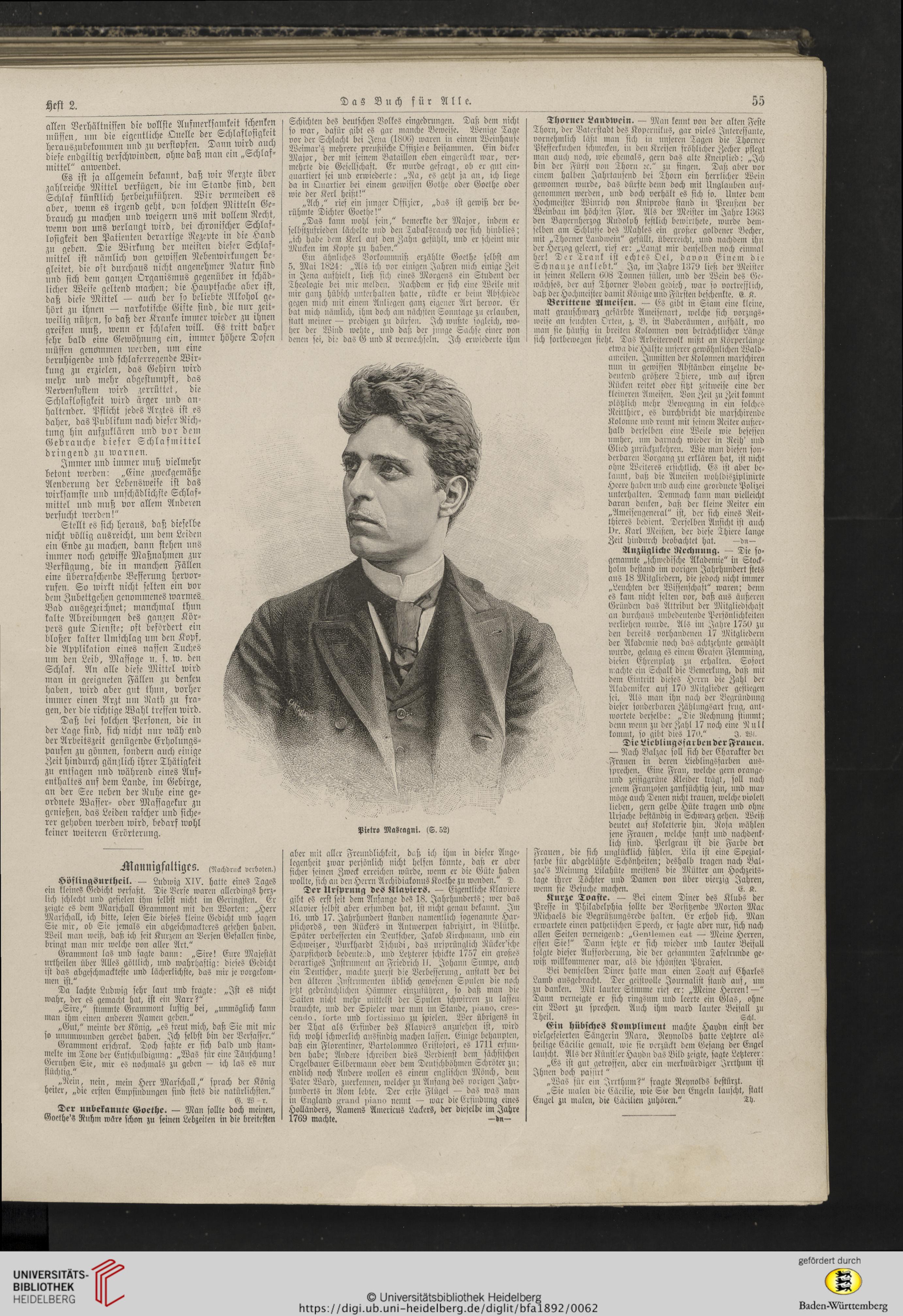Hrst 2.
Das Buch für Alle.
Thorner Lniidwcin. — Man kennt von der allen Feste
Thorn, der Vaterstadt des Kopernikns, gar vieles Interessante,
vornehmlich läßt man sich in unseren Tagen die Thorner
Pfefferknchen schmecken, in den Kreisen fröhlicher Zecher pflegt
man auch noch, wie ehemals, gern das alte Kneiplied: „Ich
bin der Fürst von Thorn -e." zn singen. Das; aber vor
einem halben Jahrtausend bei Thorn ein herrlicher Wein
gewonnen wurde, das dürste den» doch mit Unglauben aus-
genommen werden, und doch verhält es sich so. Unter dem
Hochmeister Winrich von Kniprode stand in Preußen der
Weinbau im höchsten Flor. Als der Meister im Jahre 1303
den Bayernhcrzog Rudolph festlich bewirlhete, wurde dem-
selben am Schlüsse des Mahles ein großer goldener Becher,
mit „Thorner Landweiu" gestillt, überreicht, und nachdem ihn
der Herzog geleert, rief er: „Langt mir denselben noch einmal
her! Der Trank ist echtes Oel, davon Einem die
Schnauze anklebt." Ja, im Jahre 1379 lies; der Meister-
in seinen Kellenr 60ü Tonnen stillen, und der Wein des Ge-
wächses, der ans Thorner Boden gedieh, war so vortrefflich,
daß der Hochmeister damit Könige und Fürsten beschenkte. E. K.
Berittene Ameisen. — Es gibt in Siam eine kleine,
matt granschwarz ^gesärbte Amcisenart, welche sich vorzugs-
weise an leuchten Orlen, z. B. in Baderänmen, aushält, wo
man sie häufig in breiten Kolonnen von beträchtlicher Lange
sich sortbewegen sieht. Das Arbcitervolk mißt an Körper-lange
etwa die Hülste unserer gewöhnlichen Wald-
ameisen. Inmitten der Kolonnen marschiren
nun in gewissen Abständen einzelne be-
deutend größere Thiere, und ans ihren
Rücken reitet oder sitzt zeitweise eine der
kleineren Anreisen. Von Zeil zu Zeit kommt
plötzlich mehr Bewegung in ein solches
Reitthier, es durchbricht die marschirende
Koloune und reunt mit seinem Reiter außer-
halb derselben eine Weile wie besessen
umher, uni darnach wieder in Reih' und
Glied znrückznkehren. Wie man diesen son-
derbaren Vorgang zu erklären hat, ist nicht
ohne Weiteres ersichtlich. Es ist aber be-
kannt, daß die Ameisen wohldisziplinirte
Heere haben und auch eine geordnete Polizei
unterhalten. Demnach kann man vielleicht
daran denken, daß der kleine Reiter ein
„Ameisengeneral" ist, der sich eines Reit-
thiercs bedient. Derselben Ansicht ist auch
Ur. Karl Meißen, der diese Thiere lange
Zeit hindurch beobachtet hat. —dir-
Anzügliche Rechnung. — Die so-
genannte „schwedische Akademie" in Stock-
holm bestand im vorigen Jahrhundert stets
ans 18 Mitgliedern, die jedoch nicht immer
„Leuchten der Wissenschaft" waren; denn
es kam nicht selten vor, daß aus äußeren
Gründen das Attribut der Mitgliedschaft
an durchaus unbedeutende Persönlichkeiten
verliehen wurde. Als im Jahre 1750 zu
den bereits vorhandenen 17 Mitgliedern
der Akademie noch das achtzehnte gewählt
wurde, gelang es einem Grasen Flemming,
diesen Ehrenplatz zn erhalten. Sofort
machte ein Schalk die Bemerkung, daß mit
dem Eintritt dieses Herrn die Zahl der
Akademiker auf 170 Mitglieder gestiegen
sei. Als mau ihn nach der Begründung
dieser sonderbaren Zählungsart srug, ant-
wortete derselbe: „Die Rechnung stimmt-,
denn wenn zu der Zahl 17 noch eine Rull
kommt, so gibt dies 170." I. Wl.
Die Lieblingpsarbender Frauen.
— Nach Balzac soll sich der Charakter dci
Frauen in deren Lieblingssarben aus-
sprechen. Eine Fran, welche gern orange-
und zeisiggrüne Kleider trägt, soll nach
jenem Franzosen zanksüchtig jein, und man
möge auch Denen nicht trauen, welche violett
lieben, gern gelbe Hüte tragen und ohne
Ursache beständig in Schwarz gehen. Weiß
deutet aus Koketterie hin. Rosa wählen
jene Frauen, welche saust und nachdenk-
lich sind. Perlgrau ist die Farbe der
Frauen, die sich unglücklich fühlen. Lila ist eine Spezial-
farbe für abgeblühte Schönheiten; deshalb tragen nach Bal-
zac's Meinung Lilahüte meistens die Mütter am Hochzeits-
tage ihrer Töchter und Damen von über vierzig Jahren,
wenn sie Besuche machen. E. K.
Kurze Toaste. — Bei einem Diner des Klubs der
Presse in Philadelphia sollte der Vorsitzende Morton Mac-
Michaels die Begrüßungsrede halten. Er erhob sich. Man
erwartete einen pathetischen Speech, er sagte aber nur, sich nach
allen Seiten verneigend: „Oleniloinen out — Meine Herren,
essen Sie!" Dann setzte er sich wieder und lauter Beifall
folgte dieser Aufforderung, die der gejammten Zaselrunde ge-
wiß willkommener war, als die jchöusten Phrasen.
Bei demselben Diner hatte man einen Tonst auf Charles
Lamb ansgebracht. Der^geistvolle Journalist stand aus, um
zu danken. Mit lauter L>tiunue ries er: „Meine Herren!—"
Dann verneigte er sich ringsum nud leerte ein Glas, ohne
ein Wort zu sprechen. Auch ihm ward lauter Bestall zu
Theil.. , Schl.
Ein hübsches Kompliment machte Haydn einst der
viclgefcierten Sängerin Mara. Reynolds hatte Letztere al -
heilige Cäcilie gemalt, wie sie verzückt dem Gesang der Engel
lauscht. Als der Künstler Haydn das Bild zeigte, sagte Letzterer:
„Es ist gut getroffen, aber ein merkwürdiger Jrrthum ist
Ihnen doch passirt"
„Was für ein Jrrthum?" fragte Reynolds bestürzt.
„Sie malen die Cäcilie, wie Sie den Engeln lauscht, stall
Engel zu malen, die Cäcilien zuhören." Th.
allen Verhältnissen die vollste Aufmerksamkeit schenken
müssen, nm die eigentliche Quelle der Schlaflosigkeit
heraus,zubekommen und ,zu verstopfen. Dann wird auch
diese cndgiltig verschwinden, ohne daß man ein „Schlaf-
mittel" anwendet. .
Es ist ja allgemein bekannt, daß wir Aerzte uber-
zahlreiche Mittel verfügen, die im Stande sind, den
Schlaf künstlich herbei,zufnhren. Wir vermeiden es
aber, wenn es irgend geht, von solchen Mitteln Ge-
brauch zu machen und weigern uns mit vollem Recht,
wenn von uns verlangt wird, bei chronischer Schlaf-
losigkeit den Patienten derartige Rezepte in die Hand
zu geben. Die Wirkung der meisten dieser Schlaf-
mittel ist nämlich von gewissen Nebenwirkungen be-
gleitet, die oft durchaus nicht angenehmer Natur sind
und sich dem ganzen Organismus gegenüber in schäd-
licher Weise geltend machen; die Hauptsache aber ist,
daß diese Mittel — auch der so beliebte Alkohol ge-
hört zu ihnen — narkotische Gifte sind, die nur zeit-
weilig nützen, so daß der Kranke immer wieder zu ihnen
greifen muß, wenn er schlafen will. Es tritt daher
sehr bald eine Gewöhnung ein, immer höhere Dosen
müssen genommen werden, um eine
beruhigende und schlaferregende Wir-
kung zu erzielen, das Gehirn wird
mehr und mehr abgestumpft, das
Nervensystem wird zerrüttet, die
Schlaflosigkeit wird ärger und an-
haltender/ Pflicht jedes Arztes ist es
daher, das Publikum nach dieser Rich-
tung hin aufzuklären und vor dem
Gebrauche dieser Schlafmittel
dringend zu warnen.
Immer und immer muß vielmehr
betont werden: „Eine zweekgemäße
Aenderung der Lebensweise ist das
wirksamste und unschädlichste Schlaf-
mittel und muß vor allem Anderen
versucht werden!"
Stellt cs sich heraus, daß dieselbe
nicht völlig ausreicht, um dem Leiden
ein Ende zu machen, dann stehen uns
immer noch gewisse Maßnahmen zur
Verfügung, die in manchen Fällen
eine überraschende Besserung Hervor-
rufen. So wirkt nicht selten ein vor-
dem Zubettgehen genommenes warmes
Bad ausgezeichnet; manchmal thun
kalte Abreibungen des ganzen Kör-
pers gute Dienste; oft befördert ein
bloßer kalter Umschlag um den Kopf,
die Applikation eines nassen Tuches
um den Leib, Massage u. s. w. den
Schlaf. An alle diese Mittel wird
man in geeigneten Fällen zu denken
haben, wird aber gut thun, vorher-
immer einen Arzt um Rath zu fra-
gen, der die richtige Wahl treffen wird.
Daß bei solchen Personen, die in
der Lage sind, sich nicht mir wäh end
der Arbeitszeit genügende Erholungs-
pausen zu gönnen, sondern auch einige
Zeit hindurch gänzlich ihrer Thätigkeit
zu entsagen und während eines Auf-
enthaltes ans dem Lande, im Gebirge,
an der See neben der Ruhe eine ge-
ordnete Wasser- oder Massagekur zn
genießen, das Leiden rascher und siche-
rer gehoben werden wird, bedarf Wohl
keiner weiteren Erörterung.
(Nachdruck verboten.)
Höflingsurtheil. — Ludwig XIV. hatte eines Tages
ein kleines Gedicht verfaßt. Die Verse waren allerdings herz-
lich schlecht und gefielen ihm selbst nicht im Geringsten. Er
zeigte es dem Marschall Granunont mit den Worten: „Herr
Marschall, ich bitte, lesen Sie dieses kleine Gedicht nnd sagen
Sie mir, ob Sie jemals ein abgeschmackteres gesehen haben.
Weil man weiß, daß ich seit Kurzem an Versen Gefallen finde,
bringt man mir welche von aller Art."
Granunont las und sagte dann: „Sire! Eure Majestät
urtheilen über Alles göttlich, nnd wahrhaftig: dieses Gedicht
ist das abgeschmackteste und lächerlichste, das mir je vorgekom-
men ist."
Da lachte Ludwig sehr laut nnd fragte: „Ist es nicht
wahr, der cs gemacht hat, ist ein Narr?"
„Sire," stimmte Granunont lustig bei, „unmöglich kann
man ihm einen anderen Namen geben."
„Gut," meinte der König, „es freut mich, daß Sie mit mic
so unumwunden geredet haben. Ich selbst bin der Verfasser."
Granunont erschrak. Doch saßte er sich bald und stam-
melte im Tone der Entschuldigung: „Was für eine Täuschung!
Geruhen Sie, mir es nochmals zu geben — ich las es nur
flüchtig."
„Nein, nein, mein Herr Marschall," sprach der König
heiter, „die ersten Empfindungen sind stets die natürlichsten."
G. W - r.
Der unbekannte Goethe. — Man sollte doch meinen,
Goethe's Ruhm wäre schon zu seinen Lebzeiten in die breitesten
Pietro Masragni. (S. 52)
aber mit aller Freundlichkeit, daß ich ihm in dieser Ange-
legenheit zwar persönlich nicht Helsen könnte, daß er aber
sicher seinen Zweck erreichen würde, wenn er die Güte haben
wollte, sich an den Herrn Archidiakonus Koethe zn wenden." D.
Der Ursprung deö Klaviers. — Eigentliche Klaviere
gibt es erst seit dem Anfänge des 18. Jahrhunderts; wer das
Klavier selbst aber ersnndcn hat, ist nicht genan bekannt. Im
16. und 17. Jahrhundert standen namentlich sogenannte Har-
psichords, von Rückers in Antwerpen fabrizirt, in Blüthe.
Später verbesserten ein Deutscher, Jakob Kirchmann, nnd ein
Schweizer, Burkhardt Tjchndi, das ursprünglich Rücker'ichc
Harpsichord bedeutend, nnd Letzterer schickte 1757 ein großes
derartiges Instrument an Friedrich lt. Johann Snmpe, auch
ein Deutscher, machte zuerst die Verbesserung, anstatt der bei
den älteren Instrumenten üblich gewesenen Spulen die noch
jetzt gebräuchlichen Hümmer einzusiihren, so daß man die
Saiten nicht mehr mittelst der Spulen schwirren zu lassen
brauchte, und der Spieler war nun im Stande, piano, ero^-
esrnto, tdrto und tortmsüno zn spielen. Wer übrigens in
der That als Erfinder des Klaviers anzujehcn ist, wird
sich wohl schwerlich ausfindig machen lassen. Einige behaupten,
daß ein Florentiner, Bartolommeo Cristosori, es 1711 erfun-
den habe; Andere schreiben dies Verdienst dcni^ sächsischen
Orgelbauer Silbermann oder dem Dentschböhmcn Schröter zn;
endlich noch Andere wollen es einem englischen Mönch, dem
Pater Ward, znerkennen, welcher zn Anfang des vorigen Jahr-
hunderts in Nom lebte. Der erste Flügel — das was man
in England Franck piano nennt — war die Erfindung eines
Holländers, Namens Americus Lackers, der dieselbe im Jahre
1769 machte. —dn—
Schichten des deutschen Volkes eingedrnngen. Daß dem nicht
so war, dafür gibt es gar manche Beweise. Wenige Tage
vor der Schlacht bei Jena (1806) waren in einem Weinhanse
Weimar'z niehrere preußische Offizier e beisammen. Ein dicker
Major, der mit seinem Bataillon eben eingerückt war, ver-
mehrte die Gesellschaft. Er wurde gefragt, ob er gut ein-
quartiert sei und erwiederte: „Na, es geht ja an, ich liege
da in Quartier bei einem gewissen Gothe oder Goethe oder
wie der Kerl heißt!"
„Ach," rief ein junger Offizier, „das ist gewiß der be-
rühmte Dichter Goethe!"
„Das kann wohl sein," bemerkte der Major, indem er
sclbstznfriedcn lächelte nnd den Tabaksrauch vor sich hinblies;
„ich habe dem Kerl auf den Zahn gefühlt, und er scheint mir
Mucken im Kopse zn haben."
Ein ähnliches Vorkommnis; erzählte Goethe selbst am
5. Mai 1824: „Als ich vor einigen Jahren mich einige Zeit
in Jena aufhielt, lies; sich eines Morgens ein Student der
Theologie bei mir melden. Nachdem er sich eine Weile mit
mir ganz hübsch unterhalten hatte, rückte er beim Abschiede
gegen mich mit einem Anliegen ganz eigener Art hervor. Er-
bat mich nämlich, ihm doch am nächsten Sonntage zn erlauben,
statt meiner — predigen zn dürfen. Ich wußte sogleich, wo-
her der Wind wehte, und daß der junge Sachse einer von
denen sei, die das G und K verwechseln. Ich erwiederte ihm
Das Buch für Alle.
Thorner Lniidwcin. — Man kennt von der allen Feste
Thorn, der Vaterstadt des Kopernikns, gar vieles Interessante,
vornehmlich läßt man sich in unseren Tagen die Thorner
Pfefferknchen schmecken, in den Kreisen fröhlicher Zecher pflegt
man auch noch, wie ehemals, gern das alte Kneiplied: „Ich
bin der Fürst von Thorn -e." zn singen. Das; aber vor
einem halben Jahrtausend bei Thorn ein herrlicher Wein
gewonnen wurde, das dürste den» doch mit Unglauben aus-
genommen werden, und doch verhält es sich so. Unter dem
Hochmeister Winrich von Kniprode stand in Preußen der
Weinbau im höchsten Flor. Als der Meister im Jahre 1303
den Bayernhcrzog Rudolph festlich bewirlhete, wurde dem-
selben am Schlüsse des Mahles ein großer goldener Becher,
mit „Thorner Landweiu" gestillt, überreicht, und nachdem ihn
der Herzog geleert, rief er: „Langt mir denselben noch einmal
her! Der Trank ist echtes Oel, davon Einem die
Schnauze anklebt." Ja, im Jahre 1379 lies; der Meister-
in seinen Kellenr 60ü Tonnen stillen, und der Wein des Ge-
wächses, der ans Thorner Boden gedieh, war so vortrefflich,
daß der Hochmeister damit Könige und Fürsten beschenkte. E. K.
Berittene Ameisen. — Es gibt in Siam eine kleine,
matt granschwarz ^gesärbte Amcisenart, welche sich vorzugs-
weise an leuchten Orlen, z. B. in Baderänmen, aushält, wo
man sie häufig in breiten Kolonnen von beträchtlicher Lange
sich sortbewegen sieht. Das Arbcitervolk mißt an Körper-lange
etwa die Hülste unserer gewöhnlichen Wald-
ameisen. Inmitten der Kolonnen marschiren
nun in gewissen Abständen einzelne be-
deutend größere Thiere, und ans ihren
Rücken reitet oder sitzt zeitweise eine der
kleineren Anreisen. Von Zeil zu Zeit kommt
plötzlich mehr Bewegung in ein solches
Reitthier, es durchbricht die marschirende
Koloune und reunt mit seinem Reiter außer-
halb derselben eine Weile wie besessen
umher, uni darnach wieder in Reih' und
Glied znrückznkehren. Wie man diesen son-
derbaren Vorgang zu erklären hat, ist nicht
ohne Weiteres ersichtlich. Es ist aber be-
kannt, daß die Ameisen wohldisziplinirte
Heere haben und auch eine geordnete Polizei
unterhalten. Demnach kann man vielleicht
daran denken, daß der kleine Reiter ein
„Ameisengeneral" ist, der sich eines Reit-
thiercs bedient. Derselben Ansicht ist auch
Ur. Karl Meißen, der diese Thiere lange
Zeit hindurch beobachtet hat. —dir-
Anzügliche Rechnung. — Die so-
genannte „schwedische Akademie" in Stock-
holm bestand im vorigen Jahrhundert stets
ans 18 Mitgliedern, die jedoch nicht immer
„Leuchten der Wissenschaft" waren; denn
es kam nicht selten vor, daß aus äußeren
Gründen das Attribut der Mitgliedschaft
an durchaus unbedeutende Persönlichkeiten
verliehen wurde. Als im Jahre 1750 zu
den bereits vorhandenen 17 Mitgliedern
der Akademie noch das achtzehnte gewählt
wurde, gelang es einem Grasen Flemming,
diesen Ehrenplatz zn erhalten. Sofort
machte ein Schalk die Bemerkung, daß mit
dem Eintritt dieses Herrn die Zahl der
Akademiker auf 170 Mitglieder gestiegen
sei. Als mau ihn nach der Begründung
dieser sonderbaren Zählungsart srug, ant-
wortete derselbe: „Die Rechnung stimmt-,
denn wenn zu der Zahl 17 noch eine Rull
kommt, so gibt dies 170." I. Wl.
Die Lieblingpsarbender Frauen.
— Nach Balzac soll sich der Charakter dci
Frauen in deren Lieblingssarben aus-
sprechen. Eine Fran, welche gern orange-
und zeisiggrüne Kleider trägt, soll nach
jenem Franzosen zanksüchtig jein, und man
möge auch Denen nicht trauen, welche violett
lieben, gern gelbe Hüte tragen und ohne
Ursache beständig in Schwarz gehen. Weiß
deutet aus Koketterie hin. Rosa wählen
jene Frauen, welche saust und nachdenk-
lich sind. Perlgrau ist die Farbe der
Frauen, die sich unglücklich fühlen. Lila ist eine Spezial-
farbe für abgeblühte Schönheiten; deshalb tragen nach Bal-
zac's Meinung Lilahüte meistens die Mütter am Hochzeits-
tage ihrer Töchter und Damen von über vierzig Jahren,
wenn sie Besuche machen. E. K.
Kurze Toaste. — Bei einem Diner des Klubs der
Presse in Philadelphia sollte der Vorsitzende Morton Mac-
Michaels die Begrüßungsrede halten. Er erhob sich. Man
erwartete einen pathetischen Speech, er sagte aber nur, sich nach
allen Seiten verneigend: „Oleniloinen out — Meine Herren,
essen Sie!" Dann setzte er sich wieder und lauter Beifall
folgte dieser Aufforderung, die der gejammten Zaselrunde ge-
wiß willkommener war, als die jchöusten Phrasen.
Bei demselben Diner hatte man einen Tonst auf Charles
Lamb ansgebracht. Der^geistvolle Journalist stand aus, um
zu danken. Mit lauter L>tiunue ries er: „Meine Herren!—"
Dann verneigte er sich ringsum nud leerte ein Glas, ohne
ein Wort zu sprechen. Auch ihm ward lauter Bestall zu
Theil.. , Schl.
Ein hübsches Kompliment machte Haydn einst der
viclgefcierten Sängerin Mara. Reynolds hatte Letztere al -
heilige Cäcilie gemalt, wie sie verzückt dem Gesang der Engel
lauscht. Als der Künstler Haydn das Bild zeigte, sagte Letzterer:
„Es ist gut getroffen, aber ein merkwürdiger Jrrthum ist
Ihnen doch passirt"
„Was für ein Jrrthum?" fragte Reynolds bestürzt.
„Sie malen die Cäcilie, wie Sie den Engeln lauscht, stall
Engel zu malen, die Cäcilien zuhören." Th.
allen Verhältnissen die vollste Aufmerksamkeit schenken
müssen, nm die eigentliche Quelle der Schlaflosigkeit
heraus,zubekommen und ,zu verstopfen. Dann wird auch
diese cndgiltig verschwinden, ohne daß man ein „Schlaf-
mittel" anwendet. .
Es ist ja allgemein bekannt, daß wir Aerzte uber-
zahlreiche Mittel verfügen, die im Stande sind, den
Schlaf künstlich herbei,zufnhren. Wir vermeiden es
aber, wenn es irgend geht, von solchen Mitteln Ge-
brauch zu machen und weigern uns mit vollem Recht,
wenn von uns verlangt wird, bei chronischer Schlaf-
losigkeit den Patienten derartige Rezepte in die Hand
zu geben. Die Wirkung der meisten dieser Schlaf-
mittel ist nämlich von gewissen Nebenwirkungen be-
gleitet, die oft durchaus nicht angenehmer Natur sind
und sich dem ganzen Organismus gegenüber in schäd-
licher Weise geltend machen; die Hauptsache aber ist,
daß diese Mittel — auch der so beliebte Alkohol ge-
hört zu ihnen — narkotische Gifte sind, die nur zeit-
weilig nützen, so daß der Kranke immer wieder zu ihnen
greifen muß, wenn er schlafen will. Es tritt daher
sehr bald eine Gewöhnung ein, immer höhere Dosen
müssen genommen werden, um eine
beruhigende und schlaferregende Wir-
kung zu erzielen, das Gehirn wird
mehr und mehr abgestumpft, das
Nervensystem wird zerrüttet, die
Schlaflosigkeit wird ärger und an-
haltender/ Pflicht jedes Arztes ist es
daher, das Publikum nach dieser Rich-
tung hin aufzuklären und vor dem
Gebrauche dieser Schlafmittel
dringend zu warnen.
Immer und immer muß vielmehr
betont werden: „Eine zweekgemäße
Aenderung der Lebensweise ist das
wirksamste und unschädlichste Schlaf-
mittel und muß vor allem Anderen
versucht werden!"
Stellt cs sich heraus, daß dieselbe
nicht völlig ausreicht, um dem Leiden
ein Ende zu machen, dann stehen uns
immer noch gewisse Maßnahmen zur
Verfügung, die in manchen Fällen
eine überraschende Besserung Hervor-
rufen. So wirkt nicht selten ein vor-
dem Zubettgehen genommenes warmes
Bad ausgezeichnet; manchmal thun
kalte Abreibungen des ganzen Kör-
pers gute Dienste; oft befördert ein
bloßer kalter Umschlag um den Kopf,
die Applikation eines nassen Tuches
um den Leib, Massage u. s. w. den
Schlaf. An alle diese Mittel wird
man in geeigneten Fällen zu denken
haben, wird aber gut thun, vorher-
immer einen Arzt um Rath zu fra-
gen, der die richtige Wahl treffen wird.
Daß bei solchen Personen, die in
der Lage sind, sich nicht mir wäh end
der Arbeitszeit genügende Erholungs-
pausen zu gönnen, sondern auch einige
Zeit hindurch gänzlich ihrer Thätigkeit
zu entsagen und während eines Auf-
enthaltes ans dem Lande, im Gebirge,
an der See neben der Ruhe eine ge-
ordnete Wasser- oder Massagekur zn
genießen, das Leiden rascher und siche-
rer gehoben werden wird, bedarf Wohl
keiner weiteren Erörterung.
(Nachdruck verboten.)
Höflingsurtheil. — Ludwig XIV. hatte eines Tages
ein kleines Gedicht verfaßt. Die Verse waren allerdings herz-
lich schlecht und gefielen ihm selbst nicht im Geringsten. Er
zeigte es dem Marschall Granunont mit den Worten: „Herr
Marschall, ich bitte, lesen Sie dieses kleine Gedicht nnd sagen
Sie mir, ob Sie jemals ein abgeschmackteres gesehen haben.
Weil man weiß, daß ich seit Kurzem an Versen Gefallen finde,
bringt man mir welche von aller Art."
Granunont las und sagte dann: „Sire! Eure Majestät
urtheilen über Alles göttlich, nnd wahrhaftig: dieses Gedicht
ist das abgeschmackteste und lächerlichste, das mir je vorgekom-
men ist."
Da lachte Ludwig sehr laut nnd fragte: „Ist es nicht
wahr, der cs gemacht hat, ist ein Narr?"
„Sire," stimmte Granunont lustig bei, „unmöglich kann
man ihm einen anderen Namen geben."
„Gut," meinte der König, „es freut mich, daß Sie mit mic
so unumwunden geredet haben. Ich selbst bin der Verfasser."
Granunont erschrak. Doch saßte er sich bald und stam-
melte im Tone der Entschuldigung: „Was für eine Täuschung!
Geruhen Sie, mir es nochmals zu geben — ich las es nur
flüchtig."
„Nein, nein, mein Herr Marschall," sprach der König
heiter, „die ersten Empfindungen sind stets die natürlichsten."
G. W - r.
Der unbekannte Goethe. — Man sollte doch meinen,
Goethe's Ruhm wäre schon zu seinen Lebzeiten in die breitesten
Pietro Masragni. (S. 52)
aber mit aller Freundlichkeit, daß ich ihm in dieser Ange-
legenheit zwar persönlich nicht Helsen könnte, daß er aber
sicher seinen Zweck erreichen würde, wenn er die Güte haben
wollte, sich an den Herrn Archidiakonus Koethe zn wenden." D.
Der Ursprung deö Klaviers. — Eigentliche Klaviere
gibt es erst seit dem Anfänge des 18. Jahrhunderts; wer das
Klavier selbst aber ersnndcn hat, ist nicht genan bekannt. Im
16. und 17. Jahrhundert standen namentlich sogenannte Har-
psichords, von Rückers in Antwerpen fabrizirt, in Blüthe.
Später verbesserten ein Deutscher, Jakob Kirchmann, nnd ein
Schweizer, Burkhardt Tjchndi, das ursprünglich Rücker'ichc
Harpsichord bedeutend, nnd Letzterer schickte 1757 ein großes
derartiges Instrument an Friedrich lt. Johann Snmpe, auch
ein Deutscher, machte zuerst die Verbesserung, anstatt der bei
den älteren Instrumenten üblich gewesenen Spulen die noch
jetzt gebräuchlichen Hümmer einzusiihren, so daß man die
Saiten nicht mehr mittelst der Spulen schwirren zu lassen
brauchte, und der Spieler war nun im Stande, piano, ero^-
esrnto, tdrto und tortmsüno zn spielen. Wer übrigens in
der That als Erfinder des Klaviers anzujehcn ist, wird
sich wohl schwerlich ausfindig machen lassen. Einige behaupten,
daß ein Florentiner, Bartolommeo Cristosori, es 1711 erfun-
den habe; Andere schreiben dies Verdienst dcni^ sächsischen
Orgelbauer Silbermann oder dem Dentschböhmcn Schröter zn;
endlich noch Andere wollen es einem englischen Mönch, dem
Pater Ward, znerkennen, welcher zn Anfang des vorigen Jahr-
hunderts in Nom lebte. Der erste Flügel — das was man
in England Franck piano nennt — war die Erfindung eines
Holländers, Namens Americus Lackers, der dieselbe im Jahre
1769 machte. —dn—
Schichten des deutschen Volkes eingedrnngen. Daß dem nicht
so war, dafür gibt es gar manche Beweise. Wenige Tage
vor der Schlacht bei Jena (1806) waren in einem Weinhanse
Weimar'z niehrere preußische Offizier e beisammen. Ein dicker
Major, der mit seinem Bataillon eben eingerückt war, ver-
mehrte die Gesellschaft. Er wurde gefragt, ob er gut ein-
quartiert sei und erwiederte: „Na, es geht ja an, ich liege
da in Quartier bei einem gewissen Gothe oder Goethe oder
wie der Kerl heißt!"
„Ach," rief ein junger Offizier, „das ist gewiß der be-
rühmte Dichter Goethe!"
„Das kann wohl sein," bemerkte der Major, indem er
sclbstznfriedcn lächelte nnd den Tabaksrauch vor sich hinblies;
„ich habe dem Kerl auf den Zahn gefühlt, und er scheint mir
Mucken im Kopse zn haben."
Ein ähnliches Vorkommnis; erzählte Goethe selbst am
5. Mai 1824: „Als ich vor einigen Jahren mich einige Zeit
in Jena aufhielt, lies; sich eines Morgens ein Student der
Theologie bei mir melden. Nachdem er sich eine Weile mit
mir ganz hübsch unterhalten hatte, rückte er beim Abschiede
gegen mich mit einem Anliegen ganz eigener Art hervor. Er-
bat mich nämlich, ihm doch am nächsten Sonntage zn erlauben,
statt meiner — predigen zn dürfen. Ich wußte sogleich, wo-
her der Wind wehte, und daß der junge Sachse einer von
denen sei, die das G und K verwechseln. Ich erwiederte ihm