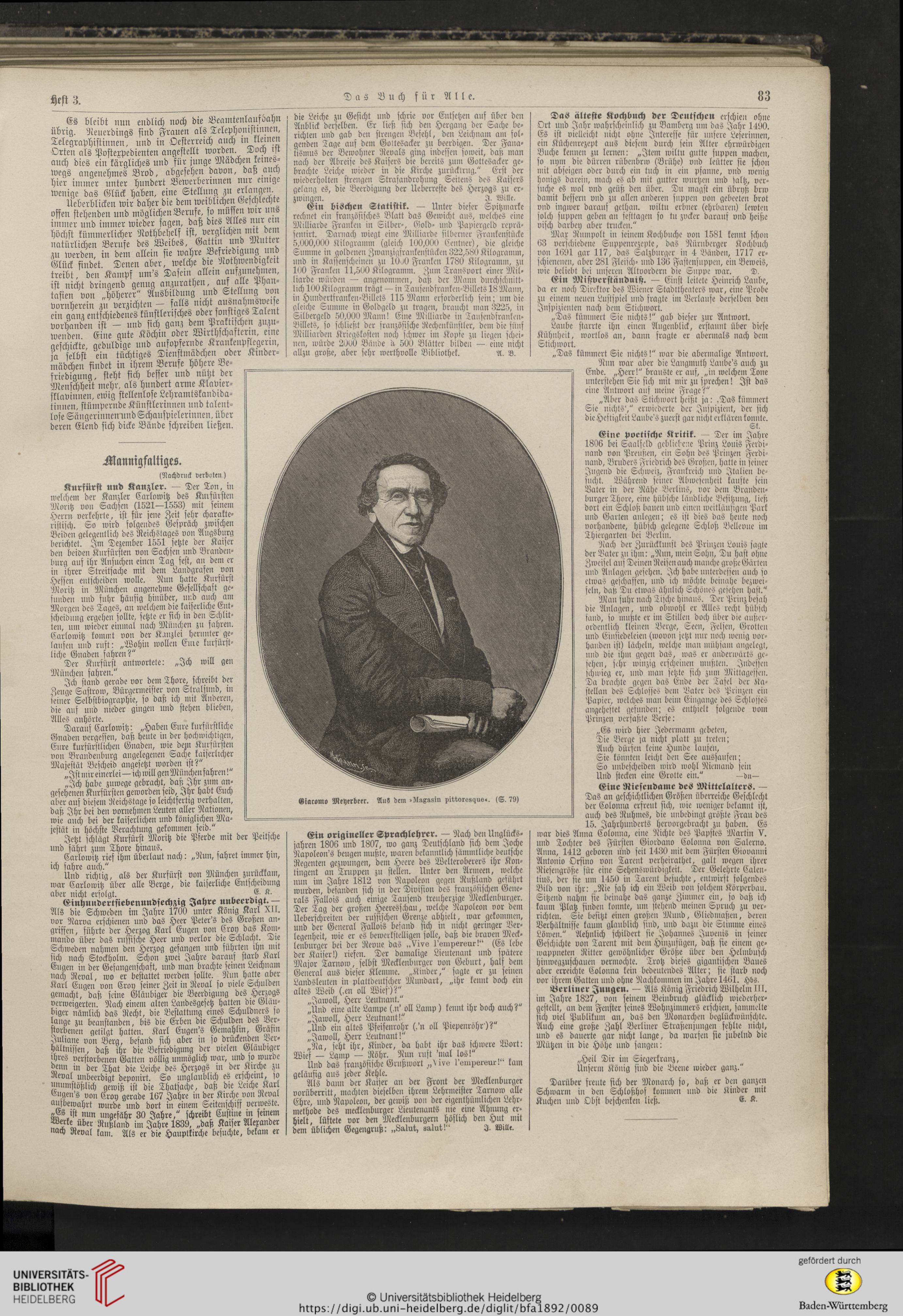Hrst 3.
Das Buch für Alle.
83
Daö älteste Kochbuch der Deutschen erschien ohne
Ort und Jahr wahrscheinlich zu Bamberg nm das Jahr 1490.
Es ist vielleicht nicht ohne Interesse sllr nnsere Leserinnen,
ein Küchenrezept aus diesem durch sein Alter ehrwürdigen
Buche kennen zu lernen: „Item willu gnlte suppen machen,
so nym die dürren rübenbrw (Brühe) und leütter sie schon
mit abseigen oder durch ei» Inch in ei» pfanne, vnd wenig
Honigs darein, mach es ab mit guttcr wnrtzcn und saltz, ver-
suche es wol vnd gcüsi den über. Dn magst ein übryß brw
damit bessern vnd zn allen andere» suppen von gebceten brot
vnd ingwer daraus gcthan. willu erbncr (ehrbaren) lewten
solch suppen geben an scstlage» so tn zvcker daraus vnd heiße
visch darbey aber trncken."
Max Rumpolt i» ieinem Kochbuchc von 1581 kennt schon
63 verschiedene Suppenrczepte, das Nürnberger Kochbuch
von 1691 gar 117, das Salzburger in 4 Bänden, 1717 er-
schienenen, aber 281 Fleisch- und 136 Fastensuppen, ein Beweis,
wie beliebt bei unseren Altvordern die Suppe war. D.
Ein Mistverständnih. — Einst leitete Heinrich Laube,
da er noch Direktor des Wiener Stadlthcaters war, eine Probe
zu einem neuen Lustspiel und sragle im Verlause derselben den
Inspizienten nach dem Stichwort.
„Das kümmert Sie nichts!" gab dieser zur Antwort.
Laube starrte ihn eine» Augenblick, erstaunt über diese
Kühnheit, wortlos an, dann fragte er abermals nach dem
Stichwort.
„Das kümmert Sic nichts!" war die abermalige Antwort.
Nun war aber die Langmuth Laube's auch zu
Ende. „Herr!" brauste er aus, „iu welchem Tone
unterstehen Sie sich mit mir zu sprechen! Ist das
eine Antwort ans meine Frage?"
„Aber das Stichwort heißt ja: ,Das kümmert
Sie nichts'," erwiederle der Inspizient, der sich
die Heftigkeit Laube's zuerst gar nicht erklären konnte.
St.
Eine poetische Kritik. Der im Jahre
1806 bei Saalscld gebliebene Prinz Louis Ferdi-
nand von Preußen, ein Sohn des Prinzen Ferdi-
nand, Bruders Friedrich des Großen, hatte in seiner
Jugend die Schweiz, Frankreich und Italien be-
sucht. Während seiner Abwesenheit kauste sein
Vater in der Nähe Berlins, vor dem Branden-
burger Thore, eine hübsche ländliche Besitzung, ließ
dort ein Schloß bauen und einen weitläufigen Park
und Garten anlegen; es ist dies das heute »och
vorhandene, hübsch gelegene Schloß Bellevue im
Thiergarten bei Berlin.
Nach der Zurücklunst des Prinzen Louis sagte
der Vater zn ihm: „Nun, mein Sohn, Du hast ohne
Zweifel aus Deinen Reisen auch manche große Gärten
und Anlagen gesehen. Ich habe unterdessen auch so
etwas geschaffen, und ich möchte beinahe bezwei-
seln, daß Du etwas ähnlich Schones gesehen hast."
Man suhr nach Tische hinaus. Der Prinz besah
die Anlagen, und obwohl er Alles recht hübsch
sand, io mußte er im Stillen doch über die außer-
ordentlich kleinen Berge, Seen, Felsen, Grollet,
und Einsiedeleien (wovon jetzt nur noch wenig vor-
handen ist) lächeln, welche man mühsam angelegt,
und die ihm gegen das, was er anderwärts ge-
sehen, sehr winzig erscheinen mußten. Indessen
schwieg er, nnd man setzte sich zum Mittagessen.
Da brachte gegen das Ende der Tasel der Ka-
stellan des Schlosses dem Vater des Prinzen ein
Papier, welches man beim Eingänge des Schlosses
angehcjtct gefnnden; es enthielt solgende vom
Prinzen versüßte Verse:
„Es wird hier Jedermann gebeten,
Die Berge ja nicht platt zu treten;
Auch dürfen keine Hunde laufen,
Sie könnten leicht den See aussansen;
So unbescheiden wird wohl Niemand sein
Und stecken eine Grotte ein." —du—
Eine Riesendame dcd Mittelalters. —
Das an geschichtlichen Größen überreiche Geschlecht
der Colonna erfreut sich, wie weniger bekannt ist,
auch des Ruhmes, die unbedingt grüßte Frau des
15. Jahrhunderts hervorgebracht zn haben. Es
war dies Anna Colonna, eine Nichte des Papstes Martin V.
nnd Tochter des Fürsten Giordano Colonna von Salerno.
Anna, 1412 geboren und seil 1430 mit dem Fürsten Giovanni
Antonio Orsino von Tarent verheirathet, galt wegen ihrer
Riesengröße sllr eine Sehenswürdigkeit. Der Gelehrte Calen-
tius, der sie um 1450 in Tarent besuchte, entwirft folgendes
Bild von ihr: „Nie sah ich ein Weib von solchen, Körperbau.
Sitzend nahm sie beinahe das ganze Zimmer ein, so daß ich
kaum Platz finden konnte, um stehend meinen Spruch zu ver-
richten. Sie besitzt einen großen Mund, Gliedmaßen, deren
Verhältnisse kaum glaublich sind, und dazu die Slinnne eines
Löwen." Aehnlich schildert sie Johannes Juvenis in seiner
Geschichte von Tarent mit den, Hinznsügen, daß sie einem ge-
wappneten Ritter gewöhnlicher Größe ühcr den Helmbusch
Hinwegzuschauen vermochle. Trotz dieses gigantischen Baues
aber erreichte Colonna kein bedeutendes Alter; sie starb noch
vor ihrem Gatten und ohne Nachkommen im Jahre 1461. Hbs.
Berliner Jungen. — Als König Friedrich Wilhelm 1 lI.
im Jahre 1827, von seinem Beinbruch glücklich wiederher-
gestellt, an dem Fenster seines Wohnzimmers erschien, sanunelle
sich viel Publikum an, das den Pionarchen heglückwünjchte.
Auch eine große Zahl Berliner Straßenjungen fehlte nicht,
und es dauerte gar nicht lange, da warjen sie jubelnd die
Mützen in die Höhe und sangen:
„Heil Dir im Siegerkranz,
Unser», König sind die Acene wieder ganz."
Darüber srente sich der Monarch so, daß er den ganzen
Schwarm in den Schloßhvf kommen nnd die Kinder mit
Kuchen und Obst beschenken ließ. E. K
Giacomo Meyerbeer. Aus dem -Kaxasii, Mtoresgus«. <S. 79)
Es bleibt nun endlich noch die Beamtenlaufüahn
übrig. Neuerdings sind Frauen als Telephonistinnen,
Telegraphistinnen, und in Oesterreich auch in kleinen
Orten als Postexpedicnten angestellt worden. Doch ist
auch dies ein kärgliches und für junge Mädchen keines-
wegs, angenehmes Brod, abgesehen davon, daß auch
hier immer unter hundert Bewerberinnen nur einige
wenige das Glück haben, eine Stellung zn erlangen.
Uebcrblicken wir daher die dem weiblichen Geschlechte
offen stehenden und möglichen Berufe, so müssen wir uns
immer und immer wieder sagen, daß dies Alles nur ein
höchst kümmerlicher Nothbehelf ist, verglichen mit dem
natürlichen Berufe des Weibes, Gattin und Mutter
zu werden, in dem allein sie wahre Befriedigung nnd
Glück findet. Denen aber, welche die Nothwendigkeit
treibt, den Kampf um's Dasein allein aufzunehmen,
ist nicht dringend genug anzurathen, auf alle Phan-
tasien von „höherer" Ausbildung und Stellung von
vornherein zn verzichten — falls nicht ausnahmsweise
ein ganz entschiedenes künstlerisches oder sonstiges Talent
vorhanden ist — und sich ganz dem Praktischen zuzu-
wenden. Eine gute Köchin oder Wirthschafterin, eine
geschickte, geduldige und aufopfernde Krankenpflegerin,
ja selbst ein tüchtiges Dienstmädchen oder Kinder-
mädchen findet in ihrem Berufe höhere Be-
friedigung, steht sich besser und nützt der
Menschheit mehr, als hundert arme Klavier-
sklavinnen, ewig stellenlose Lehramtskandida-
tinnen, stümpernde Künstlerinnen und talent-
lose Sängerinnen und Schauspielerinnen, über
deren Elend sich dicke Bände schreiben ließen.
> die Leiche zu Gesicht und schrie vor Entsetzen aus über deu
Anblick derselben. Er ließ sich den Hergang der Sache be-
richten und gab den strengen Befehl, den Leichnam am fol-
genden Tage aus dem Gottesacker zu beerdigen. Der Fana-
tismus der Bewohner Revals ging indessen soweit, daß man
nach der Abreise des Kaisers die bereits zum Gottesacker ge-
brachte Leiche wieder in die Kirche zurücktrug." Erst der
wiederholten strengen Strafandrohung Seilens des Kaisers
gelang es, die Beerdigung der Ueberreste des Herzogs zu er-
zwingen. I. Wille.
Ein bischen Statistik. — Unter dieser Spitzmarke
rechnet ein französisches Blatt das Gewicht aus, welches eine
Milliarde Frauken in Silber-, Gold- und Papiergeld reprä-
semirt. Darnach wiegt eine Milliarde silberner Frankenstücke
5,000,000 Kilogramm (gleich 100,000 Ccntner), die gleiche
Summe in goldenen Zwanzigsrankenstücken 322,580 Kilogramm,
und in Kassenscheinen zu lOoO Franken 1780 Kilogramm, zu
100 Franken 11,500 Kilogramm. Zum Trausvort einer Mil-
liarde würden — angenommen, daß der Alaun durchschnitt-
lich lOOKilogramm trägt — in Taujendsrankcn-Billets18Maun,
in Hundertsranken-Billets 115 Mann erforderlich sein; um die
gleiche Summe in Goldgeld zu tragen, braucht inan 3225, iu
Silbergeld 50,000 Mann! Eine Milliarde in Tausendsranlen-
Billets, so schließt der sranzösische Rechenkünstler, dem die fünf
Milliarden Kriegskosten noch schwer im Kopie zu liegen schei-
nen, würde 2000 Bände ü 500 Blälter bilden — eine nicht
allzu große, aber sehr werthvolle Bibliothek. A. B.
Mannigfaltiges.
(Nachdruck verbalen )
Kurfürst und Kanzler. — Der Ton, iu
welchem der Kanzler Carlowitz des Kurfürsten
Moritz von Sachsen (1521—1553) mit seinem
Herrn verkehrte, ist für jene Zeit sehr charakte-
ristisch. So wird folgendes Gespräch zwischen
Beiden gelegentlich des Reichstages von Augsburg
berichtet. Im Dezember 1551 setzte der Kaiser
den beioen Kurfürsten von Sachsen und Branden-
burg auf ihr Ansuchen einen Tag fest, an dem er
in ihrer Streitsache mit dem Landgrafen von
Hessen entscheiden wolle. Nun hatte Kurfürst
Moritz in München angenehme Gesellschaft ge-
sunden und fuhr häufig hinüber, nnd auch am
Morgen des Tages, an welchem die kaiserliche Ent-
scheidung ergehen sollte, setzte er sich in den Schlit-
ten, um wieder einmal nach München zu fahren.
Carlowitz kommt von der Kanzlei herunter ge-
laufen und ruft: „Wohin wollen Eure kurfürst-
liche Gnaden fahren?"
Der Kurfürst antwortete: „Ich will gen
München fahren."
Ich stand gerade vor dem Thore, schreibt der
Zeuge Sastrow, Bürgermeister von Stralsund, in
seiner Selbstbiographie, so daß ich mit Anderen,
die auf und nieder gingen und stehen blieben,
Alles anhörte.
Darauf Carlowitz: „Haben Eure kurfürstliche
Gnaden vergessen, daß heute in der hochwichtigen,
Eure kurfürstlichen Gnaden, wie dein Kurfürsten
von Brandenburg angelegenen Sache kaiserlicher
Majestät Bescheid angesetzt worden ist?"
„Ist mir einerlei—ich will gen München fahren!"
„Ich habe zuwege gebracht, daß Ihr zum an-
gesehenen Kurfürsten geworden seid, Ihr habt Euch
aber aus diesem Reichstage so leichtfertig verhalten,
daß Ihr bei den vornehmen Leuten aller Nationen,
wie auch bei der kaiserlichen und königlichen Ma-
jestät in höchste Verachtung gekommen seid."
Jetzt schlägt Kurfürst Moritz die Pferde mit der Peitsche
und fährt zum Thore hinaus.
Carlowitz rief ihm überlaut nach: „Nun, fahret immer hin,
ich fahre auch."
Und richtig, als der Kurfürst von München zurückkam,
war Carlowitz über alle Berge, die kaiserliche Entscheidung
aber nicht ersolgt. E. K.
Einhundertsiebenundsechzig Jahre unbeerdigt. —
Als die Schweden im Jahre 1700 unter König Karl XII.
vor Narva erschienen rind das Heer Peter's des Großen an-
griffen, führte der Herzog Karl Eugen von Croy das Kom-
mando über das russische Heer und verlor die Schlacht. Die
Schweden nahmen den Herzog gefangen und führten ihn mit
sich nach Stockholm. Schon zwei Jahre daraus starb Karl
Eugen in der Gefangenschaft, und man brachte seinen Leichnam
»ach Reval, wo er bestattet werden sollte. Nun hatte aber
Karl Engen von Croy seiner Zeit in Reval jo viele Schulden
gemacht, daß seine Gläubiger die Beerdigung des Herzogs
verweigerten. Nach einem alten Landesgesetz hatten die Gläu-
biger nämlich das Recht, die Bestattung eines Schuldners so
ig»ge zu beanstanden, bis die Erben die Schulden des Ver-
storbenen getilgt hatten. Karl Eugenfs Gemahlin, Gräfin
>mliane von Berg, befand sich aber in so drückenden Ver-
bEnisse», daß ihr die Befriedigung der vielen Gläubiger
ihres verstorbenen Gatten völlig unmöglich war, und so wurde
oenn in der That die Leiche des Herzogs in der Kirche zu
, vm unbeertzjgt deponirt. So unglaublich es erscheint, jo
innnstößlich gewiß ist die Thatsache, daß die Leiche Karl
Croy gerade 167 Jahre iu der Kirche von Reval
nivewahrt wurde und dort in einem Seitenschiff verweste.
ungefähr 30 Jahre," schreibt Custiue in seinem
„7^ke über Rußland im Jahre 1839, „daß Kaiser Alexander
H Reval kam. Als er die Hauptkirche besuchte, bekam er
Ein origineller Sprachlehrer. — Nach den Unglücks-
jähren 1806 und 1807, wo ganz Deutschland sich dem Joche
Napoleons beugen mußte, waren bekanntlich sämmtliche deutsche
Regenten gezwungen, dem Heere des Welteroberers ihr Kon-
tingent an Truppen zu stellen. Unter den Armeen, welche
nun im Jahre 1812 von Napoleon gegen Rußland geführt
wurden, befanden sich in der Division des französischen Gene-
rals Fallens auch einige Tausend treuherzige Mecklenburger.
Der Tag der großen Heeresschau, welche Napoleon vor dem
Ueberschreiten der russischen Grenze abhielt, war gekommen,
und der General Fallois besand sich in nicht geringer Ver-
legenheit, wie er es bewerkstelligen solle, daß die braven Meck-
lenburger bei der Revue das „Vivs I'einpersur!" (Es lebe
der Kaiser!) riefen. Der damalige Lieutenant und spätere
Major Tarnow, selbst Mecklenburger von Geburt, half dem
General aus dieser Klemme. „Kinder," sagte er zu seinen
Landsleuten in plattdeutscher Mundart, „ihr kennt doch ein
altes Weib (,en oll Wies')?"
„Jawoll, Herr Leutnant."
„Und eine alte Lampe ( n' oll Lamp) kennt ihr doch auch?"
„Jawoll, Herr Leutnant!"
„Und ein altes Pfeifenrohr (,'n oll Piepenrühr')?"
„Jawoll, Herr Leutnant!"
„Na, seht ihr, Kinder, da habt ihr das schwere Wort:
Wies — Lamp — Röhr. Nun ruft 'mal los!"
Und das französische Grußwort Ivo I'smporsur!" kam
geläufig aus jeder Kehle.
Als daun der Kaiser an der Front der Mecklenburger
vorüberritt, machten dieselben ihrem Lehrmeister Tarnow alle
Ehre, und Napoleon, der geiviß von der eigenthümlichen Lehr-
methode des mecklenburger Lieutenants nie eine Ahnung er-
hielt, lüstete vor den Mecklenburgern höflich den Hut mit
dem üblichen Gegengrub: „Salut, salut!" I. Wille.
Das Buch für Alle.
83
Daö älteste Kochbuch der Deutschen erschien ohne
Ort und Jahr wahrscheinlich zu Bamberg nm das Jahr 1490.
Es ist vielleicht nicht ohne Interesse sllr nnsere Leserinnen,
ein Küchenrezept aus diesem durch sein Alter ehrwürdigen
Buche kennen zu lernen: „Item willu gnlte suppen machen,
so nym die dürren rübenbrw (Brühe) und leütter sie schon
mit abseigen oder durch ei» Inch in ei» pfanne, vnd wenig
Honigs darein, mach es ab mit guttcr wnrtzcn und saltz, ver-
suche es wol vnd gcüsi den über. Dn magst ein übryß brw
damit bessern vnd zn allen andere» suppen von gebceten brot
vnd ingwer daraus gcthan. willu erbncr (ehrbaren) lewten
solch suppen geben an scstlage» so tn zvcker daraus vnd heiße
visch darbey aber trncken."
Max Rumpolt i» ieinem Kochbuchc von 1581 kennt schon
63 verschiedene Suppenrczepte, das Nürnberger Kochbuch
von 1691 gar 117, das Salzburger in 4 Bänden, 1717 er-
schienenen, aber 281 Fleisch- und 136 Fastensuppen, ein Beweis,
wie beliebt bei unseren Altvordern die Suppe war. D.
Ein Mistverständnih. — Einst leitete Heinrich Laube,
da er noch Direktor des Wiener Stadlthcaters war, eine Probe
zu einem neuen Lustspiel und sragle im Verlause derselben den
Inspizienten nach dem Stichwort.
„Das kümmert Sie nichts!" gab dieser zur Antwort.
Laube starrte ihn eine» Augenblick, erstaunt über diese
Kühnheit, wortlos an, dann fragte er abermals nach dem
Stichwort.
„Das kümmert Sic nichts!" war die abermalige Antwort.
Nun war aber die Langmuth Laube's auch zu
Ende. „Herr!" brauste er aus, „iu welchem Tone
unterstehen Sie sich mit mir zu sprechen! Ist das
eine Antwort ans meine Frage?"
„Aber das Stichwort heißt ja: ,Das kümmert
Sie nichts'," erwiederle der Inspizient, der sich
die Heftigkeit Laube's zuerst gar nicht erklären konnte.
St.
Eine poetische Kritik. Der im Jahre
1806 bei Saalscld gebliebene Prinz Louis Ferdi-
nand von Preußen, ein Sohn des Prinzen Ferdi-
nand, Bruders Friedrich des Großen, hatte in seiner
Jugend die Schweiz, Frankreich und Italien be-
sucht. Während seiner Abwesenheit kauste sein
Vater in der Nähe Berlins, vor dem Branden-
burger Thore, eine hübsche ländliche Besitzung, ließ
dort ein Schloß bauen und einen weitläufigen Park
und Garten anlegen; es ist dies das heute »och
vorhandene, hübsch gelegene Schloß Bellevue im
Thiergarten bei Berlin.
Nach der Zurücklunst des Prinzen Louis sagte
der Vater zn ihm: „Nun, mein Sohn, Du hast ohne
Zweifel aus Deinen Reisen auch manche große Gärten
und Anlagen gesehen. Ich habe unterdessen auch so
etwas geschaffen, und ich möchte beinahe bezwei-
seln, daß Du etwas ähnlich Schones gesehen hast."
Man suhr nach Tische hinaus. Der Prinz besah
die Anlagen, und obwohl er Alles recht hübsch
sand, io mußte er im Stillen doch über die außer-
ordentlich kleinen Berge, Seen, Felsen, Grollet,
und Einsiedeleien (wovon jetzt nur noch wenig vor-
handen ist) lächeln, welche man mühsam angelegt,
und die ihm gegen das, was er anderwärts ge-
sehen, sehr winzig erscheinen mußten. Indessen
schwieg er, nnd man setzte sich zum Mittagessen.
Da brachte gegen das Ende der Tasel der Ka-
stellan des Schlosses dem Vater des Prinzen ein
Papier, welches man beim Eingänge des Schlosses
angehcjtct gefnnden; es enthielt solgende vom
Prinzen versüßte Verse:
„Es wird hier Jedermann gebeten,
Die Berge ja nicht platt zu treten;
Auch dürfen keine Hunde laufen,
Sie könnten leicht den See aussansen;
So unbescheiden wird wohl Niemand sein
Und stecken eine Grotte ein." —du—
Eine Riesendame dcd Mittelalters. —
Das an geschichtlichen Größen überreiche Geschlecht
der Colonna erfreut sich, wie weniger bekannt ist,
auch des Ruhmes, die unbedingt grüßte Frau des
15. Jahrhunderts hervorgebracht zn haben. Es
war dies Anna Colonna, eine Nichte des Papstes Martin V.
nnd Tochter des Fürsten Giordano Colonna von Salerno.
Anna, 1412 geboren und seil 1430 mit dem Fürsten Giovanni
Antonio Orsino von Tarent verheirathet, galt wegen ihrer
Riesengröße sllr eine Sehenswürdigkeit. Der Gelehrte Calen-
tius, der sie um 1450 in Tarent besuchte, entwirft folgendes
Bild von ihr: „Nie sah ich ein Weib von solchen, Körperbau.
Sitzend nahm sie beinahe das ganze Zimmer ein, so daß ich
kaum Platz finden konnte, um stehend meinen Spruch zu ver-
richten. Sie besitzt einen großen Mund, Gliedmaßen, deren
Verhältnisse kaum glaublich sind, und dazu die Slinnne eines
Löwen." Aehnlich schildert sie Johannes Juvenis in seiner
Geschichte von Tarent mit den, Hinznsügen, daß sie einem ge-
wappneten Ritter gewöhnlicher Größe ühcr den Helmbusch
Hinwegzuschauen vermochle. Trotz dieses gigantischen Baues
aber erreichte Colonna kein bedeutendes Alter; sie starb noch
vor ihrem Gatten und ohne Nachkommen im Jahre 1461. Hbs.
Berliner Jungen. — Als König Friedrich Wilhelm 1 lI.
im Jahre 1827, von seinem Beinbruch glücklich wiederher-
gestellt, an dem Fenster seines Wohnzimmers erschien, sanunelle
sich viel Publikum an, das den Pionarchen heglückwünjchte.
Auch eine große Zahl Berliner Straßenjungen fehlte nicht,
und es dauerte gar nicht lange, da warjen sie jubelnd die
Mützen in die Höhe und sangen:
„Heil Dir im Siegerkranz,
Unser», König sind die Acene wieder ganz."
Darüber srente sich der Monarch so, daß er den ganzen
Schwarm in den Schloßhvf kommen nnd die Kinder mit
Kuchen und Obst beschenken ließ. E. K
Giacomo Meyerbeer. Aus dem -Kaxasii, Mtoresgus«. <S. 79)
Es bleibt nun endlich noch die Beamtenlaufüahn
übrig. Neuerdings sind Frauen als Telephonistinnen,
Telegraphistinnen, und in Oesterreich auch in kleinen
Orten als Postexpedicnten angestellt worden. Doch ist
auch dies ein kärgliches und für junge Mädchen keines-
wegs, angenehmes Brod, abgesehen davon, daß auch
hier immer unter hundert Bewerberinnen nur einige
wenige das Glück haben, eine Stellung zn erlangen.
Uebcrblicken wir daher die dem weiblichen Geschlechte
offen stehenden und möglichen Berufe, so müssen wir uns
immer und immer wieder sagen, daß dies Alles nur ein
höchst kümmerlicher Nothbehelf ist, verglichen mit dem
natürlichen Berufe des Weibes, Gattin und Mutter
zu werden, in dem allein sie wahre Befriedigung nnd
Glück findet. Denen aber, welche die Nothwendigkeit
treibt, den Kampf um's Dasein allein aufzunehmen,
ist nicht dringend genug anzurathen, auf alle Phan-
tasien von „höherer" Ausbildung und Stellung von
vornherein zn verzichten — falls nicht ausnahmsweise
ein ganz entschiedenes künstlerisches oder sonstiges Talent
vorhanden ist — und sich ganz dem Praktischen zuzu-
wenden. Eine gute Köchin oder Wirthschafterin, eine
geschickte, geduldige und aufopfernde Krankenpflegerin,
ja selbst ein tüchtiges Dienstmädchen oder Kinder-
mädchen findet in ihrem Berufe höhere Be-
friedigung, steht sich besser und nützt der
Menschheit mehr, als hundert arme Klavier-
sklavinnen, ewig stellenlose Lehramtskandida-
tinnen, stümpernde Künstlerinnen und talent-
lose Sängerinnen und Schauspielerinnen, über
deren Elend sich dicke Bände schreiben ließen.
> die Leiche zu Gesicht und schrie vor Entsetzen aus über deu
Anblick derselben. Er ließ sich den Hergang der Sache be-
richten und gab den strengen Befehl, den Leichnam am fol-
genden Tage aus dem Gottesacker zu beerdigen. Der Fana-
tismus der Bewohner Revals ging indessen soweit, daß man
nach der Abreise des Kaisers die bereits zum Gottesacker ge-
brachte Leiche wieder in die Kirche zurücktrug." Erst der
wiederholten strengen Strafandrohung Seilens des Kaisers
gelang es, die Beerdigung der Ueberreste des Herzogs zu er-
zwingen. I. Wille.
Ein bischen Statistik. — Unter dieser Spitzmarke
rechnet ein französisches Blatt das Gewicht aus, welches eine
Milliarde Frauken in Silber-, Gold- und Papiergeld reprä-
semirt. Darnach wiegt eine Milliarde silberner Frankenstücke
5,000,000 Kilogramm (gleich 100,000 Ccntner), die gleiche
Summe in goldenen Zwanzigsrankenstücken 322,580 Kilogramm,
und in Kassenscheinen zu lOoO Franken 1780 Kilogramm, zu
100 Franken 11,500 Kilogramm. Zum Trausvort einer Mil-
liarde würden — angenommen, daß der Alaun durchschnitt-
lich lOOKilogramm trägt — in Taujendsrankcn-Billets18Maun,
in Hundertsranken-Billets 115 Mann erforderlich sein; um die
gleiche Summe in Goldgeld zu tragen, braucht inan 3225, iu
Silbergeld 50,000 Mann! Eine Milliarde in Tausendsranlen-
Billets, so schließt der sranzösische Rechenkünstler, dem die fünf
Milliarden Kriegskosten noch schwer im Kopie zu liegen schei-
nen, würde 2000 Bände ü 500 Blälter bilden — eine nicht
allzu große, aber sehr werthvolle Bibliothek. A. B.
Mannigfaltiges.
(Nachdruck verbalen )
Kurfürst und Kanzler. — Der Ton, iu
welchem der Kanzler Carlowitz des Kurfürsten
Moritz von Sachsen (1521—1553) mit seinem
Herrn verkehrte, ist für jene Zeit sehr charakte-
ristisch. So wird folgendes Gespräch zwischen
Beiden gelegentlich des Reichstages von Augsburg
berichtet. Im Dezember 1551 setzte der Kaiser
den beioen Kurfürsten von Sachsen und Branden-
burg auf ihr Ansuchen einen Tag fest, an dem er
in ihrer Streitsache mit dem Landgrafen von
Hessen entscheiden wolle. Nun hatte Kurfürst
Moritz in München angenehme Gesellschaft ge-
sunden und fuhr häufig hinüber, nnd auch am
Morgen des Tages, an welchem die kaiserliche Ent-
scheidung ergehen sollte, setzte er sich in den Schlit-
ten, um wieder einmal nach München zu fahren.
Carlowitz kommt von der Kanzlei herunter ge-
laufen und ruft: „Wohin wollen Eure kurfürst-
liche Gnaden fahren?"
Der Kurfürst antwortete: „Ich will gen
München fahren."
Ich stand gerade vor dem Thore, schreibt der
Zeuge Sastrow, Bürgermeister von Stralsund, in
seiner Selbstbiographie, so daß ich mit Anderen,
die auf und nieder gingen und stehen blieben,
Alles anhörte.
Darauf Carlowitz: „Haben Eure kurfürstliche
Gnaden vergessen, daß heute in der hochwichtigen,
Eure kurfürstlichen Gnaden, wie dein Kurfürsten
von Brandenburg angelegenen Sache kaiserlicher
Majestät Bescheid angesetzt worden ist?"
„Ist mir einerlei—ich will gen München fahren!"
„Ich habe zuwege gebracht, daß Ihr zum an-
gesehenen Kurfürsten geworden seid, Ihr habt Euch
aber aus diesem Reichstage so leichtfertig verhalten,
daß Ihr bei den vornehmen Leuten aller Nationen,
wie auch bei der kaiserlichen und königlichen Ma-
jestät in höchste Verachtung gekommen seid."
Jetzt schlägt Kurfürst Moritz die Pferde mit der Peitsche
und fährt zum Thore hinaus.
Carlowitz rief ihm überlaut nach: „Nun, fahret immer hin,
ich fahre auch."
Und richtig, als der Kurfürst von München zurückkam,
war Carlowitz über alle Berge, die kaiserliche Entscheidung
aber nicht ersolgt. E. K.
Einhundertsiebenundsechzig Jahre unbeerdigt. —
Als die Schweden im Jahre 1700 unter König Karl XII.
vor Narva erschienen rind das Heer Peter's des Großen an-
griffen, führte der Herzog Karl Eugen von Croy das Kom-
mando über das russische Heer und verlor die Schlacht. Die
Schweden nahmen den Herzog gefangen und führten ihn mit
sich nach Stockholm. Schon zwei Jahre daraus starb Karl
Eugen in der Gefangenschaft, und man brachte seinen Leichnam
»ach Reval, wo er bestattet werden sollte. Nun hatte aber
Karl Engen von Croy seiner Zeit in Reval jo viele Schulden
gemacht, daß seine Gläubiger die Beerdigung des Herzogs
verweigerten. Nach einem alten Landesgesetz hatten die Gläu-
biger nämlich das Recht, die Bestattung eines Schuldners so
ig»ge zu beanstanden, bis die Erben die Schulden des Ver-
storbenen getilgt hatten. Karl Eugenfs Gemahlin, Gräfin
>mliane von Berg, befand sich aber in so drückenden Ver-
bEnisse», daß ihr die Befriedigung der vielen Gläubiger
ihres verstorbenen Gatten völlig unmöglich war, und so wurde
oenn in der That die Leiche des Herzogs in der Kirche zu
, vm unbeertzjgt deponirt. So unglaublich es erscheint, jo
innnstößlich gewiß ist die Thatsache, daß die Leiche Karl
Croy gerade 167 Jahre iu der Kirche von Reval
nivewahrt wurde und dort in einem Seitenschiff verweste.
ungefähr 30 Jahre," schreibt Custiue in seinem
„7^ke über Rußland im Jahre 1839, „daß Kaiser Alexander
H Reval kam. Als er die Hauptkirche besuchte, bekam er
Ein origineller Sprachlehrer. — Nach den Unglücks-
jähren 1806 und 1807, wo ganz Deutschland sich dem Joche
Napoleons beugen mußte, waren bekanntlich sämmtliche deutsche
Regenten gezwungen, dem Heere des Welteroberers ihr Kon-
tingent an Truppen zu stellen. Unter den Armeen, welche
nun im Jahre 1812 von Napoleon gegen Rußland geführt
wurden, befanden sich in der Division des französischen Gene-
rals Fallens auch einige Tausend treuherzige Mecklenburger.
Der Tag der großen Heeresschau, welche Napoleon vor dem
Ueberschreiten der russischen Grenze abhielt, war gekommen,
und der General Fallois besand sich in nicht geringer Ver-
legenheit, wie er es bewerkstelligen solle, daß die braven Meck-
lenburger bei der Revue das „Vivs I'einpersur!" (Es lebe
der Kaiser!) riefen. Der damalige Lieutenant und spätere
Major Tarnow, selbst Mecklenburger von Geburt, half dem
General aus dieser Klemme. „Kinder," sagte er zu seinen
Landsleuten in plattdeutscher Mundart, „ihr kennt doch ein
altes Weib (,en oll Wies')?"
„Jawoll, Herr Leutnant."
„Und eine alte Lampe ( n' oll Lamp) kennt ihr doch auch?"
„Jawoll, Herr Leutnant!"
„Und ein altes Pfeifenrohr (,'n oll Piepenrühr')?"
„Jawoll, Herr Leutnant!"
„Na, seht ihr, Kinder, da habt ihr das schwere Wort:
Wies — Lamp — Röhr. Nun ruft 'mal los!"
Und das französische Grußwort Ivo I'smporsur!" kam
geläufig aus jeder Kehle.
Als daun der Kaiser an der Front der Mecklenburger
vorüberritt, machten dieselben ihrem Lehrmeister Tarnow alle
Ehre, und Napoleon, der geiviß von der eigenthümlichen Lehr-
methode des mecklenburger Lieutenants nie eine Ahnung er-
hielt, lüstete vor den Mecklenburgern höflich den Hut mit
dem üblichen Gegengrub: „Salut, salut!" I. Wille.