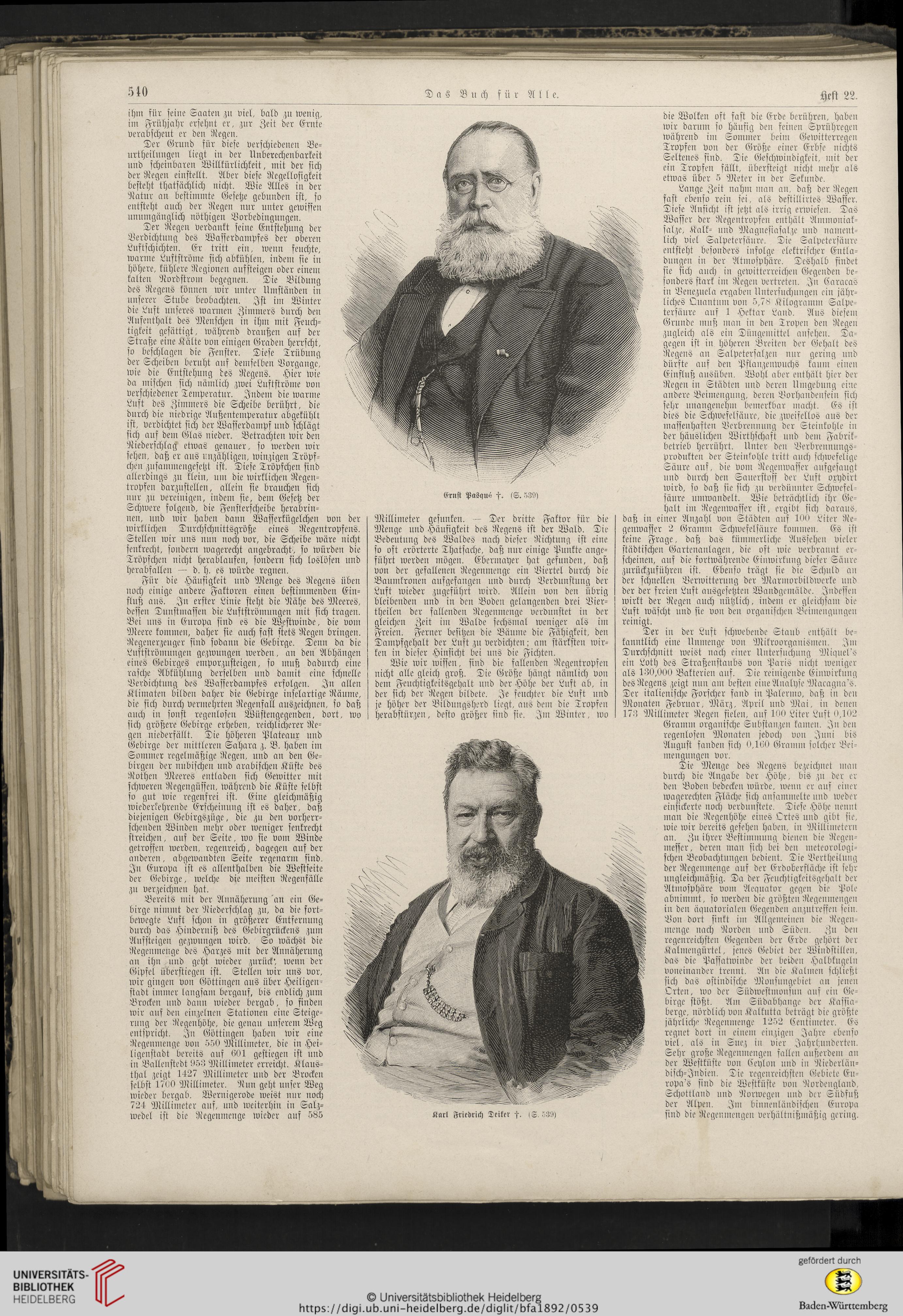510
Das Buch für Alle.
6eN 22.
ihm für seine Saaten zu viel, bald zu wenig,
im Frühjahr ersehnt er, zur Zeit der Ernte
verabscheut er den Regen.
Der Grund für diese verschiedenen Be-
urtheilungcn liegt in der Unberechenbarkeit
und scheinbaren Willkürlichkeit, mit der sich
der Regen einstellt. Aber diese Regellosigkeit
besteht thatsächlich nicht. Wie Alles in'der
Natur an bestimmte Gesetze gebunden ist, so
entsteht auch der Regen nur unter gewissen
unumgänglich nöthigen Vorbedingungen.
Der Regen verdankt seine Entstehung der
Verdichtung des Wasserdampfes der oberen
Luftschichten. Er tritt ein, wenn feuchte,
warme Luftströme sich abkühlen, indem sie in
höhere, kühlere Regionen aufsteigen oder einein
kalten Nordstrom begegnen. Die Bildung
des Regens können wir unter Umständen in
unserer Stube beobachten. Ist im Winter
die Luft unseres warmen Zimmers durch den
Aufenthalt des Menschen in ihm mit Feuch-
tigkeit gesättigt, während draußen auf der
Straße eine Külte von einigen Graden herrscht,
so beschlagen die Fenster. Diese Trübung
der Scheiben beruht ans demselben Vorgänge,
wie die Entstehung des Regens. Hier wie
da mischen sich nämlich zwei Luftströme von
verschiedener Temperatur. Indem die warme
Luft des Zimmers die Scheibe berührt, die
durch die niedrige Außentemperatur abgekühlt
ist, verdichtet sich der Wasserdampf und schlägt
sich auf dein Glas nieder. Betrachten wir den
Niederschlag etwas genauer, so werden wir
sehen, daß er aus unzähligen, winzigen Tröpf-
chen zusammengesetzt ist. Diese Tröpfchen sind
allerdings zu klein, um die wirklichen Regen-
tropfen darzustellen, allein sie brauchen sich
nur zu vereinigen, indem sie, dem Gesetz der
Schwere folgend, die Fensterscheibe herabrin-
nen, und wir haben dann Wasscrkügclchen von der
wirklichen Durchschnittsgröße eines Regentropfens.
Stellen wir uns nun noch vor, die Scheibe wäre nicht
senkrecht, sondern wagerecht angebracht, so würden die
Tröpfchen nicht herablanfen, sondern sich loslösen und
herabfallen — d. h. es würde regneu.
Für die Häufigkeit und Menge des Regens üben
noch einige andere Faktoren einen bestimmenden Ein-
fluß ans. In erster Linie steht die Nähe des Meeres,
dessen Dunstmassen die Luftströmungen mit sich tragen.
Bei uns in Europa sind es die W.estwinde, die vom
Meere kommen, daher sie auch fast stets Regen bringen.
Regenerzenger sind sodann die Gebirge. Denn da die
Luftströmungen gezwungen werden, an den Abhängen
eines Gebirges emporznsteigen, so muß dadurch eine
rasche Abkühlung derselben und damit eine schnelle
Verdichtung des Wasserdampfes erfolgen. In allen
Klimaten bilden daher die Gebirge inselartige Räume,
die sich durch vermehrten Regenfall auszeichnen, so daß
auch in sonst regenlosen Wnstengegendcn, dort, wo
sich größere Gebirge erheben, reichlicherer Re-
gen niederfällt. Die höheren Plateaux und
Gebirge der mittleren Sahara z. B. haben im
Sommer regelmäßige Regen, und an den Ge-
birgen der nnbischen und arabischen Küste des
Rothen Meeres entladen sich Gewitter mit
schweren Regengüssen, während die Küste selbst
so gut wie regenfrei ist. Eine gleichmäßig
wiederkehrende Erscheinung ist es daher, daß
diejenigen Gebirgszüge, die zu den vorherr-
schenden Winden mehr oder weniger senkrecht
streichen, auf der Seite, wo sie von: Winde
getroffen werden, regenreich, dagegen auf der
anderen, abgewandten Seite regenarm sind.
In Europa ist es allenthalben die Westseite
der Gebirge, welche die meisten Regensälle
zu verzeichnen hat.
Bereits mit der Annäherung 'an ein Ge-
birge nimmt der Niederschlag zu, da die fort-
bewegte Luft schon in größerer Entfernung
durch das Hinderniß des Gebirgrückens zum
Aufsteigen gezwungen wird. So wächst die
Regenmenge des Harzes mit der Annäherung
an ihn und geht wieder zurück', wenn der
Gipfel überstiegen ist. Stellen wir uns vor,
wir gingen von Göttingen aus über Heiligen-
stadt immer langsam bergauf, bis endlich zum
Brocken und dann wieder bergab, so finden
wir auf den einzelnen Stationen eine Steige-
rung der Regcnhöhe, die genau unserem Weg
entspricht. In Göttingen haben wir eine
Regenmenge von 550 Millimeter, die in Hei-
ligenstadt bereits auf 601 gestiegen ist und
in Ballenstedt 055 Millimeter erreicht. Klaus-
thal zeigt 1427 Millimeter und der Brocken
selbst 1700 Millimeter. Run geht unser Weg
wieder bergab. Wernigerode weist nur noch
724 Millimeter auf, und weiterhin in Salz-
wedel ist die Regenmenge wieder auf 585
Ernst Pasqns h. (S. S3S)
Millimeter gesunken. — Der dritte Faktor für die
Menge und Häufigkeit des Regens ist der Wald. Die
Bedeutung des Waldes nach dieser Richtung ist eine
so oft erörterte Thatsache, daß nur einige Punkte ange-
sührt werden mögen. Ebermayer hat gesunden, daß
von der gefallenen Regenmenge ein Viertel durch die
Baumkronen aufgefangen und durch Verdunstung der
Luft wieder zugeführt wird. Allein von den übrig
bleibenden und in den Boden gelangenden drei Vier-
theilen der fallenden Regenmenge verdunstet in der
gleichen Zeit im Walde sechsmal weniger als im
Freien. Ferner besitzen die Bäume die Fähigkeit, den
Dampfgehält der Luft zu verdichten; am stärksten wir-
ken in dieser Hinsicht bei uns die Fichten.
Wie wir wissen, sind die fällenden Regentropfen
nicht alle gleich groß. Die Größe hängt nämlich von
dem Feuchtigkeitsgehalt und der Höhe der Luft ab, in
der sich der Regen bildete. Je feuchter die Luft und
je höher der Bildungsherd liegt, aus dem die Tropfen
herabstürzen, desto größer sind sie. Im Winter, wo
Uarl Friedrich Trikcr p. <2 '30)
die Wolken oft fast die Erde berühren, haben
wir darum so häufig den feinen Sprühregen
während im Sommer beim Gewitterregen
Tropfen von der Größe einer Erbse nichts
Seltenes sind. Die Geschwindigkeit, mit der
ein Lropfen fällt, übersteigt nicht mehr als
etwas über 5 Meter in der Sekunde.
Lange Zeit nahm inan an, daß der Regen
fast ebenso rein sei, als destillirtes Wasser.
Diese Ansicht ist jetzt als irrig erwiesen. Das
Wasser der Regentropfen enthält Ammoniak-
salze, Kalk- und Magnesiasalze und nament-
lich viel Salpetersäure. Die Salpetersäure
entsteht besonders infolge elektrischer Entla-
dungen in der Atmosphäre. Deshalb findet
sie sich auch in gewitterreichen Gegenden be-
sonders stark im Regen vertreten. In Caracas
in Venezuela ergaben Untersuchungen ein jähr-
liches Quantum von 5,78 Kilogramm Salpe-
tersäure auf 1 Hektar Land. Aus diesem
Grunde muß man in den Tropen den Regen
zugleich als ein Düngemittel ansehen. Da-
gegen ist in höheren Breiten der Gehalt des
Regens an Salpeterfalzen nur gering und
dürfte auf den Pflanzenwuchs kaum einen
Einfluß ausüben. Wohl aber enthält hier der
Regen in Städten und deren Umgebung eine
andere Beimengung, deren Vorhandensein sich
sehr unangenehm bemerkbar macht. Es ist
dies die Schwefelsäure, die zweifellos ans der
massenhaften Verbrennung der Steinkohle in
der häuslichen Wirthschaft und dem Fabrik-
betrieb herrührt. Unter den Verbrennungs-
produkten der Steinkohle tritt auch schwefelige
Säure auf, die vom Regenwasser aufgesaugt
und durch den Sauerstoff der Luft oxydirt
wird, so daß sie sich zu verdünnter Schwefel-
säure umwandelt. Wie beträchtlich ihr Ge-
halt im Regenwasser ist, ergibt sich daraus,
daß in einer Anzahl von Städten auf 100 Liter Re-
genwasser 2 Granini Schwefelsäure kommen. Es ist
keine Frage, daß das kümmerliche Aussehen vieler
städtischen Gartenanlagen, die oft wie verbrannt er-
scheinen, auf die fortwährende Einwirkung dieser Säure
zurückzuführcii ist. Ebenso trägt sie die Schuld an
der schnellen Verwitterung der Marmvrbildwerke und
der der freien Luft ausgesetzten Wandgemälde. Indessen
wirkt der Regen auch nützlich, indem er gleichsam die
Luft wäscht und sie von den organischen Beimengungen
reinigt.
Der in der Luft schwebende Staub enthält be-
kanntlich eine Unmenge von Mikroorganismen. Im
Durchschnitt weist nach einer Untersuchung Miqnel's
ein Loth des Straßenstanbs von Paris nicht weniger
als 130,000 Bakterien auf. Die reinigende Einwirkung
des Regens zeigt nun am besten eine Analyse Aiacagna's.
Der italienische Forscher fand in Palermo, daß in den
Monaten Februar, März, April und Mai, in denen
173 Millimeter Regen fielen, auf 100 Liter Luft o,102
Gramm organische Substanzen kamen. In den
regenlosen Monaten jedoch von Juni bis
August fanden sich 0,160 Gramm solcher Bei-
mengungen vor.
Die Menge des Regens bezeichnet man
durch die Angabe der Höhe, bis zu der er
den Boden bedecken würde, wenn er auf einer
wagerechten Fläche sich ansammelte und weder
einsickerte noch verdunstete. Diese Höhe nennt
man die Regenhöhe eines Qrtes und gibt sie,
wie wir bereits gesehen haben, in Millimetern
an. Zu ihrer Bestimmung dienen die Regen-
messer, deren man sich bei den meteorologi-
schen Beobachtungen bedient. Die Vertheilnng
der Regenmenge auf der Erdoberfläche ist sehr
ungleichmäßig. Da der Feuchtigkeitsgehalt der
Atmosphäre vom Aequator gegen die Pole
abnimmt, so werden die größten Regenmengen
in den äquatorialen Gegenden anzutreffen fein.
Von dort sinkt im Allgemeinen die Regen-
menge nach Norden und Süden. Zu den
regenreichsten Gegenden der Erde gehört der
Kalmengürtel, jenes Gebiet der Windstillen,
das die Passatwinde der beiden Halbkugeln
voneinander trennt. An die Kalmen schließt
sich das ostindische Monsungebict an jenen
Qrten, wo der Südwestmonsun auf ein Ge-
birge stößt. Am Südabhange der Kassia-
berge, nördlich von Kalkutta betrügt die größte
jährliche Regenmenge 1252 Ccntimetcr. Es
regnet dort in einem einzigen Jahre ebenso
viel, als in Suez in vier Jahrhunderten.
Sehr große Regenmengen fallen außerdem an
der Westküste von Ceylon und in Niederlän-
disch-Indien. Die regenreichsten Gebiete Eu-
ropas sind die Westküste von Nordengland,
Schottland und Norwegen und der Südfuß
der Alpen. Im binnenlündischen Europa
find die Regenmengen verhältnißmäßig gering.
Das Buch für Alle.
6eN 22.
ihm für seine Saaten zu viel, bald zu wenig,
im Frühjahr ersehnt er, zur Zeit der Ernte
verabscheut er den Regen.
Der Grund für diese verschiedenen Be-
urtheilungcn liegt in der Unberechenbarkeit
und scheinbaren Willkürlichkeit, mit der sich
der Regen einstellt. Aber diese Regellosigkeit
besteht thatsächlich nicht. Wie Alles in'der
Natur an bestimmte Gesetze gebunden ist, so
entsteht auch der Regen nur unter gewissen
unumgänglich nöthigen Vorbedingungen.
Der Regen verdankt seine Entstehung der
Verdichtung des Wasserdampfes der oberen
Luftschichten. Er tritt ein, wenn feuchte,
warme Luftströme sich abkühlen, indem sie in
höhere, kühlere Regionen aufsteigen oder einein
kalten Nordstrom begegnen. Die Bildung
des Regens können wir unter Umständen in
unserer Stube beobachten. Ist im Winter
die Luft unseres warmen Zimmers durch den
Aufenthalt des Menschen in ihm mit Feuch-
tigkeit gesättigt, während draußen auf der
Straße eine Külte von einigen Graden herrscht,
so beschlagen die Fenster. Diese Trübung
der Scheiben beruht ans demselben Vorgänge,
wie die Entstehung des Regens. Hier wie
da mischen sich nämlich zwei Luftströme von
verschiedener Temperatur. Indem die warme
Luft des Zimmers die Scheibe berührt, die
durch die niedrige Außentemperatur abgekühlt
ist, verdichtet sich der Wasserdampf und schlägt
sich auf dein Glas nieder. Betrachten wir den
Niederschlag etwas genauer, so werden wir
sehen, daß er aus unzähligen, winzigen Tröpf-
chen zusammengesetzt ist. Diese Tröpfchen sind
allerdings zu klein, um die wirklichen Regen-
tropfen darzustellen, allein sie brauchen sich
nur zu vereinigen, indem sie, dem Gesetz der
Schwere folgend, die Fensterscheibe herabrin-
nen, und wir haben dann Wasscrkügclchen von der
wirklichen Durchschnittsgröße eines Regentropfens.
Stellen wir uns nun noch vor, die Scheibe wäre nicht
senkrecht, sondern wagerecht angebracht, so würden die
Tröpfchen nicht herablanfen, sondern sich loslösen und
herabfallen — d. h. es würde regneu.
Für die Häufigkeit und Menge des Regens üben
noch einige andere Faktoren einen bestimmenden Ein-
fluß ans. In erster Linie steht die Nähe des Meeres,
dessen Dunstmassen die Luftströmungen mit sich tragen.
Bei uns in Europa sind es die W.estwinde, die vom
Meere kommen, daher sie auch fast stets Regen bringen.
Regenerzenger sind sodann die Gebirge. Denn da die
Luftströmungen gezwungen werden, an den Abhängen
eines Gebirges emporznsteigen, so muß dadurch eine
rasche Abkühlung derselben und damit eine schnelle
Verdichtung des Wasserdampfes erfolgen. In allen
Klimaten bilden daher die Gebirge inselartige Räume,
die sich durch vermehrten Regenfall auszeichnen, so daß
auch in sonst regenlosen Wnstengegendcn, dort, wo
sich größere Gebirge erheben, reichlicherer Re-
gen niederfällt. Die höheren Plateaux und
Gebirge der mittleren Sahara z. B. haben im
Sommer regelmäßige Regen, und an den Ge-
birgen der nnbischen und arabischen Küste des
Rothen Meeres entladen sich Gewitter mit
schweren Regengüssen, während die Küste selbst
so gut wie regenfrei ist. Eine gleichmäßig
wiederkehrende Erscheinung ist es daher, daß
diejenigen Gebirgszüge, die zu den vorherr-
schenden Winden mehr oder weniger senkrecht
streichen, auf der Seite, wo sie von: Winde
getroffen werden, regenreich, dagegen auf der
anderen, abgewandten Seite regenarm sind.
In Europa ist es allenthalben die Westseite
der Gebirge, welche die meisten Regensälle
zu verzeichnen hat.
Bereits mit der Annäherung 'an ein Ge-
birge nimmt der Niederschlag zu, da die fort-
bewegte Luft schon in größerer Entfernung
durch das Hinderniß des Gebirgrückens zum
Aufsteigen gezwungen wird. So wächst die
Regenmenge des Harzes mit der Annäherung
an ihn und geht wieder zurück', wenn der
Gipfel überstiegen ist. Stellen wir uns vor,
wir gingen von Göttingen aus über Heiligen-
stadt immer langsam bergauf, bis endlich zum
Brocken und dann wieder bergab, so finden
wir auf den einzelnen Stationen eine Steige-
rung der Regcnhöhe, die genau unserem Weg
entspricht. In Göttingen haben wir eine
Regenmenge von 550 Millimeter, die in Hei-
ligenstadt bereits auf 601 gestiegen ist und
in Ballenstedt 055 Millimeter erreicht. Klaus-
thal zeigt 1427 Millimeter und der Brocken
selbst 1700 Millimeter. Run geht unser Weg
wieder bergab. Wernigerode weist nur noch
724 Millimeter auf, und weiterhin in Salz-
wedel ist die Regenmenge wieder auf 585
Ernst Pasqns h. (S. S3S)
Millimeter gesunken. — Der dritte Faktor für die
Menge und Häufigkeit des Regens ist der Wald. Die
Bedeutung des Waldes nach dieser Richtung ist eine
so oft erörterte Thatsache, daß nur einige Punkte ange-
sührt werden mögen. Ebermayer hat gesunden, daß
von der gefallenen Regenmenge ein Viertel durch die
Baumkronen aufgefangen und durch Verdunstung der
Luft wieder zugeführt wird. Allein von den übrig
bleibenden und in den Boden gelangenden drei Vier-
theilen der fallenden Regenmenge verdunstet in der
gleichen Zeit im Walde sechsmal weniger als im
Freien. Ferner besitzen die Bäume die Fähigkeit, den
Dampfgehält der Luft zu verdichten; am stärksten wir-
ken in dieser Hinsicht bei uns die Fichten.
Wie wir wissen, sind die fällenden Regentropfen
nicht alle gleich groß. Die Größe hängt nämlich von
dem Feuchtigkeitsgehalt und der Höhe der Luft ab, in
der sich der Regen bildete. Je feuchter die Luft und
je höher der Bildungsherd liegt, aus dem die Tropfen
herabstürzen, desto größer sind sie. Im Winter, wo
Uarl Friedrich Trikcr p. <2 '30)
die Wolken oft fast die Erde berühren, haben
wir darum so häufig den feinen Sprühregen
während im Sommer beim Gewitterregen
Tropfen von der Größe einer Erbse nichts
Seltenes sind. Die Geschwindigkeit, mit der
ein Lropfen fällt, übersteigt nicht mehr als
etwas über 5 Meter in der Sekunde.
Lange Zeit nahm inan an, daß der Regen
fast ebenso rein sei, als destillirtes Wasser.
Diese Ansicht ist jetzt als irrig erwiesen. Das
Wasser der Regentropfen enthält Ammoniak-
salze, Kalk- und Magnesiasalze und nament-
lich viel Salpetersäure. Die Salpetersäure
entsteht besonders infolge elektrischer Entla-
dungen in der Atmosphäre. Deshalb findet
sie sich auch in gewitterreichen Gegenden be-
sonders stark im Regen vertreten. In Caracas
in Venezuela ergaben Untersuchungen ein jähr-
liches Quantum von 5,78 Kilogramm Salpe-
tersäure auf 1 Hektar Land. Aus diesem
Grunde muß man in den Tropen den Regen
zugleich als ein Düngemittel ansehen. Da-
gegen ist in höheren Breiten der Gehalt des
Regens an Salpeterfalzen nur gering und
dürfte auf den Pflanzenwuchs kaum einen
Einfluß ausüben. Wohl aber enthält hier der
Regen in Städten und deren Umgebung eine
andere Beimengung, deren Vorhandensein sich
sehr unangenehm bemerkbar macht. Es ist
dies die Schwefelsäure, die zweifellos ans der
massenhaften Verbrennung der Steinkohle in
der häuslichen Wirthschaft und dem Fabrik-
betrieb herrührt. Unter den Verbrennungs-
produkten der Steinkohle tritt auch schwefelige
Säure auf, die vom Regenwasser aufgesaugt
und durch den Sauerstoff der Luft oxydirt
wird, so daß sie sich zu verdünnter Schwefel-
säure umwandelt. Wie beträchtlich ihr Ge-
halt im Regenwasser ist, ergibt sich daraus,
daß in einer Anzahl von Städten auf 100 Liter Re-
genwasser 2 Granini Schwefelsäure kommen. Es ist
keine Frage, daß das kümmerliche Aussehen vieler
städtischen Gartenanlagen, die oft wie verbrannt er-
scheinen, auf die fortwährende Einwirkung dieser Säure
zurückzuführcii ist. Ebenso trägt sie die Schuld an
der schnellen Verwitterung der Marmvrbildwerke und
der der freien Luft ausgesetzten Wandgemälde. Indessen
wirkt der Regen auch nützlich, indem er gleichsam die
Luft wäscht und sie von den organischen Beimengungen
reinigt.
Der in der Luft schwebende Staub enthält be-
kanntlich eine Unmenge von Mikroorganismen. Im
Durchschnitt weist nach einer Untersuchung Miqnel's
ein Loth des Straßenstanbs von Paris nicht weniger
als 130,000 Bakterien auf. Die reinigende Einwirkung
des Regens zeigt nun am besten eine Analyse Aiacagna's.
Der italienische Forscher fand in Palermo, daß in den
Monaten Februar, März, April und Mai, in denen
173 Millimeter Regen fielen, auf 100 Liter Luft o,102
Gramm organische Substanzen kamen. In den
regenlosen Monaten jedoch von Juni bis
August fanden sich 0,160 Gramm solcher Bei-
mengungen vor.
Die Menge des Regens bezeichnet man
durch die Angabe der Höhe, bis zu der er
den Boden bedecken würde, wenn er auf einer
wagerechten Fläche sich ansammelte und weder
einsickerte noch verdunstete. Diese Höhe nennt
man die Regenhöhe eines Qrtes und gibt sie,
wie wir bereits gesehen haben, in Millimetern
an. Zu ihrer Bestimmung dienen die Regen-
messer, deren man sich bei den meteorologi-
schen Beobachtungen bedient. Die Vertheilnng
der Regenmenge auf der Erdoberfläche ist sehr
ungleichmäßig. Da der Feuchtigkeitsgehalt der
Atmosphäre vom Aequator gegen die Pole
abnimmt, so werden die größten Regenmengen
in den äquatorialen Gegenden anzutreffen fein.
Von dort sinkt im Allgemeinen die Regen-
menge nach Norden und Süden. Zu den
regenreichsten Gegenden der Erde gehört der
Kalmengürtel, jenes Gebiet der Windstillen,
das die Passatwinde der beiden Halbkugeln
voneinander trennt. An die Kalmen schließt
sich das ostindische Monsungebict an jenen
Qrten, wo der Südwestmonsun auf ein Ge-
birge stößt. Am Südabhange der Kassia-
berge, nördlich von Kalkutta betrügt die größte
jährliche Regenmenge 1252 Ccntimetcr. Es
regnet dort in einem einzigen Jahre ebenso
viel, als in Suez in vier Jahrhunderten.
Sehr große Regenmengen fallen außerdem an
der Westküste von Ceylon und in Niederlän-
disch-Indien. Die regenreichsten Gebiete Eu-
ropas sind die Westküste von Nordengland,
Schottland und Norwegen und der Südfuß
der Alpen. Im binnenlündischen Europa
find die Regenmengen verhältnißmäßig gering.