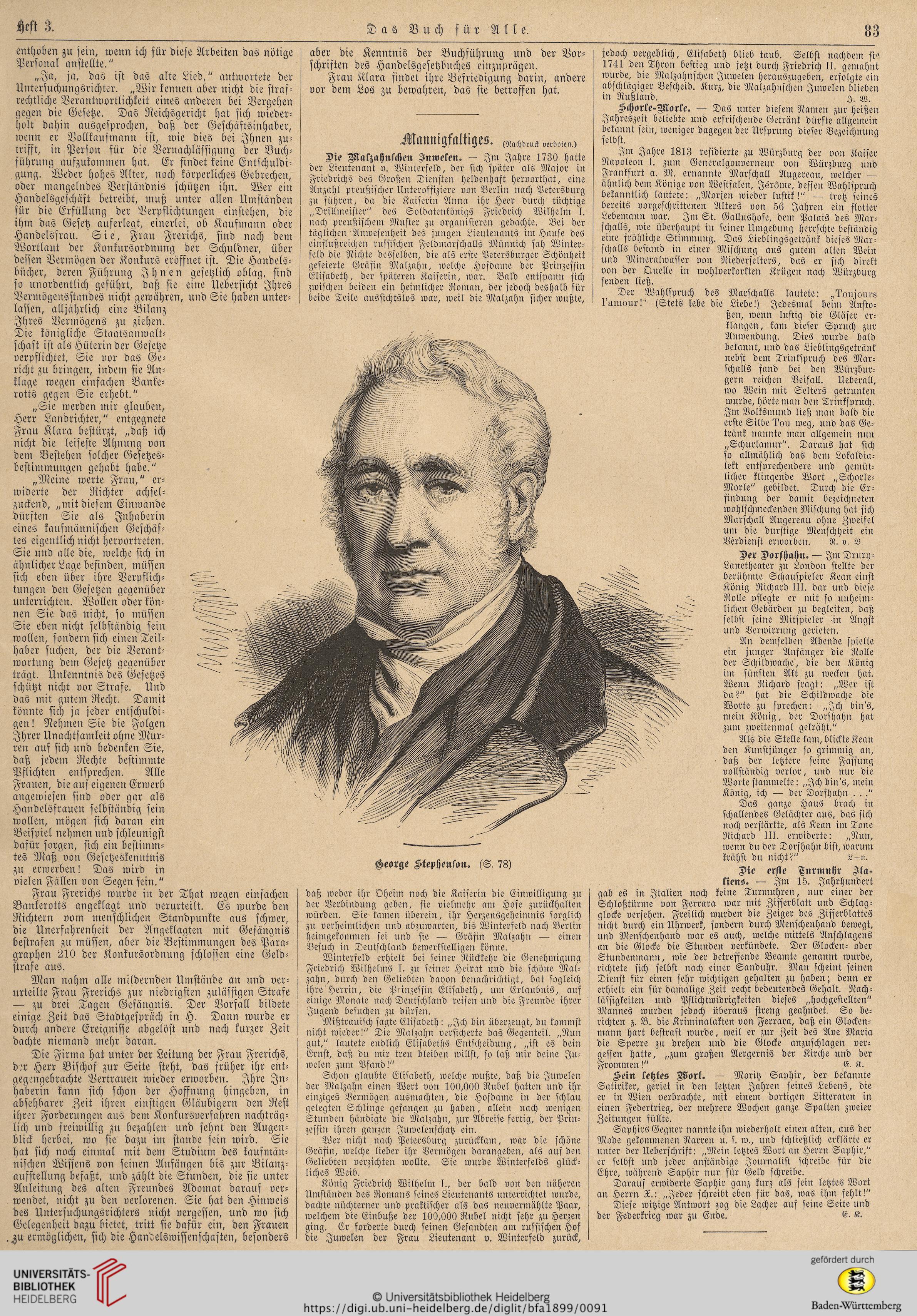Heft 3.
Das UBuugth für Alte.
63
enthoben zu ſein, wenn ich für dieſe Arbeiten das nötige
Personal anſtellte. “
„Ja, ja, das iſt das alte Lied, “ antwortete der
Unterſuchungsrichter. „Wir kennen aber nicht die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit eines anderen bei Vergehen
gegen die Geſeße. Das Reichsgericht hat sich wieder-
holt dahin ausgesprochen, daß der Geſchäftsinhaber,
wenn er Vollkaufmann ist, wie dies bei Ihnen zu-
trifft, in Perſon für die Vernachlässigung der Buch-
führung aufzukommen hat. Er findet keine Entſchuldi-
gung. Weder hohes Alter, noch körperliches Gebrechen,
oder mangelndes Verſtändnis schütten ihn. Wer ein
Handelsgeschäft betreibt, muß unter allen Umständen
für die Erfüllung der Verpflichtungen einstehen, die
ihm das Geſset, auferlegt, einerlei, ob Kaufmann oder
Handelsfrau. Si e, Frau Frerichs, ſind nach dem
Wortlaut der Konkursordnung der Schuldner, über
deſſen Vermögen der Konkurs eröffnet iſt. Die Handels-
bücher, deren Führung Ihnen geſeglich oblag, ſind
so unordentlich geführt, daß sie eine Uebersicht Ihres
DVermögensſtandes nicht gewähren, und Sie haben unter-
laſſen, alljährlich eine Bilanz
Ihres Vermögens zu ziehen.
Die königliche Staatsanwalt-
ſchaft iſt als Hüterin der Gesetze
verpflichtet, Sie vor das Ge-
tt Lua ter U N:
rotts gegen Sie erhebt.“
„Sie werden mir glauben,
Herr Landrichter,“ entgegnete
Frau Klara bestürzt, „daß ich
nicht die leiſeſte Ahnung von
dem Beſtehen ſolcher Gesetzes-
bestimmungen gehabt habe.“
„Meine werte Frau, " er-
widerte der Richter achſel-
zuckend, „mit diesem Einwande
dürften Sie als JInhaberin
eines kaufmännischen Geſchäf-
tes eigentlich nicht hervortreten.
Sie und alle die, welche ſich in
ähnlicher Lage befinden, müſsſen
ſich eben über ihre Verpflich-
tungen den Gesetzen gegenüber
unterrichten. Wollen oder kön-
nen Sie das nicht, ſo müſſen
Sie eben nicht selbſtändig ſein.
wollen, sondern sich einen Teil-
haber ſuchen, der die Verant-
wortung dem Geſetz gegenüber
trägt. Unkenntnis des Gesetzes
ſchützt nicht vor Strafe. Und
das mit gutem Recht. Damit
könnte sich ja jeder entſchuldi-
gen! Nehmen Sie die Folgen
Ihrer Unachtſamkeit ohne Mur-
ren auf ſich und bedenken Sie,
daß jedem Rechte beſtimmte
Pflichten entsprechen. Alle
Frauen, die auf eigenen Erwerb
angewieſen sind oder gar als
Handelsfrauen ſelbſtändig sein
wollen, mögen sich daran ein
Beiſpiel nehmen und ſchleunigſt
dafür sorgen, sich ein beſtimm-
tes Maß von Geſeyeskenntnis
zu erwerben! Das wird in
vielen Fällen von Segen ſein. “
Frau Frerichs wurde in der That wegen einfachen
Bankerotts angeklagt und verurteilt. Es wurde den
Richtern vom menſchlichen Standpunkte aus ſchwer, |
die Unerfahrenheit der Angeklagten mit Gefängnis
bestrafen zu müsſen, aber die Beſtimmungen des Para-
graphen 210 der Konkursordnung ſchloſſen eine Geld-
ſtrafe aus.
Man nahm alle mildernden Umstände an und ver-
urteilte Frau Frerichs zur niedrigsten zulässigen Strafe
~ zu drei Tagen Gefängnis. Der Vorfall bildete
einige Zeit das Stadtgeſpräch in H- Dann wurde er
durch andere Ereigniſſe abgelöſt und nach kurzer Zeit
dachte niemand mehr daran. /
Die Firma hat unter der Leitung der Frau Frerichs,
d.r Herr Biſchof zur Seite ſteht, das früher ihr ent-
gegengebrachte Vertrauen wieder erworben. Ihre In-
haberin kann ſich ſchon der Hoffnung hingeben, in
abſehbarer Zeit ihren einstigen Gläubigern den Reſt
. rau u Lrtatuu nette
blick herbei, uus s dazu im stande sein wird. Sie
hat sich noch einmal mit dem Studium des kaufmän-
niſchen Wiſſens von seinen Anfängen bis zur Bilanz-
aufstellung befaßt, und zählt die Stunden, die sie unter
Anleitung des alten Freundes Adomat darauf ver-
wendet, nicht zu den verlorenen. Sie hat den Hinweis
des Unterſuchungsrichters nicht vergeſſen, und wo ſich
Gelegenheit dazu bietet, tritt ſie dafür ein, den Frauen
. zu ermöglichen, sich die Handelswissenſchaſten, besonders
aber die Kenntnis der Buchführung und der Vor-
ſchriften des Handelsgesetbuches einzuprägen.
Frau Klara findet ihre Befriedigung darin, andere
vor dem Los zu bewahren, das ſie betroffen hat.
Mannigfalktiges. (gawdru verboten.)
Die Malzahnſchen Iuweken. + Im Jahre 1730 hatte
der Lieutenant v. Winterfeld, der ſich ſpäter als Major in
Friedrichs des Großen Diensten heldenhaft hervorthat, eine
Anzahl preußischer Unteroffiziere von Berlin nach Petersburg
zu führen, da die Kaiserin Anna ihr Heer durch tüchtige
„Drillmeiſter“ des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm |I.
nach preußiſchem Muſter zu organiſieren gedachte. Bei der
täglichen Anwesenheit des jungen Lieutenants im Hauſe des
einflußreichen ruſsiſchen Feldmarſchalls Münnich sah Winter-
feld die Nichte desselben, die als erſte Petersburger Schönheit
gefeierte Gräfin Malzahn, welche Hofdame der Prinzessin
Eliſabeth, der ſpäteren Kaiserin, war. Bald entſpann ſich
zwischen beiden ein heimlicher Roman, der jedoch deshalb für
beide Teile aussichtslos war, weil die Malzahn sicher wußte,
George Stephenson. (S. 78) |
daß weder ihr Oheim noch die Kaiserin die Einwilligung zu
der Verbindung geben, sie vielmehr am Hofe zurückhalten
würden. Sie kamen überein, ihr Herzensgeheimnis ſorglich
zu verheimlichen und abzuwarten, bis Winterfeld nach Berlin
heimgekommen sei und sie – Gräfin Malzahn = einen
Beſuch in Deutſchland bewerkstelligen könne.
Winterfeld erhielt bei seiner Rückkehr die Genehmigung
Friedrich Wilhelms I. zu seiner Heirat und die schöne Mal-
zahn, durch den Geliebten davon benachrichtigt, bat sogleich
ihre Herrin, die Prinzeſſin Eliſabeth, um Erlaubnis, auf
einige Monate nach Deutschland reiſen und die Freunde ihrer
Jugend besuchen zu dürfen.
Mißtrauiſch sagte Elisabeth: „Jch bin überzeugt, du kommſt
nicht wieder!“ Die Malzahn versicherte das Gegenteil. „Nun
gut,“ lautete endlich Eliſabeths Entscheidung, ,ist es dein
Ernst, daß du mir treu bleiben willst, ſo laß mir deine Ju-
welen zum Pfand!"
Schon glaubte Elisabeth, welche wußte, daß die Juwelen
der Malzahn einen Wert von 100,000 Rubel hatten und ihr
einziges Vermögen ausmachten, die Hofdame in der ſchlau
gelegten Schlinge gefangen zu haben, allein nach wenigen
Stunden händigte die Malzahn, zur Abreise fertig, der Prin-
zeſſin ihren ganzen Juwelenſschatz ein.
Wer nicht nach Petersburg zurückkam, war die ſchöne
Gräfin, welche lieber ihr Vermögen darangeben, als auf den
Heliebten verzichten wollte. Sie wurde Winterfelds glück-
liches Weib. :
ycs 1 Friedrich Wilhelm I., der bald von den näheren
Umständen des Romans seines Lieutenants unterrichtet wurde,
dachte nüchterner und praktiſcher als das neuvermählte Paar,
welchem die Einbuße der 100,000 Rubel nicht sehr zu Herzen
ging. Er forderte durch seinen Gesandten am ruſssiſchen Hof
die Juwelen der Frau Lieutenant v. Winterfeld zurück,
jedoch vergeblich, Eliſabeth blieb taub. Selbst nachdem ſie
1741 den Thron bestieg und jetzt durch Friedrich Il. gemahnt
wurde, die Malzahnſchen Juwelen herauszugeben, erfolgte ein
1uglsusger Beſcheid. Kurz, die Malzahnſchen Juwelen blieben
in Rußland. I. W.
Hchorle-Morke. ~ Das unter diesem Namen zur heißen
Jahreszeit beliebte und erfriſchende Getränk dürfte allgemein
H>zutt sein, weniger dagegen der Ursprung dieser Bezeichnung
elbſt. ;
Im Jahre 1818 residierte zu Würzburg der von Kaiſeen
Napoleon Il. zum Generalgouverneur von Würzburg und
Frankfurt a. M. ernannte Marschall Augereau, welcher –
ähnlich dem Könige von Westfalen, Jsrôme, desſſen Wahlspruch
bekanntlich lautete: „Morjen wieder luſtik !" — troß seines
bereits vorgeſchrittenen Alters von 56 Jahren ein flotter
Lebemann war. Jm St. Gallushofe, dem Palais des Mar-
ſchalls, wie überhaupt in seiner Umgebung herrſchte beständig
eine fröhliche Stimmung. Das Lieblingsgetränk dieses Mar-
ſchalls bestand in einer Miſchung aus gutem alten Wein
und Mineralwasser von Niederselters, das er ſich direkt
Hu et Quel in wohlverkorkten Krügen nach Würzburg
enden ließ.
Der Wahlspruch des Marschalls lautete: „Toujours
l'amour!“ (Stets lebe die Liebe!) Jedesmal beim Änſto-
ßen, wenn luſtig die Gläser er-
klangen, kam dieser Spruch zur
Anwendung. Dies wurde bald
bekannt, und das Lieblingsgetränk
nebſt dem Trinkspruch des Mar-
ſchalls fand bei den Würzbur-
gern reichen Beifall. Ueberall,
wo Wein mit Selters getrunken
wurde, hörte man den Trinkspruch.
Im Volksmund ließ man bald die
erſte Silbe Tou weg, und das Ge-
tränk nannte man allgemein nun
„Schurlamur". Daraus hat ſich
so allmählich das dem Lokaldien.
lekt entſprechendere und gemüt-
licher klingende Wort ,Schorle-
Morle" gebildet. Durch die Er-
findung der damit bezeichneten
wohlschmeckenden Miſchung hat ſich
Marschall Augereau ohne Zweifel
um die dursſtige Menſchheit ein
Vérdienst erworben. KR. v. B.
Der Dorſhahn. – Im Drury-
Lanetheater zu London stellte der
berühmte Schauſpieler Kean einst
König Richard l]I. dar und dieſe
Rolle pflegte er mit so unheim-
lichen Gebärden zu begleiten, daß
selbſt seine Mitspieler in Angst
und Verwirrung gerieten.
An demselben Abende ſpielte
ein junger Anfänger die Rolle
der Schildwache, die den König
im fünften Akt zu wecken hat.
Wenn Richard fragt: ,Wer iſt
da ?" hat die Schildwache die
Worte zu ſprechen: „Ich bin's,
mein König, der Dorfhahn hat
zum zweitenmal gekräht."
Als die Stelle kam, blickte Kean
den Kunstjünger so grimmig an,
. daß der lettere ſeine Faſsung
vollständig verlor, und nur die
Worte sſtammelte: „Ich bin's, mein
König, ich ~+ der Dorfhahn . ..
Das ganze Haus brach in
schallendes Gelächter aus, das ſich
noch verstärkte, als Kean im Tone
Richard |]. erwiderte: „Nun,
wenn du der Dorfhahn biſt, warum
krähſt du nicht ?“ _ Lan.
Die erſte
; ; ſienss. – Im 15. Jahrhundert
gab es in Italien noch keine Turmuhren, nur einer der
Schloßtürme von Ferrara war mit Zifferblatt und Schlag-
glocke versehen. Freilich wurden die Zeiger des Zifferblattes
nicht durch ein Uhrwerk, sondern durch Menſchenhand bewegt,
und Menschenhand war es auch, welche mittels Anschlagens
an die Glocke die Stunden verkündete. Der Glocken- oder
Stundenmann, wie der betreffende Beamte genannt wurde,
richtete sich selbſt nach einer Sanduhr. Man ſcheint seinen
Dienst für einen sehr wichtigen gehalten zu haben; denn er
erhielt ein für damalige Zeit recht bedeutendes Gehalt. Nach-
läſſigkeiten und Pflichtwidrigkeiten dieses ,hochgestellten“
Mannes wurden jedoch überaus streng geahndet. So be-
Turmuhr
richten z. B. die Kriminalakten von Ferrara, daß ein Glocken-
mann hart bestraft wurde, weil er zur Zeit des Ave Maria
die Sperre zu drehen und die Glocke anzuſchlagen ver-
geſſen hatte, „zum großen Aergernis der Kirche und der
Frommen !“ E. K.
Hein letztes Work. ~ Morit Saphir, der bekannte
Satiriker, geriet in den letzten Jahren seines Lebens, die
er in Wien verbrachte, mit einem dortigen Litteraten in
einen Federkrieg, der mehrere Wochen ganze Spalten zweier
Zeitungen füllte.
Saphirs Gegner nannte ihn wiederholt einen alten, aus der
Mode gekommenen Narren u. s. w., und ſchließlich erklärte er
unter der Ueberschrift: „Mein lettes Wort an Herrn Saphir,“
er selbſt und jeder anständige Journalist schreibe für die
Ehre, während Saphir nur für Geld ſchreibe.
Darauf erwiderte Saphir ganz kurz als sein letztes Wort
an Herrn X.: „Jeder ſchreibt eben für das, was ihm fehlt!“
Diese witzige Antwort zog die Lacher auf seine Seite und
der Federkrieg war zu Ende. E. K.
Ika.
Das UBuugth für Alte.
63
enthoben zu ſein, wenn ich für dieſe Arbeiten das nötige
Personal anſtellte. “
„Ja, ja, das iſt das alte Lied, “ antwortete der
Unterſuchungsrichter. „Wir kennen aber nicht die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit eines anderen bei Vergehen
gegen die Geſeße. Das Reichsgericht hat sich wieder-
holt dahin ausgesprochen, daß der Geſchäftsinhaber,
wenn er Vollkaufmann ist, wie dies bei Ihnen zu-
trifft, in Perſon für die Vernachlässigung der Buch-
führung aufzukommen hat. Er findet keine Entſchuldi-
gung. Weder hohes Alter, noch körperliches Gebrechen,
oder mangelndes Verſtändnis schütten ihn. Wer ein
Handelsgeschäft betreibt, muß unter allen Umständen
für die Erfüllung der Verpflichtungen einstehen, die
ihm das Geſset, auferlegt, einerlei, ob Kaufmann oder
Handelsfrau. Si e, Frau Frerichs, ſind nach dem
Wortlaut der Konkursordnung der Schuldner, über
deſſen Vermögen der Konkurs eröffnet iſt. Die Handels-
bücher, deren Führung Ihnen geſeglich oblag, ſind
so unordentlich geführt, daß sie eine Uebersicht Ihres
DVermögensſtandes nicht gewähren, und Sie haben unter-
laſſen, alljährlich eine Bilanz
Ihres Vermögens zu ziehen.
Die königliche Staatsanwalt-
ſchaft iſt als Hüterin der Gesetze
verpflichtet, Sie vor das Ge-
tt Lua ter U N:
rotts gegen Sie erhebt.“
„Sie werden mir glauben,
Herr Landrichter,“ entgegnete
Frau Klara bestürzt, „daß ich
nicht die leiſeſte Ahnung von
dem Beſtehen ſolcher Gesetzes-
bestimmungen gehabt habe.“
„Meine werte Frau, " er-
widerte der Richter achſel-
zuckend, „mit diesem Einwande
dürften Sie als JInhaberin
eines kaufmännischen Geſchäf-
tes eigentlich nicht hervortreten.
Sie und alle die, welche ſich in
ähnlicher Lage befinden, müſsſen
ſich eben über ihre Verpflich-
tungen den Gesetzen gegenüber
unterrichten. Wollen oder kön-
nen Sie das nicht, ſo müſſen
Sie eben nicht selbſtändig ſein.
wollen, sondern sich einen Teil-
haber ſuchen, der die Verant-
wortung dem Geſetz gegenüber
trägt. Unkenntnis des Gesetzes
ſchützt nicht vor Strafe. Und
das mit gutem Recht. Damit
könnte sich ja jeder entſchuldi-
gen! Nehmen Sie die Folgen
Ihrer Unachtſamkeit ohne Mur-
ren auf ſich und bedenken Sie,
daß jedem Rechte beſtimmte
Pflichten entsprechen. Alle
Frauen, die auf eigenen Erwerb
angewieſen sind oder gar als
Handelsfrauen ſelbſtändig sein
wollen, mögen sich daran ein
Beiſpiel nehmen und ſchleunigſt
dafür sorgen, sich ein beſtimm-
tes Maß von Geſeyeskenntnis
zu erwerben! Das wird in
vielen Fällen von Segen ſein. “
Frau Frerichs wurde in der That wegen einfachen
Bankerotts angeklagt und verurteilt. Es wurde den
Richtern vom menſchlichen Standpunkte aus ſchwer, |
die Unerfahrenheit der Angeklagten mit Gefängnis
bestrafen zu müsſen, aber die Beſtimmungen des Para-
graphen 210 der Konkursordnung ſchloſſen eine Geld-
ſtrafe aus.
Man nahm alle mildernden Umstände an und ver-
urteilte Frau Frerichs zur niedrigsten zulässigen Strafe
~ zu drei Tagen Gefängnis. Der Vorfall bildete
einige Zeit das Stadtgeſpräch in H- Dann wurde er
durch andere Ereigniſſe abgelöſt und nach kurzer Zeit
dachte niemand mehr daran. /
Die Firma hat unter der Leitung der Frau Frerichs,
d.r Herr Biſchof zur Seite ſteht, das früher ihr ent-
gegengebrachte Vertrauen wieder erworben. Ihre In-
haberin kann ſich ſchon der Hoffnung hingeben, in
abſehbarer Zeit ihren einstigen Gläubigern den Reſt
. rau u Lrtatuu nette
blick herbei, uus s dazu im stande sein wird. Sie
hat sich noch einmal mit dem Studium des kaufmän-
niſchen Wiſſens von seinen Anfängen bis zur Bilanz-
aufstellung befaßt, und zählt die Stunden, die sie unter
Anleitung des alten Freundes Adomat darauf ver-
wendet, nicht zu den verlorenen. Sie hat den Hinweis
des Unterſuchungsrichters nicht vergeſſen, und wo ſich
Gelegenheit dazu bietet, tritt ſie dafür ein, den Frauen
. zu ermöglichen, sich die Handelswissenſchaſten, besonders
aber die Kenntnis der Buchführung und der Vor-
ſchriften des Handelsgesetbuches einzuprägen.
Frau Klara findet ihre Befriedigung darin, andere
vor dem Los zu bewahren, das ſie betroffen hat.
Mannigfalktiges. (gawdru verboten.)
Die Malzahnſchen Iuweken. + Im Jahre 1730 hatte
der Lieutenant v. Winterfeld, der ſich ſpäter als Major in
Friedrichs des Großen Diensten heldenhaft hervorthat, eine
Anzahl preußischer Unteroffiziere von Berlin nach Petersburg
zu führen, da die Kaiserin Anna ihr Heer durch tüchtige
„Drillmeiſter“ des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm |I.
nach preußiſchem Muſter zu organiſieren gedachte. Bei der
täglichen Anwesenheit des jungen Lieutenants im Hauſe des
einflußreichen ruſsiſchen Feldmarſchalls Münnich sah Winter-
feld die Nichte desselben, die als erſte Petersburger Schönheit
gefeierte Gräfin Malzahn, welche Hofdame der Prinzessin
Eliſabeth, der ſpäteren Kaiserin, war. Bald entſpann ſich
zwischen beiden ein heimlicher Roman, der jedoch deshalb für
beide Teile aussichtslos war, weil die Malzahn sicher wußte,
George Stephenson. (S. 78) |
daß weder ihr Oheim noch die Kaiserin die Einwilligung zu
der Verbindung geben, sie vielmehr am Hofe zurückhalten
würden. Sie kamen überein, ihr Herzensgeheimnis ſorglich
zu verheimlichen und abzuwarten, bis Winterfeld nach Berlin
heimgekommen sei und sie – Gräfin Malzahn = einen
Beſuch in Deutſchland bewerkstelligen könne.
Winterfeld erhielt bei seiner Rückkehr die Genehmigung
Friedrich Wilhelms I. zu seiner Heirat und die schöne Mal-
zahn, durch den Geliebten davon benachrichtigt, bat sogleich
ihre Herrin, die Prinzeſſin Eliſabeth, um Erlaubnis, auf
einige Monate nach Deutschland reiſen und die Freunde ihrer
Jugend besuchen zu dürfen.
Mißtrauiſch sagte Elisabeth: „Jch bin überzeugt, du kommſt
nicht wieder!“ Die Malzahn versicherte das Gegenteil. „Nun
gut,“ lautete endlich Eliſabeths Entscheidung, ,ist es dein
Ernst, daß du mir treu bleiben willst, ſo laß mir deine Ju-
welen zum Pfand!"
Schon glaubte Elisabeth, welche wußte, daß die Juwelen
der Malzahn einen Wert von 100,000 Rubel hatten und ihr
einziges Vermögen ausmachten, die Hofdame in der ſchlau
gelegten Schlinge gefangen zu haben, allein nach wenigen
Stunden händigte die Malzahn, zur Abreise fertig, der Prin-
zeſſin ihren ganzen Juwelenſschatz ein.
Wer nicht nach Petersburg zurückkam, war die ſchöne
Gräfin, welche lieber ihr Vermögen darangeben, als auf den
Heliebten verzichten wollte. Sie wurde Winterfelds glück-
liches Weib. :
ycs 1 Friedrich Wilhelm I., der bald von den näheren
Umständen des Romans seines Lieutenants unterrichtet wurde,
dachte nüchterner und praktiſcher als das neuvermählte Paar,
welchem die Einbuße der 100,000 Rubel nicht sehr zu Herzen
ging. Er forderte durch seinen Gesandten am ruſssiſchen Hof
die Juwelen der Frau Lieutenant v. Winterfeld zurück,
jedoch vergeblich, Eliſabeth blieb taub. Selbst nachdem ſie
1741 den Thron bestieg und jetzt durch Friedrich Il. gemahnt
wurde, die Malzahnſchen Juwelen herauszugeben, erfolgte ein
1uglsusger Beſcheid. Kurz, die Malzahnſchen Juwelen blieben
in Rußland. I. W.
Hchorle-Morke. ~ Das unter diesem Namen zur heißen
Jahreszeit beliebte und erfriſchende Getränk dürfte allgemein
H>zutt sein, weniger dagegen der Ursprung dieser Bezeichnung
elbſt. ;
Im Jahre 1818 residierte zu Würzburg der von Kaiſeen
Napoleon Il. zum Generalgouverneur von Würzburg und
Frankfurt a. M. ernannte Marschall Augereau, welcher –
ähnlich dem Könige von Westfalen, Jsrôme, desſſen Wahlspruch
bekanntlich lautete: „Morjen wieder luſtik !" — troß seines
bereits vorgeſchrittenen Alters von 56 Jahren ein flotter
Lebemann war. Jm St. Gallushofe, dem Palais des Mar-
ſchalls, wie überhaupt in seiner Umgebung herrſchte beständig
eine fröhliche Stimmung. Das Lieblingsgetränk dieses Mar-
ſchalls bestand in einer Miſchung aus gutem alten Wein
und Mineralwasser von Niederselters, das er ſich direkt
Hu et Quel in wohlverkorkten Krügen nach Würzburg
enden ließ.
Der Wahlspruch des Marschalls lautete: „Toujours
l'amour!“ (Stets lebe die Liebe!) Jedesmal beim Änſto-
ßen, wenn luſtig die Gläser er-
klangen, kam dieser Spruch zur
Anwendung. Dies wurde bald
bekannt, und das Lieblingsgetränk
nebſt dem Trinkspruch des Mar-
ſchalls fand bei den Würzbur-
gern reichen Beifall. Ueberall,
wo Wein mit Selters getrunken
wurde, hörte man den Trinkspruch.
Im Volksmund ließ man bald die
erſte Silbe Tou weg, und das Ge-
tränk nannte man allgemein nun
„Schurlamur". Daraus hat ſich
so allmählich das dem Lokaldien.
lekt entſprechendere und gemüt-
licher klingende Wort ,Schorle-
Morle" gebildet. Durch die Er-
findung der damit bezeichneten
wohlschmeckenden Miſchung hat ſich
Marschall Augereau ohne Zweifel
um die dursſtige Menſchheit ein
Vérdienst erworben. KR. v. B.
Der Dorſhahn. – Im Drury-
Lanetheater zu London stellte der
berühmte Schauſpieler Kean einst
König Richard l]I. dar und dieſe
Rolle pflegte er mit so unheim-
lichen Gebärden zu begleiten, daß
selbſt seine Mitspieler in Angst
und Verwirrung gerieten.
An demselben Abende ſpielte
ein junger Anfänger die Rolle
der Schildwache, die den König
im fünften Akt zu wecken hat.
Wenn Richard fragt: ,Wer iſt
da ?" hat die Schildwache die
Worte zu ſprechen: „Ich bin's,
mein König, der Dorfhahn hat
zum zweitenmal gekräht."
Als die Stelle kam, blickte Kean
den Kunstjünger so grimmig an,
. daß der lettere ſeine Faſsung
vollständig verlor, und nur die
Worte sſtammelte: „Ich bin's, mein
König, ich ~+ der Dorfhahn . ..
Das ganze Haus brach in
schallendes Gelächter aus, das ſich
noch verstärkte, als Kean im Tone
Richard |]. erwiderte: „Nun,
wenn du der Dorfhahn biſt, warum
krähſt du nicht ?“ _ Lan.
Die erſte
; ; ſienss. – Im 15. Jahrhundert
gab es in Italien noch keine Turmuhren, nur einer der
Schloßtürme von Ferrara war mit Zifferblatt und Schlag-
glocke versehen. Freilich wurden die Zeiger des Zifferblattes
nicht durch ein Uhrwerk, sondern durch Menſchenhand bewegt,
und Menschenhand war es auch, welche mittels Anschlagens
an die Glocke die Stunden verkündete. Der Glocken- oder
Stundenmann, wie der betreffende Beamte genannt wurde,
richtete sich selbſt nach einer Sanduhr. Man ſcheint seinen
Dienst für einen sehr wichtigen gehalten zu haben; denn er
erhielt ein für damalige Zeit recht bedeutendes Gehalt. Nach-
läſſigkeiten und Pflichtwidrigkeiten dieses ,hochgestellten“
Mannes wurden jedoch überaus streng geahndet. So be-
Turmuhr
richten z. B. die Kriminalakten von Ferrara, daß ein Glocken-
mann hart bestraft wurde, weil er zur Zeit des Ave Maria
die Sperre zu drehen und die Glocke anzuſchlagen ver-
geſſen hatte, „zum großen Aergernis der Kirche und der
Frommen !“ E. K.
Hein letztes Work. ~ Morit Saphir, der bekannte
Satiriker, geriet in den letzten Jahren seines Lebens, die
er in Wien verbrachte, mit einem dortigen Litteraten in
einen Federkrieg, der mehrere Wochen ganze Spalten zweier
Zeitungen füllte.
Saphirs Gegner nannte ihn wiederholt einen alten, aus der
Mode gekommenen Narren u. s. w., und ſchließlich erklärte er
unter der Ueberschrift: „Mein lettes Wort an Herrn Saphir,“
er selbſt und jeder anständige Journalist schreibe für die
Ehre, während Saphir nur für Geld ſchreibe.
Darauf erwiderte Saphir ganz kurz als sein letztes Wort
an Herrn X.: „Jeder ſchreibt eben für das, was ihm fehlt!“
Diese witzige Antwort zog die Lacher auf seine Seite und
der Federkrieg war zu Ende. E. K.
Ika.