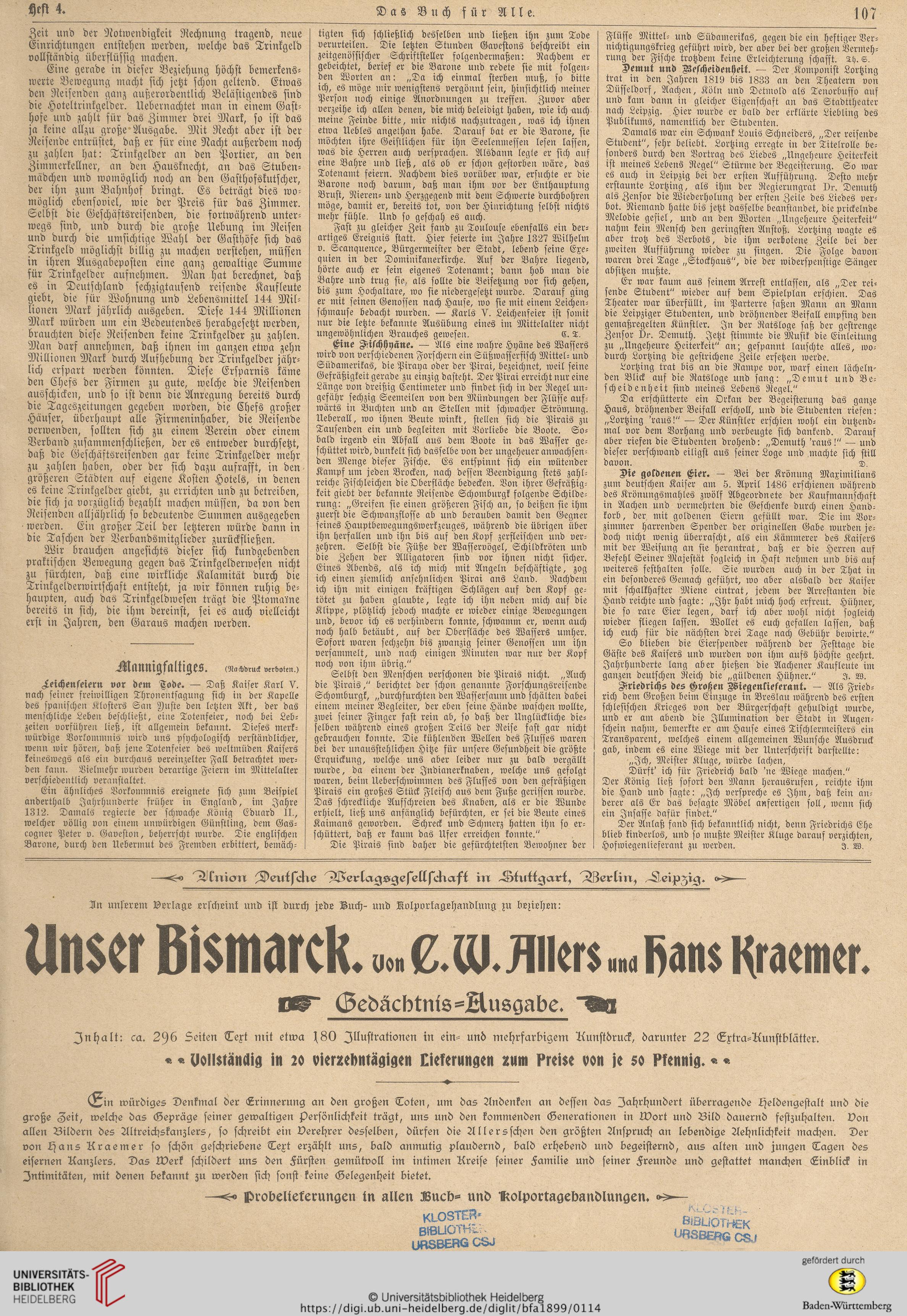Heft 4.
Da s Bu ch für Alle.
107
Zeit und der Notwendigkeit Rechnung tragend, neue
Einrichtungen entstehen werden, welche das Trinkgeld
vollständig überflüſſig machen.
Eine gerade in dieſer Beziehung höchſt bemerkens-
werte Bewegung macht sich jeßt ſchon geltend. Etwas
den Reisenden ganz außerordentlich Beläſtigendes ſind
die Hoteltrinkgelder. Uebernachtet man in einem Galt-
hofe und zahlt für das Zimmer drei Mark, so ist das
ja keine allzu große’ Ausgabe. Mit Recht aber iſt der
Reiſende entrüſtet, daß er für eine Nacht außerdem noch
gzu zahlen hat: Trinkgelder an den Portier, an den
Zimmerkellner, an den Hausknecht, an das Stuben-
mädchen und womöglich noch an den Gaſthofskutſcher,
der ihn zum Bahnhof bringt. Es beträgt dies wo-
t GU z dt ts es hire:
wegs ſind, und durch die große Uebung im Reiſen
und durch die umsichtige Wahl der Gasthöfe ſich das
Trinkgeld möglichst billig zu machen verſtehen, müſſen
in ihren Ausgabepoſten eine ganz gewaltige Summe
für Trinkgelder aufnehmen. Man hat berechnet, daß
es in Deutſchland sechzigtauſend reiſende Kaufleute
giebt, die für Wohnung und Lebensmittel 144 Mil-
lionen Mark jährlich ausgeben. Diese 144 Millionen
Mark würden um ein Bedeutendes herabgeſetzt werden,
brauchten diese Reiſenden keine Trinkgelder zu zahlen.
Man darf annehmen, daß ihnen im ganzen etwa zehn
Millionen Mark durch Aufhebung der Trinkgelder jähr-
lich erſpart werden könnten. Diese Ersparnis käme
den Chefs der Firmen zu gute, welche die Reiſenden
ausſchicken, und ſo iſt denn die Anregung bereits durch
die Tageszeitungen gegeben worden, die Chefs großer
Häuſer, überhaupt alle Firmeninhaber, die Reisende
verwenden, ſollten sich zu einem Verein oder einem
Verband zuſammenſchließen, der es entweder durchsetzt,
daß die Geſchäftsreiſenden gar keine Trinkgelder mehr
zu zahlen haben, oder der sich dazu aufrafft, in den.
größeren Städten auf eigene Kosten Hotels, in denen
es keine Trinkgelder giebt, zu errichten und zu betreiben,
die sich ja vorzüglich bezahlt machen müsſſen, da von den
Reiſenden alljährlich ſo bedeutende Summen ausgegeben
Ö werden. Ein großer Teil der letzteren würde dann in
die Taſchen der Verbandsmitglieder zurückfließen.
Wir brauchen angesichts dieſer ſich kundgebenden
praktiſchen Bewegung gegen das Trinkgelderweſen nicht
zu fürchten, daß eine wirkliche Kalamität durch die
Trinkgelderwirtſchaft entſteht, ja wir können ruhig be-
haupten, auch das Trinkgeldwesen trägt die Ptomatine
bereits in ſich, die ihm dereinst, sei es auch vielleicht
erſt in Jahren, den Garaus machen werden.
Mannigfaltiges. c%acdrus verboten.)
ZLeichenfeiern vor dem Tode. — Daß Kaiser Karl V.
nach seiner freiwilligen Thronentsagung sich in der Kapelle
des ſpaniſchen Kloſters San Yuſte den leßten Akt, der das
M Ut co; tic "Vith t:
_ würdige Vorkommnis wird uns pſ9ychologiſch verſtändlicher,
wenn wir hören, daß jene Totenfeier des weltmüden Kaisers
keineswegs als ein durchaus vereinzelter Fall betrachtet wer-
den kann. Vielmehr wurden derartige Feiern im Mittelalter
verſchiedentlich veranstaltet. ;
Ein ähnliches Vorkommnis ereignete ſich zum Beiſpiel
anderthalb Jahrhunderte früher in England, im Jahre
1312. Damals regierte der ſchwache König Eduard II.,
welcher völlig von einem unwürdigen Günſtling, dem Gas-
cogner Peter v. Gaveſton, beherrſcht wurde. Die engliſchen
Barone, durch den Uebermut des Fremden erbittert, bemäch-
etwa Uebles angethan habe.
tigten ſich ſchließlich desselben und ließen ihn zum Tode
verurteilen. Die letzten Stunden Gaveſstons beschreibt ein
zeitgenössiſcher Schriftsteller folgendermaßen: Nachdem er
gebeichtet, berief er die Barone und redete sie mit folgen-
den Worten an: „Da ich einmal sterben muß, so bitte
ich, es möge mir wenigstens vergönnt ſein, hinsichtlich meiner
Person noch einige Anordnungen zu treffen. Zuvor aber
verzeihe ich allen denen, die mich beleidigt haben, wie ich auch
meine Feinde bitte, mir nichts nachzutragen, was ich ihnen
möchten ihre Geistlichen für ihn Seelenmessen leſen lassen,
was die Herren auch verſprachen. Alsdann legte er ſich auf
eine Bahre und ließ, als ob er ſchon geſtorben wäre, das
Totenamt feiern. Nachdem dies vorüber war, erſuchte er die
Barone noch darum, daß man ihm vor der Enthauptung
Bruſt, Nieren- und Herzgegend mit dem Schwerte durchbohren
möge, damit er, bereits tot, von der Hinrichtung selbst nichts
mehr fühle. Und so geschah es auch.
Faſt zu gleicher Zeit fand zu Toulouſe ebenfalls ein der-
artiges Greignis statt. Hier feierte im Jahre 1327 Wilhelm
v. Scanquence, Bürgermeister der Stadt, lebend seine Exe-
quien in der Dominikanerkirche. Auf der Bahre liegend,
hörte auch er sein eigenes Totenamt; dann hob man die
Bahre und trug sie. als sollte die Beiſezung vor sich gehen,
bis zum Hochaltare, wo sie niedergeſeßzt wurde. Darauf ging
er mit seinen Genossen nach Hauſe, wo sie mit einem Leichen-
ſchmauſe bedacht wurden. ~ Karls V. Leichenfeier ist somit
nur die letzte bekannte Ausübung eines im Mittelalter nicht
ungewöhnlichen Brauches gewesen. . C. T.
Eine JFiſchhyäne. + Als eine wahre Hyäne des Wassers
wird von verschiedenen Forſchern ein Süßwaſserfisch Mittel- und
Südamerikas, die Piraya oder der Pirai, bezeichnet, weil seine
Gefräßigkeit gerade zu einzig dasteht. Der Pirai erreicht nur eine
Länge von dreißig Centimeter und findet sich in der Regel un-
gefähr sechzig Seemeilen von den Mündungen der Flüsse auf-
wärts in Buchten und an Stellen mit schwacher Strömung.
Ueberall, wo ihnen Beute winkt, stellen sich die Pirais zu
Tauſenden ein und begleiten mit Vorliebe die Boote. So-
bald irgend ein Abfall aus dem Boote in das Waſser ge-
ſchüttet wird, dunkelt ſich dasselbe von der ungeheuer anwachsen-
den Menge dieser Fiſche. Es entſpinnt sich ein wütender
Kampf um jeden Brocken, nach dessen Beendigung stets zahl-
reiche Fiſchleichen die Oberfläche bedecken. Von ihrer Gefräßig-
keit giebt der bekannte Reiſende Schomburgk folgende Schilde-
rung: „Greifen sie einen größeren Fiſch an, so beißen ſie ihm
zuerst die Schwanzfloſſe ab und berauben damit den Gegner
seines Hauptbewegungswerkzeuges, während die übrigen über
ihn herfallen und ihn bis auf den Kopf zerfleiſchen und ver-
zehren. Selbst die Füße der Wasservögel, Schildkröten und
die Zehen der Alligatoren sind vor ihnen nicht ſicher.
Eines Abends, als ich mich mit Angeln beschäftigte, zog
ich einen ziemlich ansehnlichen Pirai ans Land. Nachdem
ich ihn mit einigen kräftigen Schlägen auf den Kopf ge-
tötet zu haben glaubte, legte ich ihn neben mich auf die
Klippe, plötzlich jedoch machte er wieder einige Bewegungen
und, bevor ich es verhindern konnte, ſchwamm er, wenn auch
noch halb betäubt, auf der Oberfläche des Wassers umher.
Sofort waren ſechzehn bis zwanzig seiner Genoſſen um ihn
verſammelt, und nach einigen Minuten war nur der Kopf
noch von ihm übrig.“
Selbst den Menſchen verſchonen die Pirais nicht. , Auch
die Pirais ,“ berichtet der ſchon genannte Forschungsreisende
Schomburgk, ,„durchfurchten den Wasserſaum und ſchälten dabei
einem meiner Begleiter, der eben seine Hände waſchen wollte,
zwei seiner Finger faſt rein ab, ſo daß der Unglückliche die-
ſelben während eines großen Teils der Reise fast gar nicht
gebrauchen konnte. Die kühlenden Wellen des Fluſſes waren
bei der unaussſtehlichen Hitze für unsere Gesundheit die größte
Erquickung, welche uns aber leider nur zu bald vergällt
wurde, da einem der Indianerknaben, welche uns gefolgt
waren, beim Ueberſchwimmen des Fluſſes von den gefräßigen
Pirais ein großes Stück Fleiſch aus dem Fuße gerissen wurde.
Das ſchreckliche Aufschreien des Knaben, als er die Wunde
erhielt, ließ uns anfänglich befürchten, er sei die Beute eines
B S S BEE Ss ui
Die Pirais sind daher die gefürchtetſten Bewohner der
Darauf bat er die Barone, sie |
Flüſſe Mittel- und Südamerikas, gegen die ein heftiger Ver-
nichtigungskrieg geführt wird, der aber bei der großen Vermeh-
rung der Fiſche troßdem keine Erleichterung ſchafft. Th. S.
Demut und Weſcheidenheit. + Der Komponiſt Lortzing
trat in den Jahren 1819 bis 1833 an den Theatern von
Düsseldorf , Aachen, Köln und Detmold als Tenorbuffo auf
und kam dann in gleicher Cigenſschaft an das Stadttheater
nach Leipzig. Hier wurde er bald der erklärte Liebling des
Publikums, namentlich der Studenten.
Damals war ein Schwank Louis Schneiders, „Der reiſende
Student“, sehr beliebt. Lorting erregte in der Titelrolle be-
ſonders durch den Vortrag des Liedes „Ungeheure Heiterkeit
iſt meines Lebens Regel“ Stürme der Begeisterung. So war
es auch in Leipzig bei der ersten Aufführung. Deſto mehr
erſtaunte Lorzing, als ihm der Regierungrat Dr. Demuth
als Zensor die Wiederholung der ersten Zeile des Liedes ver-
bot. Niemand hatte bis jettt dasselbe beanstandet, die prickelnde
Melodie geſsiel, und an den Worten „Ungeheure Heiterkeit“
nahm kein Menſch den geringsten Anstoß. Lorting wagte es
aber troß des Verbots, die ihm verbotene Zeile bei der
zweiten Aufführung wieder zu ſingen. Die Folge davon
waren drei Tage „Stockhaus"“, die der widerspenstige Sänger
absitzen mußte.
Er war kaum aus seinem Arrest entlassen, als „„Der rei-
ſende Student“ wieder auf dem Spielplan erschien. Das
Theater war überfüllt, im Parterre ſaßen Mann an Mann
die Leipziger Studenten, und dröhnender Beifall empfing den
gemaßregelten Künstler. In der Ratsloge saß der gestrenge
Zensor Dr. Demuth. Jett stimmte die Musik die Einleitung
zu „Ungeheure Heiterkeit“ an; gespannt lauſchte alles, wo
durch Lortzing die gestrichene Zeile erseßen werde.
Lorting trat bis an die Rampe vor, warf einen lächeln-
den Blick auf die Ratsloge und sang: „Demut und Be-
ſcheid enheit ſind meines Lebens Regel.“
Da erschütterte ein Orkan der Begeiſterung das ganze
Haus, dröhnender Beifall erſcholl, und die Studenten riefen :
„Lorting 'raus !“ ~ Der Künstler erſchien wohl ein dutend-
mal vor dem Vorhang und verbeugte ſich dankend. Darauf
aber riefen die Studenten drohend: „Demuth 'raus !“ + und
dicfer verſchwand eiligſt aus seiner Loge und machte sich still
avon. : D.
Die goldenen Eier. + Bei der Krönung Maximilians
zum deutſchen Kaiſer am 5. April 1486 erschienen während
des Krönungsmahles zwölf Abgeordnete der Kaufmannſchaft
in Aachen und vermehrten die Geschenke durch einen Hanno
korb, der mit goldenen Eiern gefüllt war. Die im Vor-
zimmer harrenden Spender der originellen Gabe wurden je-
doch nicht wenig überrascht, als ein Kämmerer des Kaisers
mit der Weiſung an sie herantrat, daß er die Herren auf
Befehl Seiner Majestät sogleich in Haft nehmen und bis auf
weiteres festhalten solle. Sie wurden auch in der That in
ein besonderes Gemach geführt, wo aber alsbald der Raiſer
mit ſchalkhafter Miene eintrat, jedem der Arrestanten die
Hand reichte und sagte: „Jhr habt mich hoch erfreut. Hühner,
die so rare Eier legen, darf ich aber wohl nicht ſogleich
wieder fliegen laſſen. Wollet es euch gefallen laſſene, deß
ich euch für die nächſten drei Tage nach Gebühr bewirte."
So blieben die Eierſpender während der Festtage die
Gäste des Kaiſers und wurden von ihm aufs höchſte geehrt.
Jahrhunderte lang aber hießen die Aachener Kaufleute im
ganzen deutschen Reich die „güldenen Hühner.“ J. W.
Friedrichs des Großen Wiegenlkieferant. + Als Fried-
rich dem Großen beim Cinzuge in Breslau während des ersſten
ſchlesiſchen Krieges von der Bürgerſchaft gehuldigt wurde,
und er am abend die Illumination der Stadt in Augen-
ſchein nahm, bemerkte er am Hauſe eines Tiſchlermeiſters ein
Transparent, welches einem allgemeinen Wunſche Ausdruck
gab, indem es eine Wiege mit der Unterschrift darſtellte:
„Ich, Meister Kluge, würde lachen, :
Dürft’ ich für Friedrich bald 'ne Wiege machen.“
Der König ließ sofort den Mann herausrufen, reichte ihm
die Hand und sagte: „Ich verspreche es Ihm, daß kein an-
derer als Er das besagte Möbel anfertigen soll, wenn ſich
ein Insasse dafür findet."
Der Anlaß fand ſich bekanntlich nicht, denn Friedrichs Ehe
blieb kinderlos, und so mußte Meister Kluge darauf verzichten,
Hofwiegenlieferant zu werden. I. W.
Anion Deultſche Werlagsgeſellſchaft in Btuttgart, Werlin, TDeipzig. &-
In unſ]erem Verlage erſcheinkt und iſt durch jede Buch- und Rolporkagehandlung wu beziehen:
Unser Bismarck. ... C.W. Allers.Hans Kraemer.
m Gedächtnis-Flusgabe. “a
Inhalt: ca. 296 Seiten Text mit etwa 180 Illuſtrationen in ein- und mehrfarbigem UKunſtdruck, darunter 22 Extra-Uunſtblätter.
= « Vollständig in 20 vierzehntägigen Liekerungen zum Preise von je so Pfennig. « «
.-
-
Sin würdiges Denkmal der Erinnerung an den großen Toten, um das Andenken an deſsſen das Jahrhundert überragende Heldengeſstalt und die
große Zeit, welche das Gepräge seiner gewaltigen Persönlichkeit trägt, uns und den kommenden Generationen in Wort und Bild dauernd feſtzuhalten. Von
allen Bildern des Altreichskanzlers, so schreibt ein Verehrer desselben, dürfen die Allersſchen den größten Anspruch an lebendige Aehnlichkeit machen. Der
von Hans Kraemer ſo ſchön geschriebene Text erzählt uns, bald anmutig plaudernd, bald erhebend und begeiſternd, aus alten und jungen Tagen des
eiſernen Kanzlers. Das Werk ſchildert uns den Fürsten gemütvoll im intimen Rreise seiner Familie und seiner Freunde und gestattet manchen Einblick in
Intimitäten, mit denen bekannt zu werden ſsich sonst keine Gelegenheit bietet. :
+ Probeliekerungen in allen Buch- und Kolportagebandlungen. .
KLOSTER-
BISLIOTHE. .
BIBLIOTHEK
UASBERG GS.
Da s Bu ch für Alle.
107
Zeit und der Notwendigkeit Rechnung tragend, neue
Einrichtungen entstehen werden, welche das Trinkgeld
vollständig überflüſſig machen.
Eine gerade in dieſer Beziehung höchſt bemerkens-
werte Bewegung macht sich jeßt ſchon geltend. Etwas
den Reisenden ganz außerordentlich Beläſtigendes ſind
die Hoteltrinkgelder. Uebernachtet man in einem Galt-
hofe und zahlt für das Zimmer drei Mark, so ist das
ja keine allzu große’ Ausgabe. Mit Recht aber iſt der
Reiſende entrüſtet, daß er für eine Nacht außerdem noch
gzu zahlen hat: Trinkgelder an den Portier, an den
Zimmerkellner, an den Hausknecht, an das Stuben-
mädchen und womöglich noch an den Gaſthofskutſcher,
der ihn zum Bahnhof bringt. Es beträgt dies wo-
t GU z dt ts es hire:
wegs ſind, und durch die große Uebung im Reiſen
und durch die umsichtige Wahl der Gasthöfe ſich das
Trinkgeld möglichst billig zu machen verſtehen, müſſen
in ihren Ausgabepoſten eine ganz gewaltige Summe
für Trinkgelder aufnehmen. Man hat berechnet, daß
es in Deutſchland sechzigtauſend reiſende Kaufleute
giebt, die für Wohnung und Lebensmittel 144 Mil-
lionen Mark jährlich ausgeben. Diese 144 Millionen
Mark würden um ein Bedeutendes herabgeſetzt werden,
brauchten diese Reiſenden keine Trinkgelder zu zahlen.
Man darf annehmen, daß ihnen im ganzen etwa zehn
Millionen Mark durch Aufhebung der Trinkgelder jähr-
lich erſpart werden könnten. Diese Ersparnis käme
den Chefs der Firmen zu gute, welche die Reiſenden
ausſchicken, und ſo iſt denn die Anregung bereits durch
die Tageszeitungen gegeben worden, die Chefs großer
Häuſer, überhaupt alle Firmeninhaber, die Reisende
verwenden, ſollten sich zu einem Verein oder einem
Verband zuſammenſchließen, der es entweder durchsetzt,
daß die Geſchäftsreiſenden gar keine Trinkgelder mehr
zu zahlen haben, oder der sich dazu aufrafft, in den.
größeren Städten auf eigene Kosten Hotels, in denen
es keine Trinkgelder giebt, zu errichten und zu betreiben,
die sich ja vorzüglich bezahlt machen müsſſen, da von den
Reiſenden alljährlich ſo bedeutende Summen ausgegeben
Ö werden. Ein großer Teil der letzteren würde dann in
die Taſchen der Verbandsmitglieder zurückfließen.
Wir brauchen angesichts dieſer ſich kundgebenden
praktiſchen Bewegung gegen das Trinkgelderweſen nicht
zu fürchten, daß eine wirkliche Kalamität durch die
Trinkgelderwirtſchaft entſteht, ja wir können ruhig be-
haupten, auch das Trinkgeldwesen trägt die Ptomatine
bereits in ſich, die ihm dereinst, sei es auch vielleicht
erſt in Jahren, den Garaus machen werden.
Mannigfaltiges. c%acdrus verboten.)
ZLeichenfeiern vor dem Tode. — Daß Kaiser Karl V.
nach seiner freiwilligen Thronentsagung sich in der Kapelle
des ſpaniſchen Kloſters San Yuſte den leßten Akt, der das
M Ut co; tic "Vith t:
_ würdige Vorkommnis wird uns pſ9ychologiſch verſtändlicher,
wenn wir hören, daß jene Totenfeier des weltmüden Kaisers
keineswegs als ein durchaus vereinzelter Fall betrachtet wer-
den kann. Vielmehr wurden derartige Feiern im Mittelalter
verſchiedentlich veranstaltet. ;
Ein ähnliches Vorkommnis ereignete ſich zum Beiſpiel
anderthalb Jahrhunderte früher in England, im Jahre
1312. Damals regierte der ſchwache König Eduard II.,
welcher völlig von einem unwürdigen Günſtling, dem Gas-
cogner Peter v. Gaveſton, beherrſcht wurde. Die engliſchen
Barone, durch den Uebermut des Fremden erbittert, bemäch-
etwa Uebles angethan habe.
tigten ſich ſchließlich desselben und ließen ihn zum Tode
verurteilen. Die letzten Stunden Gaveſstons beschreibt ein
zeitgenössiſcher Schriftsteller folgendermaßen: Nachdem er
gebeichtet, berief er die Barone und redete sie mit folgen-
den Worten an: „Da ich einmal sterben muß, so bitte
ich, es möge mir wenigstens vergönnt ſein, hinsichtlich meiner
Person noch einige Anordnungen zu treffen. Zuvor aber
verzeihe ich allen denen, die mich beleidigt haben, wie ich auch
meine Feinde bitte, mir nichts nachzutragen, was ich ihnen
möchten ihre Geistlichen für ihn Seelenmessen leſen lassen,
was die Herren auch verſprachen. Alsdann legte er ſich auf
eine Bahre und ließ, als ob er ſchon geſtorben wäre, das
Totenamt feiern. Nachdem dies vorüber war, erſuchte er die
Barone noch darum, daß man ihm vor der Enthauptung
Bruſt, Nieren- und Herzgegend mit dem Schwerte durchbohren
möge, damit er, bereits tot, von der Hinrichtung selbst nichts
mehr fühle. Und so geschah es auch.
Faſt zu gleicher Zeit fand zu Toulouſe ebenfalls ein der-
artiges Greignis statt. Hier feierte im Jahre 1327 Wilhelm
v. Scanquence, Bürgermeister der Stadt, lebend seine Exe-
quien in der Dominikanerkirche. Auf der Bahre liegend,
hörte auch er sein eigenes Totenamt; dann hob man die
Bahre und trug sie. als sollte die Beiſezung vor sich gehen,
bis zum Hochaltare, wo sie niedergeſeßzt wurde. Darauf ging
er mit seinen Genossen nach Hauſe, wo sie mit einem Leichen-
ſchmauſe bedacht wurden. ~ Karls V. Leichenfeier ist somit
nur die letzte bekannte Ausübung eines im Mittelalter nicht
ungewöhnlichen Brauches gewesen. . C. T.
Eine JFiſchhyäne. + Als eine wahre Hyäne des Wassers
wird von verschiedenen Forſchern ein Süßwaſserfisch Mittel- und
Südamerikas, die Piraya oder der Pirai, bezeichnet, weil seine
Gefräßigkeit gerade zu einzig dasteht. Der Pirai erreicht nur eine
Länge von dreißig Centimeter und findet sich in der Regel un-
gefähr sechzig Seemeilen von den Mündungen der Flüsse auf-
wärts in Buchten und an Stellen mit schwacher Strömung.
Ueberall, wo ihnen Beute winkt, stellen sich die Pirais zu
Tauſenden ein und begleiten mit Vorliebe die Boote. So-
bald irgend ein Abfall aus dem Boote in das Waſser ge-
ſchüttet wird, dunkelt ſich dasselbe von der ungeheuer anwachsen-
den Menge dieser Fiſche. Es entſpinnt sich ein wütender
Kampf um jeden Brocken, nach dessen Beendigung stets zahl-
reiche Fiſchleichen die Oberfläche bedecken. Von ihrer Gefräßig-
keit giebt der bekannte Reiſende Schomburgk folgende Schilde-
rung: „Greifen sie einen größeren Fiſch an, so beißen ſie ihm
zuerst die Schwanzfloſſe ab und berauben damit den Gegner
seines Hauptbewegungswerkzeuges, während die übrigen über
ihn herfallen und ihn bis auf den Kopf zerfleiſchen und ver-
zehren. Selbst die Füße der Wasservögel, Schildkröten und
die Zehen der Alligatoren sind vor ihnen nicht ſicher.
Eines Abends, als ich mich mit Angeln beschäftigte, zog
ich einen ziemlich ansehnlichen Pirai ans Land. Nachdem
ich ihn mit einigen kräftigen Schlägen auf den Kopf ge-
tötet zu haben glaubte, legte ich ihn neben mich auf die
Klippe, plötzlich jedoch machte er wieder einige Bewegungen
und, bevor ich es verhindern konnte, ſchwamm er, wenn auch
noch halb betäubt, auf der Oberfläche des Wassers umher.
Sofort waren ſechzehn bis zwanzig seiner Genoſſen um ihn
verſammelt, und nach einigen Minuten war nur der Kopf
noch von ihm übrig.“
Selbst den Menſchen verſchonen die Pirais nicht. , Auch
die Pirais ,“ berichtet der ſchon genannte Forschungsreisende
Schomburgk, ,„durchfurchten den Wasserſaum und ſchälten dabei
einem meiner Begleiter, der eben seine Hände waſchen wollte,
zwei seiner Finger faſt rein ab, ſo daß der Unglückliche die-
ſelben während eines großen Teils der Reise fast gar nicht
gebrauchen konnte. Die kühlenden Wellen des Fluſſes waren
bei der unaussſtehlichen Hitze für unsere Gesundheit die größte
Erquickung, welche uns aber leider nur zu bald vergällt
wurde, da einem der Indianerknaben, welche uns gefolgt
waren, beim Ueberſchwimmen des Fluſſes von den gefräßigen
Pirais ein großes Stück Fleiſch aus dem Fuße gerissen wurde.
Das ſchreckliche Aufschreien des Knaben, als er die Wunde
erhielt, ließ uns anfänglich befürchten, er sei die Beute eines
B S S BEE Ss ui
Die Pirais sind daher die gefürchtetſten Bewohner der
Darauf bat er die Barone, sie |
Flüſſe Mittel- und Südamerikas, gegen die ein heftiger Ver-
nichtigungskrieg geführt wird, der aber bei der großen Vermeh-
rung der Fiſche troßdem keine Erleichterung ſchafft. Th. S.
Demut und Weſcheidenheit. + Der Komponiſt Lortzing
trat in den Jahren 1819 bis 1833 an den Theatern von
Düsseldorf , Aachen, Köln und Detmold als Tenorbuffo auf
und kam dann in gleicher Cigenſschaft an das Stadttheater
nach Leipzig. Hier wurde er bald der erklärte Liebling des
Publikums, namentlich der Studenten.
Damals war ein Schwank Louis Schneiders, „Der reiſende
Student“, sehr beliebt. Lorting erregte in der Titelrolle be-
ſonders durch den Vortrag des Liedes „Ungeheure Heiterkeit
iſt meines Lebens Regel“ Stürme der Begeisterung. So war
es auch in Leipzig bei der ersten Aufführung. Deſto mehr
erſtaunte Lorzing, als ihm der Regierungrat Dr. Demuth
als Zensor die Wiederholung der ersten Zeile des Liedes ver-
bot. Niemand hatte bis jettt dasselbe beanstandet, die prickelnde
Melodie geſsiel, und an den Worten „Ungeheure Heiterkeit“
nahm kein Menſch den geringsten Anstoß. Lorting wagte es
aber troß des Verbots, die ihm verbotene Zeile bei der
zweiten Aufführung wieder zu ſingen. Die Folge davon
waren drei Tage „Stockhaus"“, die der widerspenstige Sänger
absitzen mußte.
Er war kaum aus seinem Arrest entlassen, als „„Der rei-
ſende Student“ wieder auf dem Spielplan erschien. Das
Theater war überfüllt, im Parterre ſaßen Mann an Mann
die Leipziger Studenten, und dröhnender Beifall empfing den
gemaßregelten Künstler. In der Ratsloge saß der gestrenge
Zensor Dr. Demuth. Jett stimmte die Musik die Einleitung
zu „Ungeheure Heiterkeit“ an; gespannt lauſchte alles, wo
durch Lortzing die gestrichene Zeile erseßen werde.
Lorting trat bis an die Rampe vor, warf einen lächeln-
den Blick auf die Ratsloge und sang: „Demut und Be-
ſcheid enheit ſind meines Lebens Regel.“
Da erschütterte ein Orkan der Begeiſterung das ganze
Haus, dröhnender Beifall erſcholl, und die Studenten riefen :
„Lorting 'raus !“ ~ Der Künstler erſchien wohl ein dutend-
mal vor dem Vorhang und verbeugte ſich dankend. Darauf
aber riefen die Studenten drohend: „Demuth 'raus !“ + und
dicfer verſchwand eiligſt aus seiner Loge und machte sich still
avon. : D.
Die goldenen Eier. + Bei der Krönung Maximilians
zum deutſchen Kaiſer am 5. April 1486 erschienen während
des Krönungsmahles zwölf Abgeordnete der Kaufmannſchaft
in Aachen und vermehrten die Geschenke durch einen Hanno
korb, der mit goldenen Eiern gefüllt war. Die im Vor-
zimmer harrenden Spender der originellen Gabe wurden je-
doch nicht wenig überrascht, als ein Kämmerer des Kaisers
mit der Weiſung an sie herantrat, daß er die Herren auf
Befehl Seiner Majestät sogleich in Haft nehmen und bis auf
weiteres festhalten solle. Sie wurden auch in der That in
ein besonderes Gemach geführt, wo aber alsbald der Raiſer
mit ſchalkhafter Miene eintrat, jedem der Arrestanten die
Hand reichte und sagte: „Jhr habt mich hoch erfreut. Hühner,
die so rare Eier legen, darf ich aber wohl nicht ſogleich
wieder fliegen laſſen. Wollet es euch gefallen laſſene, deß
ich euch für die nächſten drei Tage nach Gebühr bewirte."
So blieben die Eierſpender während der Festtage die
Gäste des Kaiſers und wurden von ihm aufs höchſte geehrt.
Jahrhunderte lang aber hießen die Aachener Kaufleute im
ganzen deutschen Reich die „güldenen Hühner.“ J. W.
Friedrichs des Großen Wiegenlkieferant. + Als Fried-
rich dem Großen beim Cinzuge in Breslau während des ersſten
ſchlesiſchen Krieges von der Bürgerſchaft gehuldigt wurde,
und er am abend die Illumination der Stadt in Augen-
ſchein nahm, bemerkte er am Hauſe eines Tiſchlermeiſters ein
Transparent, welches einem allgemeinen Wunſche Ausdruck
gab, indem es eine Wiege mit der Unterschrift darſtellte:
„Ich, Meister Kluge, würde lachen, :
Dürft’ ich für Friedrich bald 'ne Wiege machen.“
Der König ließ sofort den Mann herausrufen, reichte ihm
die Hand und sagte: „Ich verspreche es Ihm, daß kein an-
derer als Er das besagte Möbel anfertigen soll, wenn ſich
ein Insasse dafür findet."
Der Anlaß fand ſich bekanntlich nicht, denn Friedrichs Ehe
blieb kinderlos, und so mußte Meister Kluge darauf verzichten,
Hofwiegenlieferant zu werden. I. W.
Anion Deultſche Werlagsgeſellſchaft in Btuttgart, Werlin, TDeipzig. &-
In unſ]erem Verlage erſcheinkt und iſt durch jede Buch- und Rolporkagehandlung wu beziehen:
Unser Bismarck. ... C.W. Allers.Hans Kraemer.
m Gedächtnis-Flusgabe. “a
Inhalt: ca. 296 Seiten Text mit etwa 180 Illuſtrationen in ein- und mehrfarbigem UKunſtdruck, darunter 22 Extra-Uunſtblätter.
= « Vollständig in 20 vierzehntägigen Liekerungen zum Preise von je so Pfennig. « «
.-
-
Sin würdiges Denkmal der Erinnerung an den großen Toten, um das Andenken an deſsſen das Jahrhundert überragende Heldengeſstalt und die
große Zeit, welche das Gepräge seiner gewaltigen Persönlichkeit trägt, uns und den kommenden Generationen in Wort und Bild dauernd feſtzuhalten. Von
allen Bildern des Altreichskanzlers, so schreibt ein Verehrer desselben, dürfen die Allersſchen den größten Anspruch an lebendige Aehnlichkeit machen. Der
von Hans Kraemer ſo ſchön geschriebene Text erzählt uns, bald anmutig plaudernd, bald erhebend und begeiſternd, aus alten und jungen Tagen des
eiſernen Kanzlers. Das Werk ſchildert uns den Fürsten gemütvoll im intimen Rreise seiner Familie und seiner Freunde und gestattet manchen Einblick in
Intimitäten, mit denen bekannt zu werden ſsich sonst keine Gelegenheit bietet. :
+ Probeliekerungen in allen Buch- und Kolportagebandlungen. .
KLOSTER-
BISLIOTHE. .
BIBLIOTHEK
UASBERG GS.