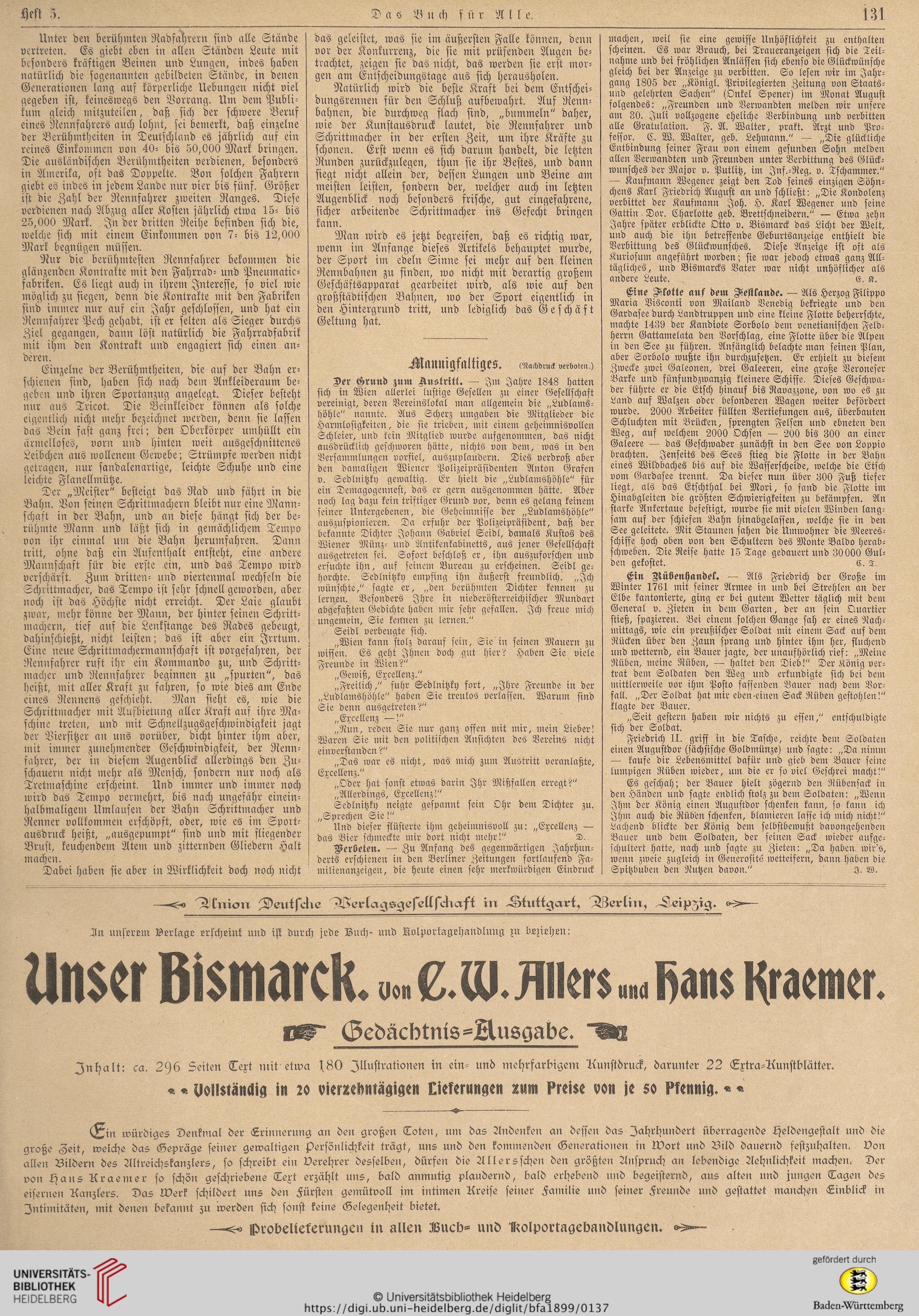"Heft 3.
Unter den berühmten Radfahrern sind alle Stände
vertreten. Es giebt eben in allen Ständen Leute mit
besonders kräftigen Beinen und Lungen, indes haben
natürlich die sogenannten gebildeten Stände, in denen
Generationen lang auf körperliche Uebungen nicht viel
gegeben ist, keineswegs den Vorrang. Um dem Publi-
kum gleich mitzuteilen, daß ſich der ſchwere Beruf
eines Rennfahrers auch lohnt, sei bemerkt, daß einzelne
der Berühmtheiten in Deutſchland es jährlich auf ein
reines Einkommen von 40- bis 50,000 Mark bringen.
Die ausländiſchen Berühmtheiten verdienen, besonders
in Amerika, oft das Doppelte. Von ſFolchen Fahrern
giebt es indes in jedem Lande nur vier bis fünf. Größer
iſt die Zahl der Rennfahrer zweiten Ranges. Dieſe
verdienen nach Abzug aller Koſten jährlich etwa 15- bis
25,000 Mark. In der dritten Reihe befinden ſich die,
welche ſich mit einem Einkommen von 7- bis 12,000
Mark begnügen müßſen.
Nur die berühmteſten Rennfahrer bekommen die
glänzenden Kontrakte mit den Fahrrad- und Pneumatic-
fabriken. Es liegt auch in ihrem Interesſe, so viel wie
möglich zu siegen, denn die Kontrakte mit den Fabriken
sind immer nur auf ein Jahr geſchloſſen, und hat ein
Rennfahrer Pech gehabt, iſt er ſelten als Sieger durchs
Ziel gegangen, dann löſt natürlich die Fahrradfabrik
mit ihm den Kontrakt und engagiert ſich einen ann |)
deren.
Einzelne der Berühmtheiten, die auf der Bahn er-
schienen ſind, haben sich nach dem Anlleideraum be-
geben und ihren Sportanzug angelegt. Dieser besteht
nur aus Tricot. Die Beinkleider können als Fsolche
eigentlich nicht mehr bezeichnet werden, denn Jie lassen
das Bein faſt ganz frei; den Oberkörper umhüllt ein
ärmelloſes, vorn und hinten weit ausgeſchnittenes
Leibchen aus wollenem Gewebe; Strümpfe werden nicht
getragen, nur sandalenartige, leichte Schuhe und eine
leichte Flanellmüye. :
Der „Meister“ beſteigt das Rad und fährt in die
Bahn. Von seinen Schrittmachern bleibt nur eine Mann-
schaft in der Bahn, und an dieſe hängt ſich der be-
. rühmte Mann und läßt ſich in gemächlichem Tempo
von ihr einmal um die Bahn herumfahren. Dann
tritt, ohne daß ein Aufenthalt entsteht, eine andere
Mannſchaft für die erſte ein, und das Tempo wird
verſchärſt. Zum dritten- und viertenmal wechseln die
Schrittmacher, das Tempo iſt sehr ſchnell geworden, aber
noch iſt das Höchſte nicht erreicht. Der Laie glaubt
zwar, mehr könne der Mann, der hinter seinen Schritt-
machern, tief auf die Lenkſtange des Rades gebeugt,
dahinſchießt, nicht leiſten; das iſt aber ein Jrrtum.
Eine neue Schrittmachermannſchaft iſt vorgefahren, der
Rennfahrer ruft ihr ein Kommando zu, und Schritt-
macher und Rennfahrer beginnen zu ,ſpurten“, das
heißt, mit aller Kraft zu fahren, so wie dies am Ende
eines Rennens geschieh. Man ſieht es, wie die
Schrittmacher mit Aufbietung aller Kraft auf ihre Ma-
schine treten, und mit Schnellzugsgeſchwindigkeit jagt
der Vierſiter an uns vorüber, dicht hinter ihm aber,
mit immer zunehmender Geſchwindigkeit, der Renn-
fahrer, der in dieſem Augenblick allerdings den Zu-
ſchauern nicht mehr als Menſch, sondern nur noch als
Tretmaſchine erſcheint. Und immer und immer noch
wird das Tempo vermehrt, bis nach ungefähr einein-
halbmaligem Umlaufen der Bahn Schrittmacher und
Renner vollkommen erſchöpft, oder, wie es im Spolt-
ausdruck heißt, „ausgepumpt“ sind und mit fliegender
Bruſt, keuchendem Atem und zitternden Gliedern Halt
machen.
Y.; haben sie aber in Wirklichkeit doch noch nicht
„ungemein, Sie kennen zu lernen."
Da s Buch für Alle.
das geleiſtet, was ſie im äußerſten Falle können, denn
vor der Konkurrenz, die sie mit prüfenden Augen be-
trachtet, zeigen ſie das nicht, das werden ſie erſt mor-
gen am Entſcheidungstage aus ſich herausholen.
Natürlich wird die beſte Kraft bei dem Entschei-
dungsrennen für den Schluß aufbewahrt. Auf Renn-
bahnen, die durchweg flach ſind, „bummeln“ daher,
wie der Kunſstausdruck lautet, die Rennfahrer und
Schrittmacher in der erſten Zeit, um ihre Kräfte zu
ſchonen. Erſt wenn es ſich darum handelt, die letzten
Runden zurückzulegen, thun sie ihr Beſtes, und dann
ſiegt nicht allein der, deſſen Lungen und Beine am
meiſten leiſten, ſondern der, welcher auch im letzten
Augenblick noch besonders friſche, gut eingefahrene,
her arbeitende Schrittmacher ins Gefecht bringen
ann.
Man wird es jetzt begreifen, daß es richtig war,
wenn im Anfange dieses Artikels behauptet wurde,
der Sport im edeln Sinne sei mehr auf den kleinen
Rennbahnen zu finden, wo nicht mit derartig großem
Geſchäftsapparat gearbeitet wird, als wie auf den
großſtädtiſchen Bahnen, wo der Sport eigentlich in
zn. Hittetetens tritt, und lediglich das G eſch äft
eltung hat. : :
Mannigfalltiges. cnasdru verboten.)
Der Grund zum Austritki. + Im Jahre 1848 hatten
ſich in Wien allerlei luſtige Gesellen zu einer Gesellschaft
vereinigt, deren Vereinslokal man allgemein die ,„Ludlams-
höhle" nannte. Aus Scherz umgaben die Mitglieder die
Harmloſigkeiten, die ſie trieben, mit einem geheimnisvollen
Schleier, und kein Mitglied wurde aufgenommen, das nicht
ausdrücklich geſchworen hätte, nichts von dem, was in den
Verſammlungen vorfiel, auszuplaudern. Dies verdroß aber
den damaligen Wiener Polizeipräſidenten Anton Grafen
v. Sedlnitzky gewaltig. Er hielt die „Ludlamshöhle“ für
ein Demagogennesſt, das er gern ausgenommen hätte. Aber
noch lag dazu kein triftiger Grund vor, denn es gelang keinem
seiner Untergebenen, die Geheimnisse der „Ludlamshöhle"
auszuſpionieren. Da erfuhr der Polizeipräsident, daß der
bekannte Dichter Johann Gabriel Seidl, damals Kuſtos des
Wiener Münz- und Antikenkabinetts, aus jener Gesellschaft
ausgetreten sei. Sofort beſchloß er, ihn auszuforſchen und
ersuchte ihn, auf seinem Bureau zu erſcheinen. Seidl ge-
horchte. Sedlnitkky empfing ihn äußerſt freundlich.
wünſchte," sagte er, „den berühmten Dichter kennen zu
lernen. Besonders Ihre in niederöſterreichiſcher Mundart
abgefaßten Gedichte haben mir sehr gefallen. Ich freue mich
î Seidl verbeugte ſich.
„Wien kann stolz darauf sein, Sie in ſeinen Mauern zu
wiſſen. Es geht Ihnen doch gut hier? Haben Sie viele
Freunde in Wien?!
„Gewiß, Ercellenz."
„Freilich,“ fuhr Sedlnitky fort, „Jhre Freunde in der
„Ludlamshöhle“ haben Sie treulos verlaſſen. Warum ſind
Sie denn ausgetreten ?
„Excellenz ~!Ú ;
„Nun, reden Sie nur ganz offen mit mir, mein Lieber!
Waren Sie mit den politiſchen Ansichten des Vereins nicht
einverſtanden ? ; ;
„Das war es nicht, was mich zum Austritt veranlaßte,
Excellenz." i
: „Oder hat sonst etwas darin Ihr Mißfallen erregt !“
„Allerdings, Exrcellenz !“
Sedlnitzky neigte geſpannt sein Ohr dem Dichter zu.
„Sprechen Sie !“ :
Und dieser flüsterte ihm geheimnisvoll zu: „Excellenz –
das Bier ſchmeckte mir dort nicht mehr!“ D.
VYerbeten. + Zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhun-
derts erschienen in den Berliner Zeitungen fortlaufend Fa-
milienanzeigen, die heute einen ſehr merkwürdigen Eindruck
„Ich |
131
machen, weil ſie eine gewisse Unhöflichkeit zu enthalten
scheinen. Es war Brauch, bei Traueranzeigen sich die Teil-
nahme und bei fröhlichen Anlässen sich ebenso die Glückwünſche
gleich bei der Anzeige zu verbitten. So lesen wir im Jahr-
gang 1805 der „Königl. Privilegierten Zeitung von Staats-
und gelehrten Sachen“ (Onkel Spener) im Monat Auguſte._
folgendes: „Freunden und Verwandten melden wir unsere
am 80. Juli vollzogene eheliche Verbindung und verbitten
alle Gratulation. F. A. Walter, prakt. Arzt und Pro-
feſſor. C. W. Walter, geb. Lehmann." - ,Die glückliche
Entbindung seiner Frau von einem gesunden Sohn melden
allen Verwandten und Freunden unter Verbittung des Glück-
wunſches der Major v. Putlit,, im Inf.-Reg. v. Tſchammer."
— Kaufmann Wegener zeigt den Tod ſeines einzigen Söhn-
chens Karl Friedrich Auguſt an und schließt: „Die Kondolenz
verbittet der Kaufmann Joh. H. Karl Wegener und ſeine
Gattin . Dor. Charlotte geb. Brettſchneidern." ~ Etwa zehn
Jahre später erblickte Otto v. Bismarck das Licht der Welt,
und auch die ihn betreffende Geburtsanzeige enthielt die
Verbittung des Glückwunſches. Diese Anzeige iſt oft as
Kurioſum angeführt worden ; sie war jedoch etwas ganz All-
tägliches. u Bismarcks Vater war nicht 'zsfticher .o
Eine Iikotte auf dem Feſtkande. – Als Herzog Filippo
Maria Visconti von Mailand Venedig bekriegte unn den
Gardasee durch Landtruppen und eine kleine Flotte beherrſchte,
machte 1439 der Kandiote Sorbolo dem venetianiſchen Feld-
herrn Gattamelata den Vorschlag, eine Flotte über die Alpen
in den See zu führen. Anfänglich belachte man seinen Plan,
aber Sorbolo wußte ihn durchzuſeßzen. Er erhielt zu dieſem
Zwecke zwei Galeonen, drei Galeeren, eine große Veroneſer
Barke und fünfundzwanzig kleinere Schiffe. Dieſes Geſchwa-
der führte er die Etſch hinauf bis Ravazzone, von wo es zu
Land auf Walzen oder besonderen Wagen weiter befördert
wurde. 2000 Arbeiter füllten Vertiefungen aus, überbauten
Schluchten mit Brücken, ſprengten Felſen und ebneten den
Weg, auf welchem 2000 Ochſen ~ 200 bis 300 an einer
Galeere ~ das Geſchwader zunächſt in den See von Loppio
brachten. Jenseits des Sees stieg die Flotte in der Bahn
eines Wildbaches bis auf die Waſsserſcheide, welche die Etsch
vom Gardaſee trennt. Da dieser nun über 300 Juß tiefer
liegt, als das Etſchthal bei Mori, so fand die Flotte im
Hinabgleiten die größten Schwierigkeiten zu bekämpfen. An
ſtarke Ankertaue befestigt, wurde ſie mit vielen Winden lang-
ſam auf der ſchiefen Bahn hinabgelassen, welche ſie in den
See geleitete. Mit Staunen sahen die Umwohner die Meeres-
schiffe hoch oben von den Schultern des Monte Baldo herab-
hustet Dis Reise hatte 15 Tage gedauert und 30 000 Gul-
en gekoſtet. C. T.
Ein Rübenhandel. + Als Friedrich der Große im
Winter 1761 mit seiner Armee in und bei Strehlen an der
Elbe kantonierte, ging er bei gutem Wetter täglich mit dem
General v. Zieten in dem Garten, der an sein Quartier
stieß, ſpazieren. Bei einem solchen Gange sah er eines Nh.
mittags, wie ein preußiſcher Soldat mit einem Sack auf dem
Rücken über den Zaun sprang und hinter ihm her, fluchend
und wetternd, ein Bauer jagte, der unaufhörlich rief: „Meine
Rüben, meine Rüben, = haltet den Dieb!" Der König ver-
trat dem Soldaten den Weg und erkundigte sich bei dem
mittlerweile vor ihm Poſto fassenden Bauer nach dem Vor-
fall. „Der Soldat hat mir eben-einen Sack Rüben gestohlen!“
klagte der Bauer.
„Seit geſtern haben wir nichts zu essen," entschuldigte
fich der Solda.e. w
Friedrich II. griff in die Taſche, reichte dem Soldaten
einen Auguſtdor (sächſiſche Goldmünze) und sagte: „Da nimm
~ kaufe dir Lebensmittel dafür und gieb dem Bauer ſeine
lumpigen Rüben wieder, um die er so viel Geschrei macht!“
Es geſchah; der Bauer hielt zögernd den Rübensack in
den Händen und ſagte endlich stolz zu dem Soldaten: „Wenn
Ihm der König einen Auguſtdor ſchenken kann, so kann ich
Ihm auch die Rüben ſchenken, blamieren lasse ich mich nicht!"
Lachend blickte der König dem selbstbewußt davongehenden
Bauer und dem Soldaten, der seinen Sack wieder aufge:
ſchultert hatte, nach und sagte zu Zieten: „Da haben wir's,
wenn zweie zugleich in Generosité wetteifern, dann haben die
Spitzbuben den Nuten davon." : ; J. W.
& Nlnion Deutſche MWerlagsgeſellſchaft in Btuttgart, Werlin, Deipzig. e
In unlerem Prrlage erſcheink und iſt duxch jede Buch- und Kolporkagehandlung zu beziehen:
Unser hismarck. &. €.W.Allers „Hans Kraemer.
D Gedächtnis -Flusgabe. 2
Inhalt: ca. 296 Seiten. Cext mit etwa 180 Jluſtrationen in ein- und mehrfarbigem Kunſtdruck, darunter 22 Extra-Kunſtblätter.
« « Vollständig in 20 vierzehntägigen Liekerungen zum Preise von je so Pfennig. « «
Ötx-\
D..!
Sin würdiges Denkmal der Erinnerung an den großen Toten, um das Andenken an dessen das Jahrhundert überragende Heldengeſtalt und die
große Zeit, welche das Gepräge seiner gewaltigen Persönlichkeit trägt, uns und den kommenden Generationen in Wort und Bild dauernd festzuhalten. Von
allen Bildern des Altreichskanzlers, so schreibt ein Verehrer desselben, dürfen die Allers ſchen den größten Anspruch an lebendige Aehnlichkeit machen. Der
von Hans Kraemer ſo ſchön geſchriebene Text erzählt uns, bald anmutig plaudernd, bald erhebend und begeiſternd, aus alten und jungen Tagen des
eiſernen Kanzlers. Das Werk ſchildert uns den Fürsten gemütvoll im intimen Rreise seiner Familie und seiner Freunde und gestattet manchen Einblick in
Intimitäten, mit denen bekannt zu werden ſich sonst keine Gelegenheit bietet. :
=» Probelieterungen in allen Buch- und Tkolportagebandlungen. e
Unter den berühmten Radfahrern sind alle Stände
vertreten. Es giebt eben in allen Ständen Leute mit
besonders kräftigen Beinen und Lungen, indes haben
natürlich die sogenannten gebildeten Stände, in denen
Generationen lang auf körperliche Uebungen nicht viel
gegeben ist, keineswegs den Vorrang. Um dem Publi-
kum gleich mitzuteilen, daß ſich der ſchwere Beruf
eines Rennfahrers auch lohnt, sei bemerkt, daß einzelne
der Berühmtheiten in Deutſchland es jährlich auf ein
reines Einkommen von 40- bis 50,000 Mark bringen.
Die ausländiſchen Berühmtheiten verdienen, besonders
in Amerika, oft das Doppelte. Von ſFolchen Fahrern
giebt es indes in jedem Lande nur vier bis fünf. Größer
iſt die Zahl der Rennfahrer zweiten Ranges. Dieſe
verdienen nach Abzug aller Koſten jährlich etwa 15- bis
25,000 Mark. In der dritten Reihe befinden ſich die,
welche ſich mit einem Einkommen von 7- bis 12,000
Mark begnügen müßſen.
Nur die berühmteſten Rennfahrer bekommen die
glänzenden Kontrakte mit den Fahrrad- und Pneumatic-
fabriken. Es liegt auch in ihrem Interesſe, so viel wie
möglich zu siegen, denn die Kontrakte mit den Fabriken
sind immer nur auf ein Jahr geſchloſſen, und hat ein
Rennfahrer Pech gehabt, iſt er ſelten als Sieger durchs
Ziel gegangen, dann löſt natürlich die Fahrradfabrik
mit ihm den Kontrakt und engagiert ſich einen ann |)
deren.
Einzelne der Berühmtheiten, die auf der Bahn er-
schienen ſind, haben sich nach dem Anlleideraum be-
geben und ihren Sportanzug angelegt. Dieser besteht
nur aus Tricot. Die Beinkleider können als Fsolche
eigentlich nicht mehr bezeichnet werden, denn Jie lassen
das Bein faſt ganz frei; den Oberkörper umhüllt ein
ärmelloſes, vorn und hinten weit ausgeſchnittenes
Leibchen aus wollenem Gewebe; Strümpfe werden nicht
getragen, nur sandalenartige, leichte Schuhe und eine
leichte Flanellmüye. :
Der „Meister“ beſteigt das Rad und fährt in die
Bahn. Von seinen Schrittmachern bleibt nur eine Mann-
schaft in der Bahn, und an dieſe hängt ſich der be-
. rühmte Mann und läßt ſich in gemächlichem Tempo
von ihr einmal um die Bahn herumfahren. Dann
tritt, ohne daß ein Aufenthalt entsteht, eine andere
Mannſchaft für die erſte ein, und das Tempo wird
verſchärſt. Zum dritten- und viertenmal wechseln die
Schrittmacher, das Tempo iſt sehr ſchnell geworden, aber
noch iſt das Höchſte nicht erreicht. Der Laie glaubt
zwar, mehr könne der Mann, der hinter seinen Schritt-
machern, tief auf die Lenkſtange des Rades gebeugt,
dahinſchießt, nicht leiſten; das iſt aber ein Jrrtum.
Eine neue Schrittmachermannſchaft iſt vorgefahren, der
Rennfahrer ruft ihr ein Kommando zu, und Schritt-
macher und Rennfahrer beginnen zu ,ſpurten“, das
heißt, mit aller Kraft zu fahren, so wie dies am Ende
eines Rennens geschieh. Man ſieht es, wie die
Schrittmacher mit Aufbietung aller Kraft auf ihre Ma-
schine treten, und mit Schnellzugsgeſchwindigkeit jagt
der Vierſiter an uns vorüber, dicht hinter ihm aber,
mit immer zunehmender Geſchwindigkeit, der Renn-
fahrer, der in dieſem Augenblick allerdings den Zu-
ſchauern nicht mehr als Menſch, sondern nur noch als
Tretmaſchine erſcheint. Und immer und immer noch
wird das Tempo vermehrt, bis nach ungefähr einein-
halbmaligem Umlaufen der Bahn Schrittmacher und
Renner vollkommen erſchöpft, oder, wie es im Spolt-
ausdruck heißt, „ausgepumpt“ sind und mit fliegender
Bruſt, keuchendem Atem und zitternden Gliedern Halt
machen.
Y.; haben sie aber in Wirklichkeit doch noch nicht
„ungemein, Sie kennen zu lernen."
Da s Buch für Alle.
das geleiſtet, was ſie im äußerſten Falle können, denn
vor der Konkurrenz, die sie mit prüfenden Augen be-
trachtet, zeigen ſie das nicht, das werden ſie erſt mor-
gen am Entſcheidungstage aus ſich herausholen.
Natürlich wird die beſte Kraft bei dem Entschei-
dungsrennen für den Schluß aufbewahrt. Auf Renn-
bahnen, die durchweg flach ſind, „bummeln“ daher,
wie der Kunſstausdruck lautet, die Rennfahrer und
Schrittmacher in der erſten Zeit, um ihre Kräfte zu
ſchonen. Erſt wenn es ſich darum handelt, die letzten
Runden zurückzulegen, thun sie ihr Beſtes, und dann
ſiegt nicht allein der, deſſen Lungen und Beine am
meiſten leiſten, ſondern der, welcher auch im letzten
Augenblick noch besonders friſche, gut eingefahrene,
her arbeitende Schrittmacher ins Gefecht bringen
ann.
Man wird es jetzt begreifen, daß es richtig war,
wenn im Anfange dieses Artikels behauptet wurde,
der Sport im edeln Sinne sei mehr auf den kleinen
Rennbahnen zu finden, wo nicht mit derartig großem
Geſchäftsapparat gearbeitet wird, als wie auf den
großſtädtiſchen Bahnen, wo der Sport eigentlich in
zn. Hittetetens tritt, und lediglich das G eſch äft
eltung hat. : :
Mannigfalltiges. cnasdru verboten.)
Der Grund zum Austritki. + Im Jahre 1848 hatten
ſich in Wien allerlei luſtige Gesellen zu einer Gesellschaft
vereinigt, deren Vereinslokal man allgemein die ,„Ludlams-
höhle" nannte. Aus Scherz umgaben die Mitglieder die
Harmloſigkeiten, die ſie trieben, mit einem geheimnisvollen
Schleier, und kein Mitglied wurde aufgenommen, das nicht
ausdrücklich geſchworen hätte, nichts von dem, was in den
Verſammlungen vorfiel, auszuplaudern. Dies verdroß aber
den damaligen Wiener Polizeipräſidenten Anton Grafen
v. Sedlnitzky gewaltig. Er hielt die „Ludlamshöhle“ für
ein Demagogennesſt, das er gern ausgenommen hätte. Aber
noch lag dazu kein triftiger Grund vor, denn es gelang keinem
seiner Untergebenen, die Geheimnisse der „Ludlamshöhle"
auszuſpionieren. Da erfuhr der Polizeipräsident, daß der
bekannte Dichter Johann Gabriel Seidl, damals Kuſtos des
Wiener Münz- und Antikenkabinetts, aus jener Gesellschaft
ausgetreten sei. Sofort beſchloß er, ihn auszuforſchen und
ersuchte ihn, auf seinem Bureau zu erſcheinen. Seidl ge-
horchte. Sedlnitkky empfing ihn äußerſt freundlich.
wünſchte," sagte er, „den berühmten Dichter kennen zu
lernen. Besonders Ihre in niederöſterreichiſcher Mundart
abgefaßten Gedichte haben mir sehr gefallen. Ich freue mich
î Seidl verbeugte ſich.
„Wien kann stolz darauf sein, Sie in ſeinen Mauern zu
wiſſen. Es geht Ihnen doch gut hier? Haben Sie viele
Freunde in Wien?!
„Gewiß, Ercellenz."
„Freilich,“ fuhr Sedlnitky fort, „Jhre Freunde in der
„Ludlamshöhle“ haben Sie treulos verlaſſen. Warum ſind
Sie denn ausgetreten ?
„Excellenz ~!Ú ;
„Nun, reden Sie nur ganz offen mit mir, mein Lieber!
Waren Sie mit den politiſchen Ansichten des Vereins nicht
einverſtanden ? ; ;
„Das war es nicht, was mich zum Austritt veranlaßte,
Excellenz." i
: „Oder hat sonst etwas darin Ihr Mißfallen erregt !“
„Allerdings, Exrcellenz !“
Sedlnitzky neigte geſpannt sein Ohr dem Dichter zu.
„Sprechen Sie !“ :
Und dieser flüsterte ihm geheimnisvoll zu: „Excellenz –
das Bier ſchmeckte mir dort nicht mehr!“ D.
VYerbeten. + Zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhun-
derts erschienen in den Berliner Zeitungen fortlaufend Fa-
milienanzeigen, die heute einen ſehr merkwürdigen Eindruck
„Ich |
131
machen, weil ſie eine gewisse Unhöflichkeit zu enthalten
scheinen. Es war Brauch, bei Traueranzeigen sich die Teil-
nahme und bei fröhlichen Anlässen sich ebenso die Glückwünſche
gleich bei der Anzeige zu verbitten. So lesen wir im Jahr-
gang 1805 der „Königl. Privilegierten Zeitung von Staats-
und gelehrten Sachen“ (Onkel Spener) im Monat Auguſte._
folgendes: „Freunden und Verwandten melden wir unsere
am 80. Juli vollzogene eheliche Verbindung und verbitten
alle Gratulation. F. A. Walter, prakt. Arzt und Pro-
feſſor. C. W. Walter, geb. Lehmann." - ,Die glückliche
Entbindung seiner Frau von einem gesunden Sohn melden
allen Verwandten und Freunden unter Verbittung des Glück-
wunſches der Major v. Putlit,, im Inf.-Reg. v. Tſchammer."
— Kaufmann Wegener zeigt den Tod ſeines einzigen Söhn-
chens Karl Friedrich Auguſt an und schließt: „Die Kondolenz
verbittet der Kaufmann Joh. H. Karl Wegener und ſeine
Gattin . Dor. Charlotte geb. Brettſchneidern." ~ Etwa zehn
Jahre später erblickte Otto v. Bismarck das Licht der Welt,
und auch die ihn betreffende Geburtsanzeige enthielt die
Verbittung des Glückwunſches. Diese Anzeige iſt oft as
Kurioſum angeführt worden ; sie war jedoch etwas ganz All-
tägliches. u Bismarcks Vater war nicht 'zsfticher .o
Eine Iikotte auf dem Feſtkande. – Als Herzog Filippo
Maria Visconti von Mailand Venedig bekriegte unn den
Gardasee durch Landtruppen und eine kleine Flotte beherrſchte,
machte 1439 der Kandiote Sorbolo dem venetianiſchen Feld-
herrn Gattamelata den Vorschlag, eine Flotte über die Alpen
in den See zu führen. Anfänglich belachte man seinen Plan,
aber Sorbolo wußte ihn durchzuſeßzen. Er erhielt zu dieſem
Zwecke zwei Galeonen, drei Galeeren, eine große Veroneſer
Barke und fünfundzwanzig kleinere Schiffe. Dieſes Geſchwa-
der führte er die Etſch hinauf bis Ravazzone, von wo es zu
Land auf Walzen oder besonderen Wagen weiter befördert
wurde. 2000 Arbeiter füllten Vertiefungen aus, überbauten
Schluchten mit Brücken, ſprengten Felſen und ebneten den
Weg, auf welchem 2000 Ochſen ~ 200 bis 300 an einer
Galeere ~ das Geſchwader zunächſt in den See von Loppio
brachten. Jenseits des Sees stieg die Flotte in der Bahn
eines Wildbaches bis auf die Waſsserſcheide, welche die Etsch
vom Gardaſee trennt. Da dieser nun über 300 Juß tiefer
liegt, als das Etſchthal bei Mori, so fand die Flotte im
Hinabgleiten die größten Schwierigkeiten zu bekämpfen. An
ſtarke Ankertaue befestigt, wurde ſie mit vielen Winden lang-
ſam auf der ſchiefen Bahn hinabgelassen, welche ſie in den
See geleitete. Mit Staunen sahen die Umwohner die Meeres-
schiffe hoch oben von den Schultern des Monte Baldo herab-
hustet Dis Reise hatte 15 Tage gedauert und 30 000 Gul-
en gekoſtet. C. T.
Ein Rübenhandel. + Als Friedrich der Große im
Winter 1761 mit seiner Armee in und bei Strehlen an der
Elbe kantonierte, ging er bei gutem Wetter täglich mit dem
General v. Zieten in dem Garten, der an sein Quartier
stieß, ſpazieren. Bei einem solchen Gange sah er eines Nh.
mittags, wie ein preußiſcher Soldat mit einem Sack auf dem
Rücken über den Zaun sprang und hinter ihm her, fluchend
und wetternd, ein Bauer jagte, der unaufhörlich rief: „Meine
Rüben, meine Rüben, = haltet den Dieb!" Der König ver-
trat dem Soldaten den Weg und erkundigte sich bei dem
mittlerweile vor ihm Poſto fassenden Bauer nach dem Vor-
fall. „Der Soldat hat mir eben-einen Sack Rüben gestohlen!“
klagte der Bauer.
„Seit geſtern haben wir nichts zu essen," entschuldigte
fich der Solda.e. w
Friedrich II. griff in die Taſche, reichte dem Soldaten
einen Auguſtdor (sächſiſche Goldmünze) und sagte: „Da nimm
~ kaufe dir Lebensmittel dafür und gieb dem Bauer ſeine
lumpigen Rüben wieder, um die er so viel Geschrei macht!“
Es geſchah; der Bauer hielt zögernd den Rübensack in
den Händen und ſagte endlich stolz zu dem Soldaten: „Wenn
Ihm der König einen Auguſtdor ſchenken kann, so kann ich
Ihm auch die Rüben ſchenken, blamieren lasse ich mich nicht!"
Lachend blickte der König dem selbstbewußt davongehenden
Bauer und dem Soldaten, der seinen Sack wieder aufge:
ſchultert hatte, nach und sagte zu Zieten: „Da haben wir's,
wenn zweie zugleich in Generosité wetteifern, dann haben die
Spitzbuben den Nuten davon." : ; J. W.
& Nlnion Deutſche MWerlagsgeſellſchaft in Btuttgart, Werlin, Deipzig. e
In unlerem Prrlage erſcheink und iſt duxch jede Buch- und Kolporkagehandlung zu beziehen:
Unser hismarck. &. €.W.Allers „Hans Kraemer.
D Gedächtnis -Flusgabe. 2
Inhalt: ca. 296 Seiten. Cext mit etwa 180 Jluſtrationen in ein- und mehrfarbigem Kunſtdruck, darunter 22 Extra-Kunſtblätter.
« « Vollständig in 20 vierzehntägigen Liekerungen zum Preise von je so Pfennig. « «
Ötx-\
D..!
Sin würdiges Denkmal der Erinnerung an den großen Toten, um das Andenken an dessen das Jahrhundert überragende Heldengeſtalt und die
große Zeit, welche das Gepräge seiner gewaltigen Persönlichkeit trägt, uns und den kommenden Generationen in Wort und Bild dauernd festzuhalten. Von
allen Bildern des Altreichskanzlers, so schreibt ein Verehrer desselben, dürfen die Allers ſchen den größten Anspruch an lebendige Aehnlichkeit machen. Der
von Hans Kraemer ſo ſchön geſchriebene Text erzählt uns, bald anmutig plaudernd, bald erhebend und begeiſternd, aus alten und jungen Tagen des
eiſernen Kanzlers. Das Werk ſchildert uns den Fürsten gemütvoll im intimen Rreise seiner Familie und seiner Freunde und gestattet manchen Einblick in
Intimitäten, mit denen bekannt zu werden ſich sonst keine Gelegenheit bietet. :
=» Probelieterungen in allen Buch- und Tkolportagebandlungen. e