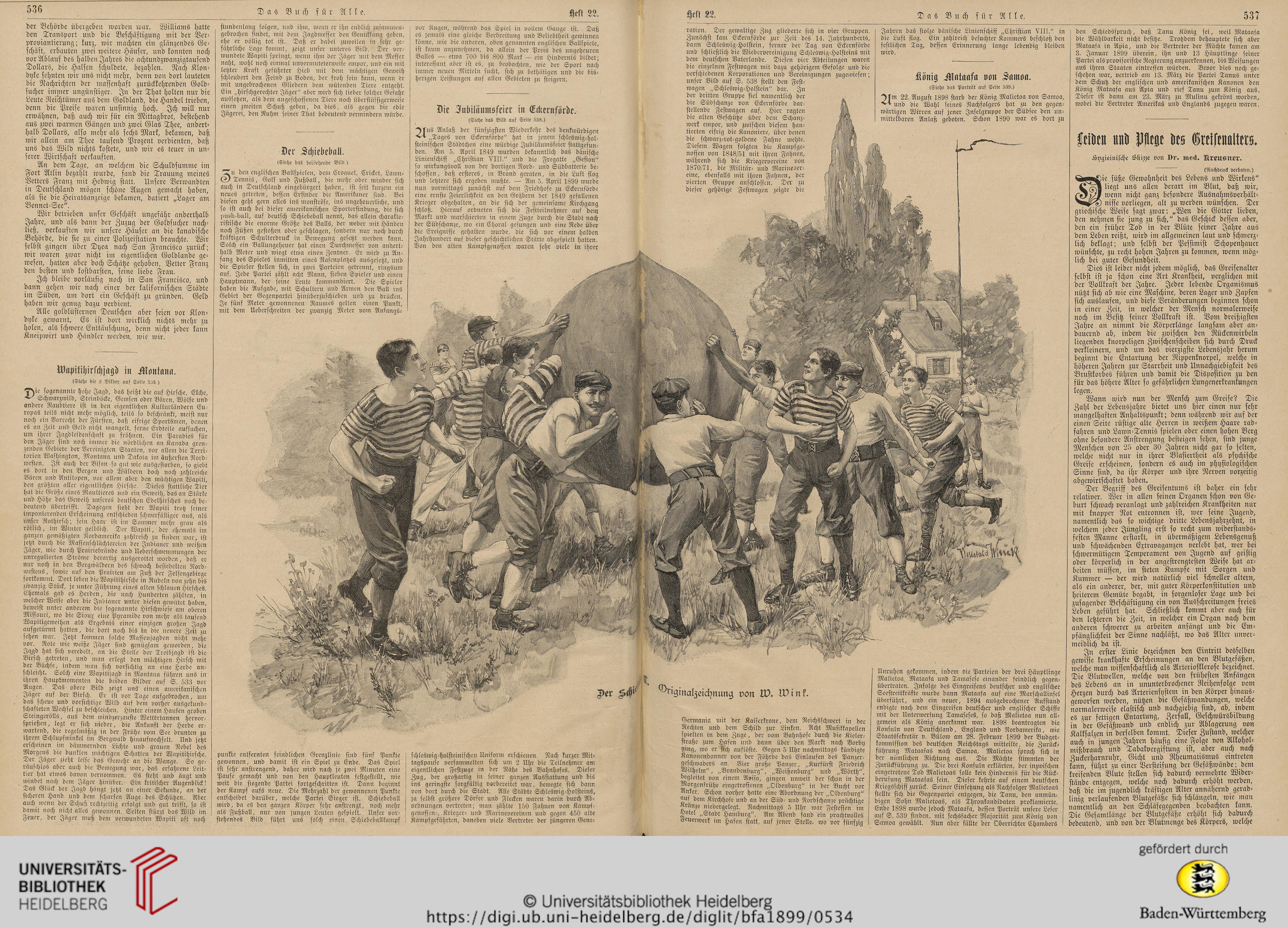536
Das Buch für A l k e.
Heft 22.
der Behörde übergeben worden war. Williams hatte
den Transport und die Beschäftigung mit der Ver-
proviantierung; kurz, wir machten ein glänzendes Ge-
schäft, erbauten zwei weitere Häuſer, und konnten noch
vor Ablauf des halben Jahres die achtundzwanzigtauſend
Dollars, die Halsſen ſchuldete, bezahlen. Nach Klon-
dyke sehnten wir uns nicht mehr, denn von dort lauteten
die Nachrichten der massenhaft zurückkehrenden Gold-
ſucher immer ungünstiger. In der That holten nur die
Leute Reichtümer aus dem Goldland, die Handel trieben,
denn die Preiſe waren unsinnig hoch. Ich will nur
erwähnen, daß auch wir für ein Mittagbrot, bestehend
aus zwei warmen Gängen und zwei Glas Thee, andert-
halb Dollars, alſo mehr als sechs Mark, bekamen, daß
wir allein am Thee tauſend Prozent verdienten, daß
uns das Wild nichts kostete, und wir es teuer in un-
serer Wirtſchaft verkauften.
An dem Tage, an welchem die Schuldſumme im
Fort Atlin bezahlt wurde, fand die Trauung meines
Vetters Franz mit Hedwig statt. Unsere Verwandten
in Deutſchland mögen ſchöne Augen gemacht haben,
als sie die Heiratsanzeige bekamen, datiert „Lager am
Bennet-See".
Wir betrieben unser Geschäft ungefähr anderthalb
Jahre, und als dann der Zuzug der Goldſucher nach-
ließ, verkauften wir unsere Häuſer an die kanadiſche
Behörde, die sie zu einer Polizeiſtation brauchte. Wir
ſelbſt gingen über Dyea nach San Francisco zurück;
wir waren zwar nicht im eigentlichen Goldlande ge-
wiesen, hatten aber doch Schätze gehoben, Vetter Franz
den beſten und kostbarſten, seine liebe Frau.
Ich bleibe vorläufig noch in San Francisco, und
dann gehen wir nach einer der kaliforniſchen Städte
im Süden, um dort ein Geschäft zu gründen. Geld
haben wir genug dazu verdient.
Alle goldlüsternen Deutschen aber seien vor Klon-
dyke gewarnt. Es ist dort wirklich nichts mehr zu
holen, als schwere Enttäuſchung, denn nicht jeder kann |
Kneipwirt und Händler werden, wie wir.
Wapitihirſchjagd in Montaa.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 533.) ;
D'! sogenannte hohe Jagd, das heißt die auf Hirsche, Elche,
Schwarzwild, Steinböcke, Gemsen oder Bären, Wölfe und
andere Raubtiere iſt in den eigentlichen Kulturländern Eu-
ropas teils nicht mehr möglich, teils so beſchränkt, meist nur
noch ein Vorrecht der Fürſten, daß eifrige Sportsmen, denen
es an Zeit und Geld nicht mangelt, ferne Erdteile aufsuchen,
um ihrer Jagdleidenſchaft zu fröhnen. Ein Paradies für
den Jäger sind noch immer die nördlichen an Kanada gren- |
zenden Gebiete der Vereinigten Staaten, vor allem die Terri- -
torien Washington, Montana und Dakota im äußersten Nord-
westen. Ist auch der Bison so gut wie ausgestorben, so giebt
es dort in den Bergen und Wäldern doch noch zahlreiche
_ Büren und Autilopen, vor allem aber den mächtigen Wapiti,
den größten aller eigentlichen Hirsche. Dieses stattliche Tier
hat die Größe eines Maultieres und ein Geweih, das an Stärke
und Höhe das Geweih unſseres deulſchen Edelhirſches noch be-
deutend übertrifft. Dagegen sieht der Wapiti trotz seiner
imponierenden Erscheinung entschieden ſchwerfälliger aus, als
unser Rothirſch; sein Haar iſt im Sommer mehr grau als
rötlich, im Winter gelblich. Der Wapiti, der ehemals im
ganzen gemäßigten Nordamerika zahlreich zu finden war, iſt
jetzt durch die Mas”senschlächtereien der Indianer und weißen
Jäger, wie durch Prairiebrände und Ueberſchwemmungen der
unregulierten Ströme derartig ausgerottet worden , daß er
nur noch in den Bergwäldern des ſchwach besiedelten Nord-
weſtens, sowie auf den Prairien am Fuß der Felsengebirge
fortkommt. Dort leben die Wapitihirſche in Rudeln von zehn bis
zwanzig Stück, je unter Führung eines alten schlauen Hirsches.
Chemals gab es Herden, die nach Hunderten zählten, in
welcher Weiſe aber die Indianer unter diesen gewütet haben,
beweist unter anderem die sogenannte Hirſchwieſe am oberen
Missouri, wo die Sioux eine Pyramide von mehr als tausend
Wapitigeweihen als Ergebnis einer einzigen großen Jagd
aufgetürmt hatten, die dort noch bis in die neuere geit zu
sehen war. Jett kommen solche Masſenjagden nicht mehr
vor. Rote wie weiße Jäger sind genügsam geworden, die
Jagd hat sich veredelt, an die Stelle der Treibjagd ist die
Birſch getreten, und man erlegt den mächtigen Hirſch mit
der Büchſe, indem man ſich vorsichtig an eine Herde an-
ſchleicht. Solch eine Wapitijagd in Montana führen uns in
ihren Hauptmomenten die beiden Bilder auf S. 533 vor
Augen. Das obere Bild zeigt uns einen amerikanischen
. Jäger auf der Birſch. Er ist vor Tage aufgebrochen, um
. das ſcheue und vorsſichtige Wild auf dem vorher ausgekund-
ſchafteten Wechsel zu beſchleichen. Hinter einem Haufen groben
Steingerölls, aus dem windzerzauste Wettertannen hervor-
ſprießen, legt er sich nieder, die Ankunft der Herde er-
wartend, die regelmäßig in der Frühe vom See drunten zu
ihrem Schlupfwinkel im Bergwald hinaufwechſelt. Und jetzt
erscheinen im dämmernden Lichte und . grauen Nebel des
Morgens die dunklen mächtigen Schatten der Wapitihirſche.
Der Jäger zieht leiſe das Gewehr an die Wange. So ge-
räuſchlos aber auch die Vewegung war, das erfahrene Leit-
tier hat etwas davon vernommen. Es steht und äugt und
_ windet nach dem Jäger hinüber. Ein kritischer Augenblick!
Das Glück der Jagd hängt jett an einer Sekunde, an der
ſicheren Hand und dem ſcharfen Auge des Schützen. Aber
auch wenn der Schuß rechtzeitig erfolgt und gut trifft, so ist
damit noch nicht alles gewonnen. Selten stürzt das Wild im
Feuer, der Jäger muß dem verwundeten Wapiti oft noch
stundenlang folgen, und ihm, wenn er ihn endlich zuſammen-
gebrochen findet, mit dem Jagdmesser den Genickfang geben,
ehe er völlig tot iſt. Daß er dabei zuweilen in ſehr ge-
fährliche Lage kommt, zeigt unser unteres Bild. Der ver-
wundete Wapiti springt, wenn ihm der Jäger mit dem Messer
naht, wohl noch einmal unvermuteterweise empor, und ein mit
letter Kraft geführter Hieb mit dem mächtigen Geweih
ſchleudert den Feind zu Boden, der froh sein kann, wenn er
mit ungebrochenen Gliedern dem wütenden Tiere entgeht.
Ein „hirschgerechter Jäger“ aber wird sich lieber solcher Gefahr
aussetzen, als dem angeschossenen Tiere noch überflüſsigerweise
einen zweiten Schuß geben, da dies, als gegen die edle
Jägerei, den Ruhm seiner That bedeutend vermindern würde.
Der Schiebeball.
(Siehe das beiſtehende Bild.)
S! den engliſchen Ballspielen, dem Croquet, Cricket, Lawn-
Tennis, Golf und Fußball, die mehr oder minder ſich
gauch in Deutſchland eingebürgert haben, ist seit kurzem ein
neues getreten, deſſen Erfinder die Amerikaner ſind. Bei
dieſen geht gern alles ins monströse, ins ungeheuerliche, und
ſo iſt auch bei dieser amerikanischen Sporterfindung, die ſich
push-ball, auf deutſch Schiebeball nennt, das allein charakte-
riſtiſche die enorme Größe des Balls, der weder mit Händen
noch Füßen gestoßen oder geschlagen, ſondern nur noch durch
kräftigen Schulterdruck in Bewegung gesetzt werden kann.
Solch ein Ballungeheuer hat einen Durchmesser von andert-
halb Meter und wiegt etwa einen Zentner. Er wird zu An-
fang des Spieles inmitten eines Rasenplatzes ausgesetzt, und
die Spieler stellen sich, in zwei Parteien getrennt, ringsum
auf. Jede Partei zählt acht Mann, sieben Spieler und einen
Hauptmann, der seine Leute kommandiert. Die Spieler
haben die Aufgabe, mit Schultern und Armen den Ball ins
Gebiet der Gegenpartei hinüberzuſchieben und zu drücken.
Je fünf Meter gewonnenen Raumes gelten einen Puntt,
mit dem Uebersſchreiten der zwanzig Meter vom Anfangs-
punkte entfernten feindlichen Grenzlinie sind fünf Punkte
gewonnen, und damit ist ein Spiel zu Ende. Das Spiel
iſt sehr anstrengend, daher wird nach je zwei Minuten eine
Pauſe gemacht und von den Hauptleuten festgestellt, wie
weit die ſiegende Partei fortgeschritten iſte. Dann beginnt
der Kampf aufs neue. Die Mehrzahl der gewonnenen Punkte
entscheidet darüber, welche Partei Sieger iſt. Schiebeball
wird, da es den ganzen Körper sehr anstrengt, noch mehr
als Fußball, nur von jungen Leuten gespielt. Unser vor-
stehendes Bild führt uns solch einen Schiebeballkampf
vor Augen, während das Spiel in vollem Gange ist. Daß
es jemals eine gleiche Verbreitung und Beliebtheit gewinnen
könne, wie die anderen, oben genannten engliſchen Ballspiele,
iſt kaum anzunehmen, da allein der Preis des ungeheuren
Balles ~ etwa 700 bis 800 Mark = ein Hindernis bildet;
intereſſant aber iſt es, zu beobachten, wie der Sport nach
immer neuen Mitteln sucht, sich zu bethätigen und die bis-
herigen Leiſtungen auf allen Gebieten zu steigern.
Die Iubiläumsfeier in Eckernförde.
(Siehe das Bild auf Seite 5389.
A. Anlaß der fünfzigsſten Wiederkehr des denkwürdigen
„Tages von Eckernförde" hat in jenem ſchleswig-hol-
ſteiniſchen Städtchen eine würdige Jubiläumsfeier stattgefun-
den. Am 5. April 1849 wurden bekanntlich das dänische
Linienschiff „Chriſtian VIU." und die Fregatte „Gefion“
so wirkungsvoll von der dortigen Nord- und Südbatterie be-
ſchoſſen, daß ersteres, in Brand geraten, in die Luft flog
und lettere sich ergeben mußte. – Anm 5. April 1899 wurde
nun vormittags zunächſt auf dem Friedhofe zu Eckernförde
eine ernste Feierlichkeit an den Gräbern der 1849 gefallenen
Krieger abgehalten, an die ſich der gemeinſame Kirchgang
schloß. Hierauf ordneten ſich die Feſstteilnehmer auf dem
Markt und marschierten in einem Zuge durch die Stadt nach
der Südſchanze, wo ein Choral geſungen und eine Rede über
die Ereigniſſe gehalten wurde, die ſich vor einem halben
Jahrhundert auf dieser geschichtlichen Stätte abgespielt hatten.
Von den alten Kampyfgenossen waren sehr viele in ihre
ſchleswig-holsteinischen Uniform erſchienen. Nach kurzer Mit-
tagspauſe verſammelten sich um 2 Uhr die Teilnehmer am
eigentlichen Festzuge in der Nähe des Bahnhofes. Dieser
Zug, der großartig in seiner ganzen Ausstattung und bis
ins geringste sorgfältig vorbereitet war, bewegte sich dann
von dort durch die Stadt. Alle Städte Schleswig-Holſteins,
ja selbſt größere Dörfer und Flecken waren darin durch Ab-
ordnungen vertreten; man zählte 150 Fahnen von Kampf-
G W w s : :
:; Ürczztii;
Heft 2L2.
ration. Der gewaltige Zug gliederte ſich in vier Gruppen.
Zunächst kam Eckernförde zur Zeit des 14. Jahrhunderts,
dann Schleswig-Holstein, ferner der Tag von Eckernförde
und ſchließlich die Wiedervereinigung Schleswig-Holsteins mit
dem deutſchen Vaterlande. Diesen vier Abteilungen warett
die einzelnen Feſtwagen mit dazu gehörigem Gefolge und die
verschiedenen Korporationen und Vereinigungen zugewiesen; |
unser Bild auf S. 538 stellt den Feſt-
wagen ,„Schleswig-Holstein“ dar. In
der dritten Gruppe fiel namentlich der : .;
die Südſchanze von Eckernförde dar- MI
stellende Festwagen auf. Hier ragten I
die alten Geschüte über dem Schanz-
werk empor, und zwiſchen diesem han-
tierten eifrig die Kanoniere, über denen
die ſschwarz-rot-goldene Fahne wehte.
Dieſem Wagen folgten die Kampfge-
noſſen von 1848/51 mit ihren Fahnen,
während ſich die Kriegervereine von
1870/71, die Militär- und Marinever-
eine, ebenfalls mit ihren Fahnen, der
vierten Gruppe anſchloſſen. Der zu
dieſer gehörige Feſtwagen zeigte die
I
ſ' Originalzeichnung von W. Winke.
Germania mit der Kaiserkrone, dem Reichsſchwert in dee
Rechten und dem Schild zur Linken. Acht Muiiktapellen
ſpielten in dem Zuge, der vom Bahnhofe durch die Kieler-
straße zum Hafen und dann über den Markt nach Borby
ging, wo er sich auflöste. Gegen 5 Uhr nachmittags kündigte
Kanonendonner von der Föhrde das Einlaufen des Panzer-
H —:125 ſucbtlts Ut; GUE Us
. 1! ?. 11 11 .
begleitet von einem Aviso, gingen unweit der schon in der
orgenfrühe eingetroffenen „Oldenburg“ in der Bucht vor
Anker. Schon vorher hatte eine Abordnung der „Oldenburg“
auf dem Kirchhofe und an der Süd- und Nordschanze prächtige
räanze niedergelegt. Nachmittags 5 Uhr war Feſteſſen im
Hotel „Stadt Hamburg“. Am Abend fand ein prachtvolles
euerwerk im Hafen statt, auf jener Stelle. wo vor fünfzig
Da s Buch für Alle.
Jahren das ſtolze däniſche Linienschiff „Christian VUI." in
die Luft flog. Cin zahlreich besuchter Kommers beschloß den
fcſuzhen Tag, dessen Erinnerung lange lebendig bleiben
König Mataafa von Samoa.
(Siehe das Porträt auf Seite 539.)
N 22. Auguſt 1898 starb der König Malietoa von Samoa,
und die Wahl seines Nachfolgers hat zu den gegen-
wärtigen Wirren auf jener Inselgruppe der Südsee den un-
mittelbaren Anlaß geboten. Schon 1890 war es dort zu
Unruhen gekommen, indem die Parteien der drei Häuptlinge
Malietoa, Mataafa und Tamaſsese einander feindlich gegen-
übertraten. Infolge des Eingreifens deutſcher und englischer
Seestreitkräfte wurde dann Mataafa auf eine Marschallinsel
überführt, und ein neuer, 1894 ausgebrochener Aufstand
endigte nach dem Cingreifen deutscher und englischer Schiffe
mit der Unterwerfung Tamaſeses, so daß Malietoa nun all-
gemein als König anerkannt war. 1898 beantragten die
Konsuln von Deutschland, England und Nordamerika, wie
Staatssekretär v. Bülow am 28. Februar 1899 der Budget-
kommission des deutschen Reichstags mitteilte, die Zurück-
führung Mataafas nach Samoa. Maltlietoa sprach sich in
der nämlichen Richtung aus. Die Mächte stimmten der
Zurückführung zu. Die drei Konsuln erklärten, der inzwischen
eingetretene Tod Malietoas solle kein Hindernis für die Rück-
berufung Mataafas sein. Dieser kehrte auf einem deutschen
Kriegsschiff zurück. Seiner Einsetzung als Nachfolger Malietoas
ſtellte sich die Gegenpartei entgegen, die Tanu, den unmün-
digen Sohn Malietoas, als Thronkandidaten proklamierte.
Ende 1898 wurde jedoch Mataafa, dessen Porträt unsere Leser
auf S. 539 finden, mit ſechsfacher Majorität zum König von
Samoa gewählt. Nun aber fällte der Oberrichter Chambers
537
den Schiedsſpruch, daß Tanu König sei, weil Mataafa
die Wählbarkeit nicht beſiße. Trotzdem behauptete sich aber
Mataafa in Apia, und die Vertreter der Mächte kamen am
3. Januar 1899 überein, ihn und 13 Häuptlinge seiner
Partei als proviſoriſche Regierung anzuerkennen, bis Weiſungen
aus ihren Staaten eintreffen würden. Bevor dies noch ge-
ſchehen war, vertrieb am 13. März die Partei Tanus unter
dem Schut;, der engliſchen und amerikaniſchen Kanonen den
König Mataafa aus Apia und rief Tanu zum König aus.
Dieser iſt dann am 283. März zu Mulinu gekrönt worden,
wobei die Vertreter Amerikas und Englands zugegen waren.
ſeiden und Pflege des Greiſenalters.
Hygieiniſche Skizze von Dr. med. Kreusner.
t (Nachdruck verboten.)
ie ſüße Gewohnheit des Lebens und Wirkens“
D: uns allen derart im Blut, daß wir,
wenn nicht ganz beſondere Ausnahmsverhält-
nisſe vorliegen, alt zu werden wünſchen. Der
griechische Weise sagt zwar: „Wen die Götter lieben,
den nehmen sie jung zu ſich, " das Geſchick deſſen aber,
den ein früher Tod in der Blüte seiner Jahre aus
dem Leben reißt, wird im allgemeinen laut und ſchmerz-
lich beklagt; und ſelbſt der Peſſimiſt Schopenhauer
wünſchte, zu recht hohen Jahren zu kommen, wenn mög-
lich bei guter Gesundheit. ;
Dies iſt leider nicht jedem möglich, das Greisenalter
selbst iſt ja ſchon eine Art Krankheit, verglichen mit
| der Vollkraft der Jahre. Jeder lebende Organismus
nützt ſich ab wie eine Maſchine, deren Lager und Zapfen
ſich auslaufen, und diese Veränderungen beginnen ſchon
in einer Zeit, in welcher der Mensch normalerweise
noch im Besitz seiner Vollkraft iſt. Vom dreißigsten
Jahre an nimmt die Körperlänge langſam aber an-
dauernd ab, indem die zwiſchen den Rückenwirbeln
liegenden knorpeligen Zwiſchenſcheiben sich durch Druck
verkleinern, und um das vierzigſte Lebensjahr herum
beginnt die Entartung der Rippenknorpel, welche in
höheren Jahren zur Starrheit und Unnachgiebigkeit des
Bruſtkorbes führen und damit die Dispoſition zu den
für das höhere Alter so gefährlichen Lungenerkrankungen
legen. j :
§ Wann wird nun der Menſch zum Greiſe? Die
Zahl der Lebensjahre bietet uns hier einen nur ſehr
mangelhaften Anhaltspunkt; denn während wir auf der
einen Seite rüſtige alte Herren in weißem Haare rad-
fahren und Lawn-Tennis spielen oder einen hohen Berg
ohne besondere Anstrengung besteigen sehen, sind junge
Menſchen von 25 oder 30 Jahren nicht gar so ſelten,
welche nicht nur in ihrer Blasiertheit als pſychiſche
Greise erſcheinen, sondern es auch im phyſiologiſchen
Sinne sind, da ihr Körper und ihre Nerven vorzeitig
abgewirtſchaftet haben. ; . ;
Der Begriff des Greiſentums ist daher ein sehr
relativer. Wer in allen seinen Organen ſchon von Ge-
burt schwach veranlagt und zahlreichen Krankheiten nur
mit knapper Not entronnen ist, wer seine Jugend,
namentlich das so wichtige dritte Lebensjahrzehnt, in
welchem jeder Jüngling erſt so recht zum widerstands-
feſten Manne erstarkt, in übermäßigem Lebensgenuß
und schwächenden Extravaganzen verlebt hat, wer bei
ſchwermütigem Temperament von Jugend auf geistig
oder körperlich in der angeſtrengteſten Weiſe hat ar-
beiten müſſen, im steten Kampfe mit Sorgen und
Kummer ~ der wird natürlich viel ſchneller altern,
als ein anderer, der, mit guter Körperkonstitution und
heiterem Gemüte begabt, in sorgenloſer Lage und be
zusagender Beſchäftigung ein von Ausschreitungen freies
Leben geführt hat. Schließlich kommt aber auch für
den letzteren die Zeit, in welcher ein Organ nach dem
anderen schwerer zu arbeiten anfängt und die Em-
pfänglichkeit der Sinne nachläßt, wo das Alter unver-
idlich da iſt.
Usti: t Linie bezeichnen den Eintritt desselben
geh! Lertacte suſhetnuuca qr t Muzl
Die Blutwellen, welche von den frühesten Anfängen
des Lebens an in ununterbrochener Reihenfolge vom
Herzen durch das Arterienſyſtem in den Körper hinaus-
geworfen werden, nützen die Gefäßwandungen, welche
normalerweiſe elaſtiſch und nachgiebig ſind, ab, indem
es zur fettigen Entartung, Zerfall, Geschwürsbildung
in der Gefäßwand und endlich zur Ablagerung von
Kalksalzen in derselben kommt. Dieser Zuſtand, welcher
auch in jungen Jahren häufig eine Folge von Alkohol-
mißbrauch und Tabakvergiftung iſt, aber auch nach
Zuckerharnruhr, Gicht und Rheumatismus eintreten
kann, führt zu einer Versteifung der Gefäßwände; dem
kreiſenden Blute stellen sich dadurch vermehrte Wider-
stände entgegen, welche noch dadurch erhöht werden,
daß die im jugendlich kräftigen Alter annähernd gerad-
linig verlaufenden Blutgefäße sich schlängeln, wie man
namentlich an den Schläfegegenden beobachten kann.
Die Gesamtlänge der Blutgefäße erhöht ſich dadurch
bedeutend, und von der Blutmenge des Körpers, welche