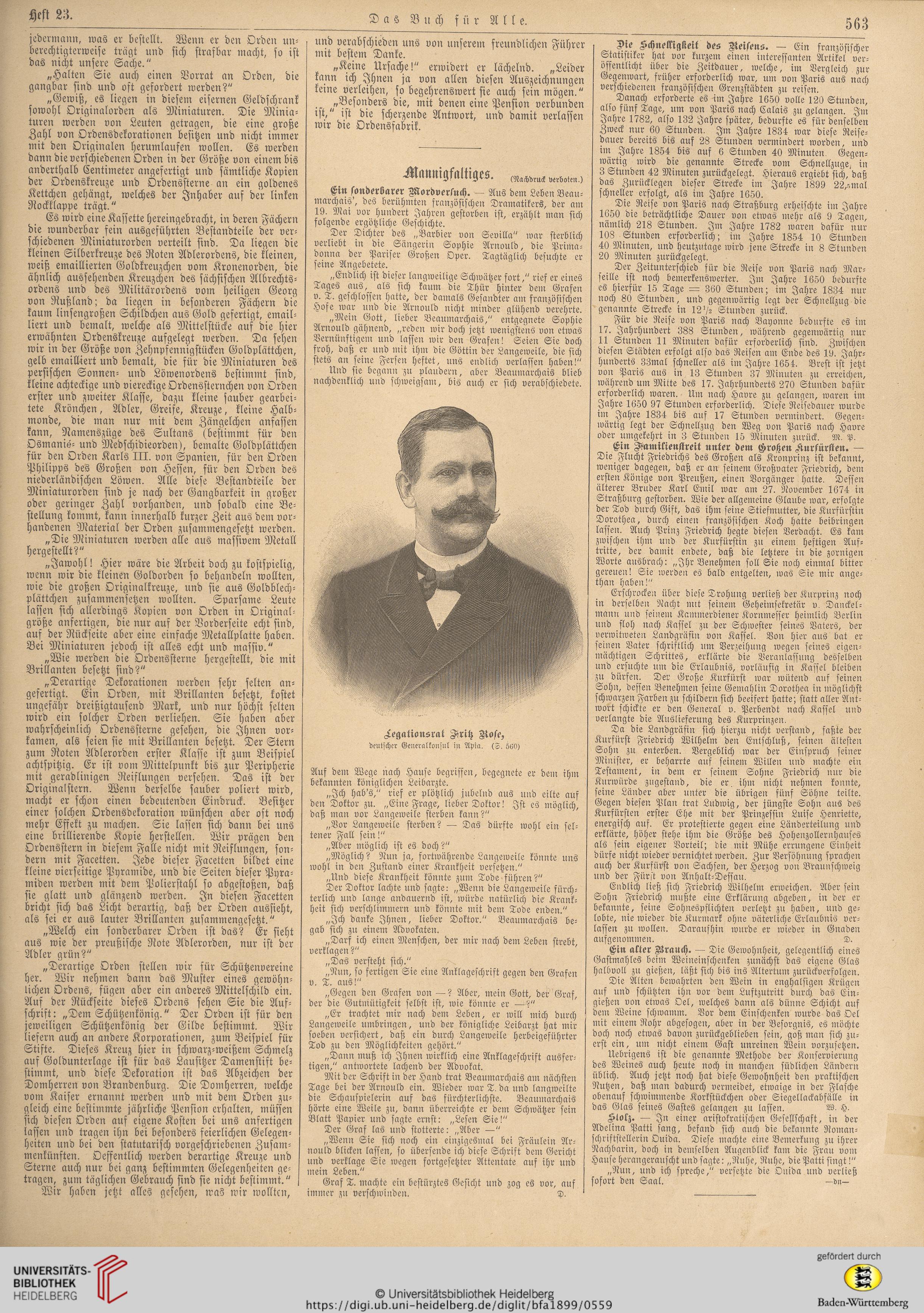Heft 23.
jedermann, was er bestelle Wenn er den Orden un-
berechtigterweiſe trägt und ſich strafbar macht, so ist
das nicht unsere Sache. “
„Halten Sie auch einen Vorrat an Orden, die
gangbar sind und oft gefordert werden?“
„Gewiß, es liegen in diesem eiſernen Geldſchrank
ſowohl Originalorden als Miniaturen. Die Minia-
turen werden von Leuten getragen, die eine große
Zahl von Ordensdekorationen besitzen und nicht immer
mit den Originalen herumlaufen wollen. Es werden
dann die verſchiedenen Orden in der Größe von einem bis
anderthalb Centimeter angefertigt und sämtliche Kopien
der Ordenskreuze und Ördenssterne an ein goldenes
Kettchen gehängt, welches der Inhaber auf der linken
Rockklappe trägt. “
Es wird eine Kaſſette hereingebracht, in deren Fächern
die wunderbar fein ausgeführten Bestandteile der ver-
schiedenen Miniaturorden verteilt sind. Da liegen die
kleinen Silberkreuze des Roten Adlerordens, die kleinen,
weiß emaillierten Goldkreuzchen vom Kronenorden, die
ähnlich aussehenden Kreuzchen des ſächſiſchen Albrechts-
ordens und des Militärordens vom heiligen Georg
von Rußland; da liegen in besonderen Fächern die
kaum linsengroßen Schildchen aus Gold gefertigt, email-
liert und bemalt, welche als Mittelstücke auf die hier
erwähnten Ordenskreuze aufgelegt werden. Da sehen
wir in der Größe von Zehnpfennigstücken Goldplättchen,
gelb emailliert und bemalt, die für die Miniaturen des
perſiſchen Sonnen- und Löwenordens bestimmt sind, |
kleine achteckige und viereckige Ordenssternchen von Orden
erſter und zweiter Klaſſe, dazu kleine ſauber gearbei-
tete Krönchen, Adler, Greife, Kreuze, kleine Halb-
monde, die man nur mit dem Zängelchen anfasſen
kann, Namenszüge des Sultans (beſtimmt für den
Osmanis- und Medſchidieorden), bemalte Goldplättchen
für den Orden Karls HI. von Spanien, für den Orden
Philipps des Großen von Heſſen, für den Orden des
niederländiſchen Löwen. Alle dieſe Beſtandteile der
Miniaturorden sind je nach der Gangbarkeit in großer
oder geringer Zahl vorhanden, und sobald eine Be-
ſtellung kommt, kann innerhalb kurzer Zeit aus dem vor-
handenen Material der Orden zuſammengesetzt werden.
h Die Miniaturen werden alle aus maſſivem Metall
ergeſtellt ?" ;
uche tc! Hier wäre die Arbeit doch zu kostſpielig,
wenn wir die kleinen Goldorden ſo behandeln wollten,
wie die großen Originalkreuze, und sie aus Goldblech-
plättchen zuſammenseßen wollten. Sparſame Leute
laſſen ſich allerdings Kopien von Orden in Original-
größe anfertigen, die nur auf der Vorderseite echt ſind,
j! Jr Rusteite aer eiue eines Metaltplatte haber.
„Wie werden die Ordensſterne hergestellt, die mit
Brillanten besetzt ſind ?"
„Derartige Dekorationen werden ſehr ſelten an-
gefertigt. Ein Orden, mit Brillanten besetzt, kostet
ht ra Rt. v pur ecſe ietten
wahrſcheinlich Ordenssterne geſehen, die Ihnen vor-
kamen, als seien sie mit Brillanten besetzt. Der Stern
zum Roten Adlerorden erster Klasse iſt zum Beispiel
achtſpitzig. Er iſt vom Mittelpunkt bis zur Peripherie
mit geradlinigen Reiflungen verſehen. Das iſt der
Originalſtern. Wenn derſelbe ſauber poliert wird,
macht er ſchon einen bedeutenden Eindruck. Besitzer
einer ſolchen Ordensdekoration wünſchen aber oft noch
mehr Effekt zu machen. Sie lassen sich dann bei uns
eine brillierende Kopie herſtellene. Wir prägen den
Ordensstern in dieſem Falle nicht mit Reiflungen, son-
dern mit Facetten. Jede dieſer Facetten bildet eine
kleine vierſeitige Pyramide, und die Seiten dieser Pyra-
miden werden mit dem Polierſtahl so abgeſtoßen, daß
sie glatt und glänzend werden. In diesen Facetten
bricht ſich das Licht derartig, daß der Orden aussieht,
als ſei er aus lauter Brillanten zuſammengesett. “
„Welch ein ſonderbarer Orden iſt das? Er ſieht
aus wie der preußiſche Rote Adlerorden, nur iſt der
p Adler grün?“
„Derartige Orden ſstellen wir für Schützenvereine
her. Wir nehmen dann das Muſter eines gewöhn-
lichen Ordens, fügen aber ein anderes Mittelſchild ein.
Auf der Rückseite dieses Ordens ſehen Sie die Auf-
schrift: „Dem Schützenkönig." Der Orden iſt für den
jeweiligen Schützenkönig der Gilde bestimmt. Wir
liefern auch an andere Korporationen, zum Beiſpiel für
Stifte. Dieses Kreuz hier in ſchwarz-weißem Schmelz
auf Goldunterlage iſt für das Lauſitzer Damenstift be-
stimmt, und diese Dekoration iſt das Abzeichen der
Domherren von Brandenburg. Die Domherren, welche
vom Kaiſer ernannt werden und mit dem Orden zu-
gleich eine beſtimmte jährliche Pension erhalten, müssen
ſich dieſen Orden auf eigene Kosten bei uns anfertigen
_ laſſen und tragen ihn bei besonders feierlichen Gelegen-
heiten und bei den ſtatutariſch vorgeſchriebenen Zuſam-
menkünften. Oeffentlich werden derartige Kreuze und
Sterne auch nur bei ganz beſtimmten Gelegenheiten ge-
tragen, zum täglichen Gebrauch ſind sie nicht beſtimmt. Ü
Wir haben jettt alles gesehen, was wir wollten,
Da s Buch für Alle.
und verabschieden uns von unſerem freundlichen Führer
mit bestem Dante.
„Keine Ursache!“ erwidert er lächelnd. ,Leider
kann ich Ihnen ja von allen diesen Auszeichnungen
keine verleihen, ſo begehrenswert sie auch ſein mögen."
.. „Besonders die, mit denen eine Pension verbunden
iſt, " iſt die ſcherzende Antwort, und damit verlassen
wir die Ordensfabrik.
Mannigfaltiges.
(Nachdruck verboten.)
Ein ſonderbarer Mordverſuch. - Aus dem Leben Beau-
marchais', des berühmten französischen Dramatikers, der am
19. Mai vor hundert Jahren gestorben iſt, erzählt man sich
folgende ergötliche Geschichte. :
Der Dichter des „Barbier von Sevilla“ war sterblich
verliebt in die Sängerin Sophie Arnould, die Prima-
donna der Pariser Großen Oper. Tagtäglich beſuchte er
seine Angebetete.
„Endlich iſt dieser langweilige Schwäher fort ," rief er eines
Tages aus, als sich kaum die Thür hinter dem Grafen
v. T. geſchloſſen hatte, der damals Gesandter am französischen
Hofe war und die Arnould nicht minder glühend verehrte.
„Mein Gott, lieber Beaumarchais," entgegnete Sophie
Arnould gähnend, „reden wir doch jet wenigstens von etwas
Vernünftigem und lassen wir den Grafen! Seien Sie doch
froh, daß er und mit ihm die Göttin der Langeweile, die ſich
ſtets an seine Fersen heftet, uns endlich verlaſſen haben!“
Und sie begann zu plaudern, aber Beaumarchais blieb
nachdenklich und ſchweigſam, bis auch er sich verabschiedete.
Legationsrat Fritz Roſe,
deutſcher Generalkonſul in Apia. (S. 560)
Auf dem Wege nach Hauſe begriffen, begegnete er dem ihm
bekannten königlichen Leibarzte. ;
„Ich hab's," rief er plözlich jubelnd aus und eilte auf
den Doktor zu. „Eine Frage, lieber Doktor! Ist es möglich,
daß man vor Langeweile sterben kann ?“
„Vor Langeweile sterben? ~ Das dürfte wohl ein sel-
tener Fall sein !" ;
„Aber möglich ist es doch ?"
„Möglich? Nun ja, fortwährende Langeweile könnte uns
wohl in den Zuſtand einer Krankheit verſeten."
„Und diese Krankheit könnte zum Tode führen ?"
Der Doktor lachte und sagte: „Wenn die Langeweile fürch-
terlich und lange andauernd ist, würde natürlich die Krank-
heit sich verschlimmern und könnte mit dem Tode enden."
„Ic< danke Ihnen, lieber Doktor." Beaumarchais be-
gab sich zu einem Advokaten.
„Darf ich einen Menschen, der mir nach dem Leben ſtrebt,
verklagen ?"
"Das verſteht ſich.'"
„Nun, so fertigen Sie eine Anklageschrift gegen den Grafen
v. T. aus!/
„Gegen den Grafen von ~ ? Aber, mein Gott, der Graf,
der die Gutniütigkeit selbst iſt, wie könnte er –~!Ú
„Er trachtet mir nach dem Leben, er will mich durch
Langeweile umbringen, und der königliche Leibarzt hat mir
ſoeben versichert, daß ein durch Langeweile herbeigeführter
Tod zu den Möglichkeiten gehört.“
„Dann muß ich Jhnen wirklich eine Anklageschrift ausfer-
tigen," antwortete lachend der Advokat.
Mit der Schrift in der Hand trat Beaumarchais am nächsten
Tage bei der Arnould ein. Wieder war T. da und langweilte
die Schauſpielerin auf das fürchterlichſte. Beaumarchais
hörte eine Weile zu, dann überreichte er dem Schwäher sein
Blatt Papier und sagte ernst: „Lesen Sie !"
Der Graf las und stotterte: „Aber –
„Wenn Sie sich noch ein einzigesmal bei Fräulein Ar-
nould blicken laſſen, so übersende ich diese Schrift dem Gericht
und vyUtsst Sie wegen fortgesetzter Attentate auf ihr und
mein Leben.'
Graf T. machte ein bestürztes Gesicht und zog es vor, auf
immer zu verschwinden. D.
563
Die Hchnelliglkeit des Reiſens. – Ein französischer
Statistiker hat vor kurzem einen intereſſanten Artikel ver-
öffentlicht über die Zeitdauer, welche, im Vergleich zur
Gegenwart, früher erforderlich war, um von Paris aus nach
verſchiedenen französischen Grenzstädten zu reisen.
Danach erforderte es im Jahre 1650 volle 120 Stunden,
alſo fünf Tage, um von Paris nach Calais zu gelangen. Im
Jahre 1782, also 182 Jahre später, bedurfte es für denselben
Zweck nur 60 Stunden. Im Jahre 1834 war diese Reise-
dauer bereits bis auf 28 Stunden vermindert worden, und
im Jahre 1854 bis auf 6 Stunden 40 Minuten. Gegen-
wärtig wird die genannte Strecke vom Schnellzuge, in
3 Stunden 42 Minuten zurückgelegt. Hieraus ergiebt ſich, daß
das Zurücklegen dieser Strecke im Jahre 1899 22,,mal
ſchneller erfolgt, als im Jahre 1650.
Die Reise von Paris nach Straßburg erheiſchte im Jahre
1650 die beträchtliche Dauer von etwas mehr als 9 Tagen,
nämlich 218 Stunden. Im Jahre 1782 waren dafür nur
108 Stunden erforderlich; im Jahre 1854 10 Stunden
40 Minuten, und heutzutage wird jene Strecke in 8 Stunden
20 Minuten zurückgelegt.
Der Zeitunterschied für die Reiſe von Paris nach Mar-
ſeille iſt noch bemerkenswerter. Im Jahre 1650 bedurfte
es hierfür 15 Tage = 860 Stunden; im Jahre 1834 nur
noch 80 Stunden, und gegenwärtig legt der Schnellzug die
genannte Strecke in 12!/2 Stunden zurück.
Für die Reiſe von Paris nach Bayonne bedurfte es im
17. Jahrhundert 388 Stunden, während gegenwärtig nur
11 Stunden 11 Minuten dafür erforderlich ſind. Zwischen
dieſen Städten erfolgt alſo das Reisen am Ende des 19. Jahr-
hunderts 33mal schneller als im Jahre 1654. Breſt ist jetzt
von Paris aus in 183 Stunden 37 Minuten zu erreichen,
während um Mitte des 17. Jahrhunderts 270 Stunden dafür
erforderlich waren. Um nach Havre zu gelangen, waren im
Jahre 1650 97 Stunden erforderlich. Dieſe Reiſedauer wurde
im Jahre 1834 bis auf 17 Stunden vermindert. Gegen-
wärtig legt der Schnellzug den Weg von Paris nach Havre
oder umgekehrt in 3 Stunden 15 Minuten zurück. M. P.
Ein Iiamilkienſtreit unter dem Großen Kurfürſten. +
Die Flucht Friedrichs des Großen als Kronprinz iſt bekannt,
weniger dagegen, daß er an seinem Großvater Friedrich, dem
erſten Könige von Preußen, einen Vorgänger hatte. Desſen
älterer Bruder Karl Emil war am 27. November 1674 in
Straßburg gestorben. Wie der allgemeine Glaube war, erfolgte
der Tod durch Gift, das ihm seine Stiefmutter, die Kurfürſtin
Dorothea, durch einen französischen Koch hatte beibrinken
laſſen. Auch Prinz Friedrich hegte diesen Verdacht. Es kam
zwiſchen ihm und der Kurfürſtin zu einem heftigen Auf-
tritte, der damit endete, daß die letztere in die zornigen
Worte ausbrach: „Jhr Benehmen Foll Sie noch einmal bitter
tenen! Sie werden es bald entgelten, was Sie mir ange-
an haben!
f Erſchrocken über diese Drohung verließ der Kurprinz noch
in derſelben Nacht mit seinem Geheimſekretär v. Danckel-
mann und seinem Kammerdiener Kornmesser heimlich Berlin
; | und floh nach Kassel zu der Schwester seines Vaters, der
. | verwitweten Landgräfin von Kassel. Von hier aus bat er
seinen Vater ſchriftlich um Verzeihung wegen ſeines eigen-
* | mächtigen Schrittes, erklärte die Veranlaſſung desselben
und erſuchte um die Erlaubnis, vorläufig in Kasſel bleiben
zu dürfen. Der Große Kurfürſt war wütend auf ſeinen
Sohn, dessen Benehmen seine Gemahlin Dorothea in möglichst
ſchwarzen Farben zu schildern sich beeifert hatte; statt aller Ant-
wort ſchickte er den General v. Perbendt nach Kaſſel unn
verlangte die Auslieferung des Kurprinzen.
Da die Landgräfin sich hierzu nicht verſtand, faßte der
Kurfürſt Friedrich Wilhelm den Entſchluß, seinen ältesten
Sohn zu enterben. Vergeblich war der Einspruch seiner
Minister, er beharrte auf seinem Willen und machte ein
Teſtament, in dem er seinem Sohne Friedrich nur die
| Kurwürde zugeſtand, die er. ihm nicht nehmen konnte,
seine Länder aber unter die übrigen fünf Söhne teilte.
Gegen diesen Plan trat Ludwig, der jüngste Sohn aus des
Kurfürsten erſter Ehe mit der Prinzesſin Luise Henriette,
energiſch auf. Er protestierte gegen eine Länderteilung und
erklärte, höher stehe ihm die Größe des Hohenzollernhauſes
als sein eigener Vorteil; die mit Mühe errungene Einheit
dürfe nicht wieder vernichtet werden. Zur Versöhnung sprachen
auch der Kurfürſt von Sachſen, der Herzog von Braunſchweig
und der Fürſt von Anhalt-Dessau. :
Endlich ließ ſich Friedrich Wilhelm erweichen. Aber sein
Sohn Friedrich mußte eine Erklärung abgeben, in der er
bekannte, seine Sohnespflichten verlezt zu haben, und ge-
lobte, nie wieder die Kurmark ohne väterliche Erlaubnis ver-
laſſen zu wollen. Daraufhin wurde er wieder in Gnaden
aufgenommen. D.
Ein alter Brauch. — Die Gewohnheit, gelegentlich eines
Gastmahles beim Weineinſchenken zunächst das eigene Glas
halbvoll zu gießen, läßt sich bis ins Altertum zurückverfolgen.
Die Alten bewahrten den Wein in enghalſigen Krügen
auf und schütten ihn vor dem Luftzutritt durch das Ein-
gießen von etwas Del, welches dann als dünne Schicht auf
dem Weine ſchvamm. Vor dem Einſschenken wurde das Oel
mit einem Rohr abgesogen, aber in der Besorgnis, es möchte
doch noch etwas davon zurückgeblieben sein, goß man ſich zu-
erſt ein, um nicht einem Gast unreinen Wein vorzuſetgen.
Uebrigens ist die genannte Methode der Konservierung
des Weines auch heute noch in manchen südlichen Ländern
üblich. Auch jett noch hat diese Gewohnheit den praktischen
Nuyten, daß man dadurch vermeidet, etwaige in der Flaſche
obenauf schwimmende Korkstückchen oder Siegellackabfälle in
das Glas seines Gaſtes gelangen zu lassen. W. H.
Hlolz. + In einer ariſtokratiſchen Gesellschaft, in der
Adelina Patti sang, befand sich auch die bekannte Roman-
ſchriftſtellerin Ouida. Diese machte eine Bemerkung zu ihrer
Nachbarin, doch in demselben Augenblick kam die Frau vom
Hauſe herangerauſcht und sagte: „Ruhe, Ruhe, die Patti singt !“
„Nun, und ich spreche,“ versetzte die Ouida und verließ
sofort den Saal. ~–dn~