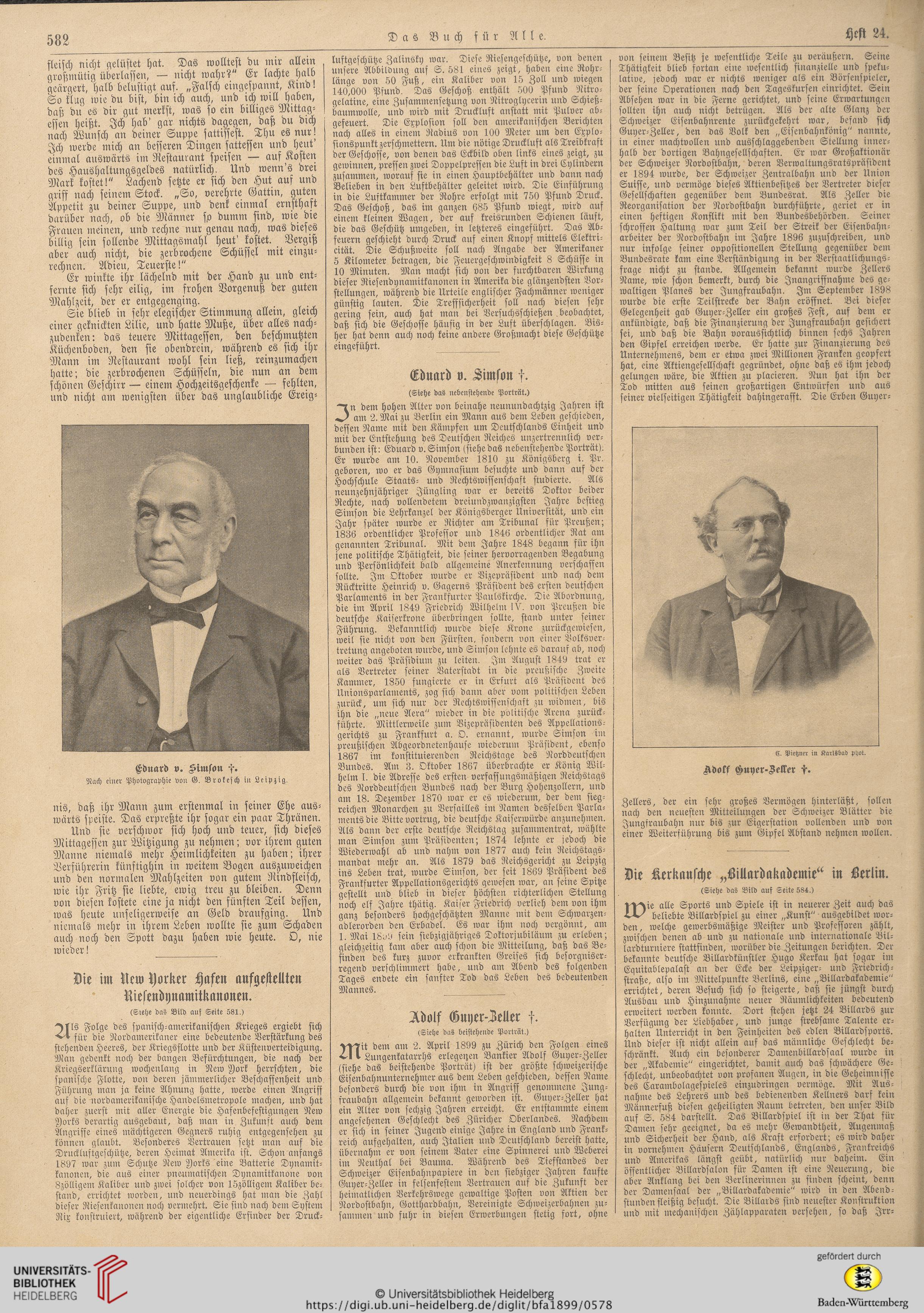562
fleiſch nicht gelüſtet hat. Das wolltest du mir allein
großmütig überlaſſen, ~ nicht wahr?“ Er lachte halb
Uster att selzttet ut. hals auyezit uu
daß pu es dir gut merkst, was ſo ein billiges Mittag-
eſſen heißt. Ich hab' gar nichts dagegen, daß du dich
nach Wunſch an deiner Suppe ſattiſſeſt. Thu es nur!
Ich werde mich an besſſeren Dingen ſattesſſen und heut'
einmal auswärts im Restaurant speiſen ~ auf Koſten
des Haushaltungsgeldes natürlich. Und wenn's drei
Mark koſtet!“ LPachend setzte er sich den Hut auf und
griff nach ſeinem Stock. „So, verehrte Gattin, guten
Yypetit zu deiner Suppe, und denk einmal ernſthaft
darüber nach, ob die Männer ſo dumm ſind, wie die
Frauen meinen, und rechne nur genau nach, was dieſes
billig sein ſollende Mittagsmahl heut' koſtet. Vergiß
aber auch nicht, die zerbrochene Schüſſel mit einzu-
rechnen. Adieu, Teuerſte !“ ;
Er winkte ihr lächelnd mit der Hand zu und ent-
fernte ſich sehr eilig, im frohen Vorgenuß der guten
Mahlzeit, der er entgegenging.
Sie blieb in sehr elegiſcher Stimmung allein, gleich
einer geknickten Lilie, und hatte Muße, über alles nach-
zudenken: das teuere Mittageſſen, den beſchmutzten
Küchenboden, den sie obendrein, während es sich ihr
Mann im Reſtaurant wohl sein ließ, reinzumachen
hatte; die zerbrochenen Schüſſeln, die nun an dem
ſchönen Geschirr ~ einem Hochzeitsgeſchenke + fehlten,
und nicht am wenigsten über das unglaubliche Ereig-
Eduard v. Himſon +-.
Nach einer Photographie von G. Brokeſch in Leipzig.
nis, daß ihr Mann zum erstenmal in seiner Ehe aus-
; wärts ſpeiſle. Das erpreßte ihr ſogar ein paar Thränen.
Und ſie verſchwor ſich hoch und teuer, ſich dieſes
Mittageſſen zur Witzigung zu nehmen; vor ihrem guten
Manne niemals mehr Heimlichkeiten zu haben; ihrer
Verführerin künftighin in weitem Bogen auszuweichen
und den normalen Mahlzeiten von gutem Rindfleiſch,
wie ihr Fritz sie liebte, ewig treu zu bleiben. Denn
von dieſen kostete eine ja nicht den fünften Teil deſſen,
was heute unſeligerweiſe an Geld draufging. Und
niemals mehr in ihrem Leben wollte ſie zum Schaden
uch nech den Spott dazu haben wie heute. O, nie
wieder! ]
Die im New Yorker Hafen aufgeſtellten
Riesendynamitkanonen.
. (Stehe das Bild auf Seite 581.)
M. Folge des ſpaniſch-amerikaniſchen Krieges ergiebt ſich
für die Nordamerikaner eine bedeutende Verstärkung des
stehenden Heeres, der Kriegsflotte und der Küſtenverteidigung.
î Man gedenkt noch der bangen Befürchtungen, die nach der
Kriegserklärung wochenlang in New York herrſchten, die
spanische Flotte, von deren jämmerlicher Beſchaffenheit und.
Führung man ja keine Ahnung hatte, werde einen Angriff
auf die nordamerikaniſche Handelsmetropole machen, und hat
daher zuerſt mit aller Energie die Hafenbefestigungen New
Yorks derartig ausgebaut, daß man in. Zukunſt auch dem
_ Angriffe eines mächtigeren Gegners ruhig entgegensehen zu
können glaubt. Besonderes Vertrauen setzt man auf die
Druckluftgeſchüte, deren Heimat Amerika iſt. Schon anfangs
. 1897 war zum Schutze New Yorks eine Batterie Dynamit-
kanonen, die aus einer pneumatiſchen Dynamitkanone von
8zölligem Kaliber und zwei ſolcher von Iszölligem Kaliber be-
stand, errichtet worden, und neuerdings hat man die Zahl
dieser Rieſenkanonen noch vermehrt. Sie sind nach dem Syſtem
Rix konſtruiert, während der eigentliche Erfinder der Druck-
Da s B uch f ür All e.
luftgeſchüte Zalinsky war. Diese Rieſengeſchütte, von denen
unsere Abbildung auf S. 581 eines zeigt, haben eine Rohr-
länge von 50 Fuß, ein Kaliber von 15 Zoll und wiegen
140,000 Pfund. Das Geschoß enthält 500 Pfund Nitro-
gelatine, eine Zuſammensetung von Nitroglycerin und Schieß-
baumwolle, und wird mit Druckluft anstatt mit Pulver ab-
gefeuert. Die Explosion soll den amerikanischen Berichten
nach alles in einem Radius von 100 Meter um den Explo-
sionspunkt zerſchmettern. Um die nötige Druckluft als Treibkraft
der Geſchoſſe, von denen das Eckbild oben links eines zeigt, zu
gewinnen, preſſen zwei Doppelpressen die Luft in drei Cylindern
jg reti h fuer huuytechulter att rut.
in die Luftkammer der Rohre erfolgt mit 750 Pfund Druck.
Das Geschoß, das im ganzen 685 Pfund wiegt, wird auf
einem kleinen Wagen, der auf kreisrunden Schienen läuft,
die das Geschüt, umgeben, in letteres eingeführt. Das Ab-
feuern geschieht durch Druck auf einen Knopf mittels Clektri-
cität. Die Schußweite soll nach Angabe der Amerikaner
5 Kilometer betragen, die Feuergeſchwindigkeit 8 Schüsse in
10 Minuten. Man macht ſich von der furchtbaren Wirkung
dieser Rieſendynamitkanonen in Amerika die glänzendsten Vor-
stellungen, während die Urteile engliſcher Fachmänner weniger
günstig lauten. Die Treffsicherheit soll nach diesen ſehr
gering ſein, auch hat man bei Verſuchsſchießen . beobachtet,
daß sich die Geſchoſſe häufig in der Luft überſchlagen. Bis-
her hal sen auch noch keine andere Großmacht dieſe Geſchütze
Eduard v. Simſon f.
(Siehe das nebenstehende Porträt.)
I!: dem hohen Alter von beinahe neunundachtzig Jahren iſt
am 2. Mai zu Berlin ein Mann aus dem Leben geschieden,
dessen Name mit den Kämpfen um Deutschlands Einheit und
mit der Entſtehung des Deutschen Reiches unzertrennlich ver-
bunden iſt: Eduard v. Simſon (siehe das nebenſtehende Porträt).
Er wurde am 10. November 1810 zu Königsberg i. Pr.
geboren, wo er das Gymnasium besuchte und dann auf der
Hochſchule Staats- und Rechtswissenſchaft studierte. Als
| | neunzehnjähriger Jüngling war er bereits Doktor beider
| | Rechte, nah vollendetem dreiundzwanzigsten Jahre bestieg
Simson die Lehrkanzel der Königsberger Universität, und ein
Jahr später wurde er Richter am Tribunal für Preußen;
1886 ordentlicher Profesſor und 1846 ordentlicher Rat am
genannten Tribunal. Mit dem Jahre 1848 begann für ihn
jene politiſche Thätigkeit, die ſeiner hervorragenden Begabung
und Persönlichkeit bald allgemeine Anerkennung verschaffen
sollte. Im Oktober wurde er Vizepräsident und nach dem
| | Rücktritte Heinrich v. Gagerns Präsident des erſten deutschen
Parlaments in der Frankfurter Paulskirche. Die Abordnung,
die im April 1849 Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die
deutsche Kaiserkrone überbringen ſollte, stand unter seiner
Führung. Bekanntlich wurde dieſe Krone zurückgewiesen,
weil sie nicht von den Fürsten, sondern von einer Volksver-
tretung angeboten wurde, und Simson lehnte es darauf ab, noch
weiter das Präsidium zu leiten. Im Auguſt 1849 trat er
als Vertreter seiner Vaterſtadt in die preußiſche Zweite
Kammer, 1850 fungierte er in Erfurt als Präsident des |
Unionsparlaments, zog ſich dann aber vom politiſchen Leben
zurück, um sich nur der Rechtswissenſchaft zu widmen, bis
ihn die „neue Aera“ wieder in die politiſche Arena zurück-
führte. Mittlerweile zum Vizepräsidenten des Appellations:
gerichts zu Frankfurt a. O. ernannt, wurde Simson im
preußischen Abgeordnetenhauſe wiederum Präsident, ebenso
1867 im konstituierenden Reichstage des Norddeutſchen
Bundes. Am 3. Oktober 1867 überbrachte er König Wil-
helm I. die Adresse des ersten verfaſſungsmäßigen Reichstags
des Norddeutſchen Bundes nach der Burg Hohenzollern, und
am 18. Dezember 1870 war er es wiederum, der dem ſieg-
reichen Monarchen zu Versailles im Namen desſelben Parla-
ments die Bitte vortrug, die deutſche Kaiſerwürde anzunehmen.
Als dann der erste deutsche Reichstag zuſammentrat, wählte
man Simson zum Präſidenten; 1874 lehnte er jedoch die
Wiederwahl ab und nahm von 1877 auch kein Reichstags-
mandat mehr an. Als 1879 das Reichsgericht zu Leipzig
ins Leben trat, wurde Simson, der seit 1869 Präsident des
Frankfurter Appellationsgerichts geweſen war, an seine Spitze
gestellt und. blieb in dieser höchſten richterlichen Stellung |.
noch elf Jahre thätig. Kaiſer Friedrich verlieh dem von ihm
ganz besonders hochgeſchätten Manne mit dem Schwarzen-
adlerorden den Erbadel. Es war ihm noch vergönnt, am
1. Mai 18wu sein ſsiebzigjähriges Doktorjubiläum zu erleben;
gleichzeitig kam aber auch schon die Mitteilung, daß das Be-
Yves sss rats urer qzreautn Grales f. vrtjoustiten.
Tage: uveie ein sanfter Tod das Leben des . G geuren
annes. : ?
Adolf Guyer-Zeller f.
; (Siehe das beiſtehende Porträt.)
M) dem am 2. April 1899 zu Zürich den Folgen eines
Lungenkatarrhs erlegenen Bankier Adolf Guyer-Zeller
(siehe das beiſtehende Porträt) iſt der größte ſchweizeriſche
Eiſsenbahnunternehmer aus dem Leben geschieden, deſſen Name
besonders durch die von ihm in Angriff genommene Jung-
fraubahn allgemein bekannt geworden iſt. Guyer-Zeller hat
ein Alter von sechzig Jahren erreicht. Er entſtammte einem
angesehenen Geschlecht des Züricher Oberlandes. Nachdem
er sich in seiner Jugend einige Jahre in England und Frank-
reich aufgehalten, auch Italien und Deutschland bereist hatte,
übernahm er von seinem Vater eine Spinnerei und Weberei
im Neuthal bei Bauma. Während des Tiefstandes der
Schweizer Eiſenbahnpapiere in den siebziger Jahren kaufte
Guyer-Zeller in felſenfeſtem Vertrauen auf die Zukunft der
heimatlichen Verkehrswege gewaltige Posten von Aktien der
Nordoſtbahn, Gotthardbahn, Vereinigte Schweizerbahnen zu-
ſammen und fuhr in dieſen Erwerbungen stetig fort, ohne
Heft 22n’
von seinem Besitz je wesentliche Teile zu veräußern. Seine
Thätigkeit blieb fortan eine wesentlich finanzielle und ſpeku-
lative, jedoch war er nichts weniger als ein Börsenſpieler,
der seine Operationen nach den Tageskursen einrichtet. Sein
Absehen war in die Ferne gerichtet, und seine Erwartungen
sollten ihn auch nicht betrügen. Als der alte Glanz der
Schweizer Eiſenbahnrente zurückgekehrt war, befand ſich
Guyer-Zeller, den das Volk den ,Ciſenbahnkönig“ nannte,
in einer machtvollen und ausſchlaggebenden Stellung inner-
halb der dortigen Bahngesellſchaften. Er war Großaktionär
der Schweizer Nordoſtbahn, deren Verwaltungsratspräſsident
er 1894 wurde, der Schweizer Zentralbahn und der Union
Suisse, und vermöge dieses Aktienbeſitzes der Vertreter dieser
Gesellſchaften gegenüber dem Bundesrat. Als Zeller die
Reorganisation der Nordoſtbahn durchführte, geriet er in
einen heftigen Konflikt mit den Bundesbehörden. Seiner
schroffen Haltung war zum Teil der Streik der Eiſenbahn-
arbeiter der Nordoſtbahn im Jahre 1896 zuzuſchreiben, und
H H VE W s
frage nicht zu stande. Allgemein bekannt wurde Zellers
Name, wie schon bemerkt, durch die Jnangriffnahme des ge-
waltigen Planes der Jungfraubahn. Im September 1898
wurde die erſte Teilstrecke der Bahn eröffnet. Bei dieſer
Gelegenheit gab Guyer-Zeller ein großes Fest, auf dem er
ankündigte, daß die Finanzierung der Jungfraubahn gesichert
sei, und daß die Bahn voraussichtlich binnen sechs Jahren
den Gipfel erreichen werde. Er hatte zur Finanzierung des
Unternehmens, dem er etwa zwei Millionen Franken geopfert
| hat, eine Aktiengesellſchaft gegründet, ohne daß es ihm jedoch /
gelungen wäre, die Aktien zu placieren. Nun hat ihn d'e.
Tod mitten aus seinen großartigen Entwürfen und aus
seiner vielseitigen Thätigkeit dahingerafft. Die Erben Guter.
C. Pietzner in Karlsbad pg
Adolf Guyer-Zeller +.
Zellers, der ein sehr großes Vermögen hinterläßt, ſollen
nach den neuesten Mitteilungen der Schweizer Blätter de. '
Jungfraubahn nur bis zur Eigerſtation vollenden und von
einer Weiterführung bis zum Gipfel Abstand nehmen wollen.
Die Kerkauſche „Billardakademie“ in Berlin.
(Siehe das Bild auf Seite 584.1) : !
W to syp!ts ; qu Spiele iſt in neuerer Zeit auch has
eliebte Billardspiel zu einer „Kunst“ ausgebildet wor-
den, welche gewerbsmäßige Meister und Professoren zählt,
zwischen denen ab und zu nationale und internationale Bil-
lardturniere stattfinden, worüber die Zeitungen berichten. De 1
bekannte deutsche Billardkünstler Hugo Kerkau hat sogar im
Equitablepalaſt an der Ecke der Leipziger- und Friedrich-
straße, alſo im Mittelpunkte Berlins, eine „Billardakademie“
errichtet, deren Besuch sich ſo steigerte, daß sie jüngst durch
Ausbau und Hinzunahme neuer Räumlichkeiten bedeutend
erweitert werden konnte. Dort stehen jetßt 24 Billards zur
Verfügung der Liebhaber, und junge ſstrebſame Talente er-
haiten Unterricht in den Feinheiten des edlen Billardſports. J
Und dieser iſt nicht allein auf das männliche Geschlecht be-
schränkt. Auch ein besonderer Damenbillardſaal wunre im
der „Akademie“ eingerichtet, damit auch das schwächere Ge.
schlecht, unbeobachtet von profanen Augen, in die Geheimnis.
des Carambolagespieles einzudringen vermösge. Mit Aus.
nahme des Lehrers und des bedienenden Kellners darf kein
Männerfuß diesen geheiligten Raum betreten, den unser Bild
auf S. 584 darstellt. Das Billardſpiel iſt in der That für
Damen sehr geeignet, da es mehr Gewandtheit, Augenmaß
und Sicherheit der Hand, als Kraft erfordert; es wird daher .
in vornehmen Häusern Deutſchlands, Englands, Frankreichs
und Amerikas längst geübt, natürlich nur daheim. Ein .
öffentlicher Billardſalon für Damen ist eine Neuerung, die_ .
aber Anklang bei den Berlinerinnen zu finden ſcheint, denn
der Damensaal der ,„Billardakademie“" wird in den Abend-
stunden fleißig besucht. Die Billards sind neuester Konstruktion
und mit mechaniſchen Zählapparaten versehen, so daß Irr-