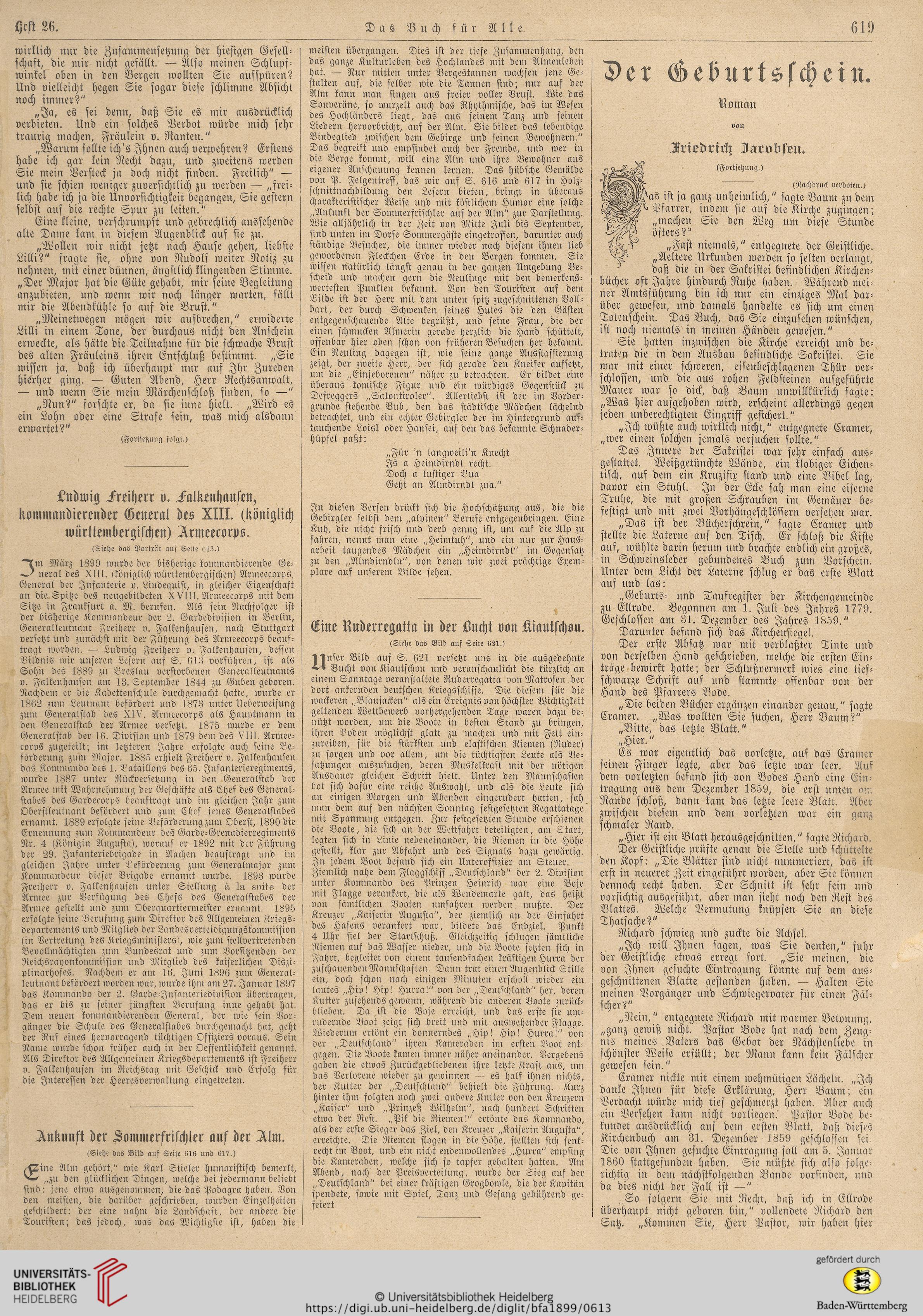Sie mein Versteck ja doch nicht finden.
und ſie ſchien weniger zuversichtlich zu werden ~ „frei-
mir die Abendkühle so auf die Bruſt.“
Heft 26.
D a s Bu ch für Alle. .
wirklich nur die Zuſammenſetzung der hiesigen Gefsell-
ſchaft, die mir nicht gefällt. ~ Also meinen Schlupf-
winkel oben in den Bergen wollten Sie aufspüren?
Und h:clleicht. hegen Sie ſogar dieſe ſchlimme Abhſicht
“tts r sei denn, daß Sie es mir ausdrücklich
verbieten. Und ein solches Verbot würde mich ſehr
traurig machen, Fräulein v. Ranten. “ :
J„Warum Jollte ich s Ihnen auch verwehren? Erſtens
habe ich gar kein Recht dazu, und hvcitent wekven
lich habe ich ja die Unvorsichtigkeit begangen, Sie gestern
elbſt auf die rechte Spur zu leiten.“
Eine kleine, verſchrumpſt und gebrechlich aussehende
alte Dame kam in dieſem Augenblick auf sie zu.
„Wollen wir nicht jetzt nach Hauſe gehen, liebſte
Lilli?“ fragte sie, ohne von Rudolf weiter Notiz zu
nehmen, mit einer dünnen, ängstlich klingenden Stimme.
„Der Major hat die Güte gehabt, mir seine Begleitung
anzubieten, und wenn wir noch länger warten, fällt
„Meinetwegen mögen wir aufbrechen,“ erwiderte
Lilli in einem Tone, der durchaus nicht den Anſchein
erweckte, als hätte die Teilnahme für die ſchwache Bruſt
des alten Fräuleins ihren Entſchluß beſtimmt. „Sie
wiſſen ja, daß ich überhaupt nur auf Ihr Zureden
hierher ging. – Guten Abend, Herr Rechtsanwalt,
~ und wenn Sie mein Märchenſchloß finden, ſo ~
„Nun?" forſchte er, da sie inne hielt. „Wird es
ein Lohn oder eine Strafe sein, was mich alsdann
erwartet ?" ; L
: ? . C(Fortſeugung folgt.)
Ludwig Freiherr v. Falkenhauſen,
kommandierender General des XII. (königlich
württembergiſchen) Armeecorps.
(Siehe das Porträt auf Seite 613.)
m März 1899 wurde der bisherige kommandierende Ge-:
neral des XIU. (königlich württembergiſchen) Armeecorps,
General der Infanterie v. Lindequiſt, in gleicher Eigenschaft |
an die. Spitze des neugebildeten XVI. Armeecorps mit dem
Sitze in Frankfurt a. M. berufen. Als sein Nachfolger ist
_ der bisherige Kommandeur der 2. Gardediviſion in Berlin,
Generalleutnant Jreiherr v. Falkenhauſen, nach Stuttgart
verſetzt und zunächſt mit der Führung des Armeecorps beauf- |
tragt worden. – Ludwig Freiherr v. Falkenhauſen, dessen |
HBildnis wir unseren Lesern auf S. 61:3 vorführen, ist als
_ Sohn des 1889 zu Breslau verstorbenen Generalleutnants
_ v. Falkenhauſen am 18. September 1844 zu Guben geboren.
Nachdem er die Kadettenschule durchgemacht hatte, wurde er
_ 1862 zum Leutnant befördert und 1873 unter Ueberweiſung
zum Generalſtab des XIV. Armeecorps als Hauptmann in
î den Generalstab der Armee verſezt. 1875 wurde er dem
. E. ...
Generalstab der 16. Diviſion und 1879 dem des VIII. Armee-
corps zugeteilt; im letzteren Jahre erfolgte auch seine Be-
förderung zum Major. 1885 erhielt Freiherr v. Falkenhauſen
das Kommando des 1. Eataillons des 65. Infanterieregiments,
wurde 1887 unter Rückverſezung in den .Generalsſtab der
Armee mit Wahrnehmung der Geschäfte als Chef des General-
stabes des Gardecorps beauftragt und im gleichen Jahr zum
Oberſtleutnant befördert und zum Chef jenes Generalstabes
ernannt. 1889 erfolgte seine Beförderung zum Oberst, 1890 die
Ernennung zum Kommandeur des Garde-Grenadierregiments
Nr. 4 (Königin Augusta), worauf er 1892 mit der Führung
der 29. Infanteriebrigade in Aachen beauftragt und im
ghgleichen Jahre unter Leförderung zum Generalmajor zum
Kommandeur dieser Brigade ernannt wurde. 1893 wurde
Freiherr v. Falkenhauſen unter Stellung à la svite der
î Anmee zur Verfügung des Chefs des Generalstabes der
Armee gestellt und zum Oberquartiermeiſter ernannt. 1895
erfolgte seine Berufung zum Direktor des Allgemeinen Kriegs-
departements und Mitglied der Landesverteidigungskommission
(in Vertretung des Kriegsministers), wie zum stellvertretenden
Bevollmächtigten zum Bundesrat und zum Vorsitzenden der
Reichsrayonkommission und Mitglied des kaiserlichen Diszi-
plinarhofes. Nachdem er am 16. Juni 1896 zum General-
leutnant befördert worden war, wurde ihm am 27. Januar 1897
das Kommando der 2. Garde-JInfanteriediviſion übertragen,
das er bis zu ſeiner jüngsten Berufung inne gehabt hat.
Dem neuen kommandierenden General, der wie sein Vor-
_ gjgqaänger die Schule des Generalstabes durchgemacht hat, geht
der Ruf eines hervorragend tüchtigen Offiziers voraus. Sein
Name wurde ſchon früher auch in der Oeffentlichkeit genannt.
î Als Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements iſt Freiherr
v. Falkenhauſen im Reichstag mit Geſchick und Erfolg für
_ die Interessen der Heeresverwaltung eingetreten.
Ankunft der Sommerfriſchler auf der Alm.
(Siehe das Bild auf Seite 616 und 617.)
ine Alm gehört," wie Karl Stieler humoriſtiſch bemerkt,
„zu den glücklichen Dingen, welche bei jedermann beliebt
ſind: jene etwa ausgenommen, die das Podagra haben. Von
den meiſten, die darüber geschrieben, wurden Einzelheiten
geſchildert: der eine nahm die Landschaft, der andere die
î Teouriſten; das jedoch, was das Wichtigste iſt, haben die
von ſsämtlichen Booten umfahren werden. mußte.
meiſten übergangen. Dies ist der tiefe Zuſammenhang, den
das ganze Kulturleben des Hochlandes mit dem Almenleben
hat. – Nur mitten unter Bergestannen wachſen jene Ge-
stalten auf, die selber wie die Tannen sind; nur auf der
Alm kann man ſingen aus freier voller Bruſt. Wie das
Souveräne, so wurzelt auch das Rhythmiſche, das im Wesen
des Hochländers liegt, das aus seinem Tanz und ſeinen
Liedern hervorbricht, auf der Alm. Sie bildet das lebendige
Bindeglied zwiſchen dem Gebirge und seinen Bewohnern."
Das begreift und empfindet auch der Fremde, und wer in
die Berge kommt, will eine Alm und ihre Bewohner aus
eigener Anschauung kennen lernen. Das hübſche Gemälde
von P. Felgentreff, das wir auf S. 616 und 617 in Holz-
ſchnittnachbildung den Lesern bieten, bringt in überaus
charakteriſtiſcher Weiſe und mit köſtlichem Humor eine ſolche
„Ankunft der Sommerfriſchler auf der Alm“ zur Darſtellung.
Vie alljährlich in der Zeit von Mitte Juli bis September,
sind unten im Dorfe Sommergäſte eingetroffen, darunter auch
ständige Besucher, die immer wieder nach diesem ihnen lieb
gewordenen Fleckchen Erde in den Bergen kommen. Sie
wissen natürlich längſt genau in der ganzen Umgebung Be-
scheid und machen gern die Neulinge mit den bemerkens-
werteſten Punkten bekannt. Von den Touristen auf dem
Vilde iſt der Herr mit dem unten ſpitz zugeſchnittenen Voll-
bart, der durch Schwenken seines Hutes die den Gäſten
entgegenſchauende Alte begrüßt, und seine Frau, die der
einen ſchmucken Almerin gerade herzlich die Hand ſchüttelt,
offenbar hier oben ſchon von früheren Beſuchen her bekannt.
Ein Neuling dagegen ist, wie seine ganze Ausſtaffierung
zeigt, der zweite Herr, der sich gerade den Kneifer aufsetzt,
um die „Einjeborenen“ näher zu betrachten. Er bildet eine
überaus komiſche Figur und ein würdiges Gegenstück zu
; Allerliebſt iſt der im Vorder-
grunde stehende Bub, den das ſstädtiſche Mädchen lächelnd
betrachtet, und ein echter Gebirgler der im Hintergrund auf-
ure otst oder Hansei, auf den das bekannte. Schnader-
üpfel paßt: ;
Defreggers „Salontiroler“.
„Für 'n langweili’n Knecht
Is a Heimdirndl recht.
Doch a lustiger Vua
Geht an Almdirndl zua."
In diesen Versen drückt ſich die Hochſchätung aus, die die
Gebirgler selbſt dem „alpinen“ Berufe entgegenbringen. Eine
| Kuh, die nicht friſch und derb genug ist, um auf die Alp zu
fahren, nennt man eine „Heimkuh"“, und ein nur zur Haus-
arbeit taugendes Mädchen ein „Heimdirndl“ im Gegensatz
zu den „Almdirndln", von denen wir zwei prächtige Exem-
plare auf unserem Bilde sehen. :
: . §
Eine Ruderregatta in der Bucht von Kiautſchou.
; . . (Siehe das Bild auf Seite 621.) f
M'U;g t °un luutfhon und etanſgquittht bie tt rt
einem Sonntage veranſtaltete Ruderregatta von Matroſen der
dort ankernden deutſchen Kriegsschiffe. Die diesem für die
wackeren „Blaujacten" als ein Ereignis von höchster Wichtigkeit
geltenden Wettbewerb vorhergehenden Tage waren dazu be-
nützt worden, um die Boote in besten Stand zu bringen,
ihren Boden möglichſt glatt zu machen und mit Fett ein-
zureiben, für die stärkſten und elaſstiſchen Riemen (Ruder)
zu sorgen und vor allem, um die tüchtigsten Leute als Be-
ſatungen auszuſuchen, deren Muskelkraft mit der nötigen
Ausdauer gleichen Schritt hielt. Unter den Mannschaften
bot sich dafür eine reiche Auswahl, und als die Leute ſich
an einigen Morgen und Abenden eingerudert hatten, sah
man dem auf den nächſten Sonntag festgesetzten Regattatage
mit Spannung entgegen. Zur festgesetzten Stunde erschienen
die Boote, die ſich an der Wettfahrt beteiligten, am Start,
legten ſich in Linie nebeneinander, die Riemen in die Höhe
geſtellt, klar zur Abfahrt und des Signals dazu gewärtig.
In jedem Boot befand sich ein Unteroffizier am Steuer.
Ziemlich nahe dem Jlaggſchiff „Deutschland“ der 2. Division
unter Kommando des Prinzen Heinrich war eine Boje
mit Flagge verankert, die als Wendemarke galt, das heißt
Der
Kreuzer „Kaiserin Auguſta“, der ziemlich an der Einfahrt
des Hafens verankert war, bildete das Endziel. Punkt
4 Uhr fiel der Startſchuß. Gleichzeitig ſchlugen sämtliche
Riemen auf das Wasser nieder, und die Boote ſetzten sich in
Fahrt, begleitet von einem tauſendfachen kräftigen Hurra der
zuſchauenden Mannſchaften. Dann trat einen Augenblick Stille
ein, doch ſchon nach einigen Minuten ersſcholl wieder ein
lautes „Hip! Hip! Hurra!“ von der „Deutſchland“ her, deren
Kutter zuſehends gewann, während die anderen Boote zurück-
blieben. Da iſt die Boje erreicht, und das erſte ſie um-
rudernde Boot zeigt ſich breit und mit auswehender Flagge.
Wiederum ertönt ein donnerndes „Hip! Hip! Hurra!" von
der ,„Deutſchland" ihren Kameraden im ersten Boot ent-
gegen. Die Boote kamen immer näher aneinander. Vergebens
gaben die etwas Zurückgebliebenen ihre letzte Kraft aus, um
es half ihnen nichts,
das Verlorene wieder zu gewinnen -
der Kutter der „Deutſchland“ behielt die Führung. Kurz
hinter ihm folgten noch zwei andere Kutter von den Kreuzern
„Kaiſer" und ,„Prinzeß Wilhelm“, nach hundert Schritten
etwa der Rest. „Pik die Riemen!“ ertönte das Kommando,
als der erſte Sieger das Ziel, den Kreuzer „Kaiserin Auguſta“,
erreichte. Die Riemen flogen in die Höhe, ſtellten ſich senk-
recht im Boot, und ein nicht endenwollendes „Hurra empfing
die Kameraden, welche ſich ſo tapfer gehalten hatten. Am
Abend, nach der Preisverteilung, wurde der Sieg auf der
„Deutſchland“ bei einer kräftigen Grogbowle, die der Kapitän
ſpendete, sowie mit Spiel, Tanz und Gesang gebührend ge-
feiert '
der Geiſtliche etwas erregt fort.
| | | Ê619
Der Geburtsſchein.
L Roman
Friedrich Jarobſen.
m
|E w . (Nachdruck verboten.)
U as iſt ja ganz unheimlich, " ſagte Baum zu dem
EW!
I).
D
Z!
V /H%& Pfarrer, indem sie auf die Kirche zugingen;
E H! Sie den Weg um diese Stunde
öfters ?“ t
„Faſt niemals, “ entgegnete der Geiſtliche.
„Aeltere Urkunden werden ſo ſelten verlangt,
daß die in der Sakriſtei befindlichen Kirchen-
bücher oft Jahre hindurch Ruhe haben. Während mei-
ner Amtsführung bin ich nur ein einziges Mal dar-
über gewesen, und damals handelte es sich um enn
Totenſchein. Das Buch, das Sie einzuſehen wünschen,
iſt noch niemals in meinen Händen geweſen. “
Sie hatten inzwiſchen die Kirche erreicht und be-
traten die in dem Ausbau befindliche Sakriſtei. Sie
war mit einer ſchweren, eiſenbeſchlagenen Thür ven
ſchloſſen, und die aus rohen Feldſteinen aufgeführte
Mauer war ſo dick, daß Baum unwillkürlich sagte:
„Was hier aufgehoben wird, erſcheint allerdings gegen
jeden unberechtigten Eingriff gesichert.nn.
„Ich wüßte auch wirklich nicht, “ entgegnete Cramer,
„wer einen ſolchen jemals verſuchen sollte.“ ;
Das Jnnere der Satriſtei war sehr einfach aus-
geſtattet. Weißgetünchte Wände, ein klobiger Eichen-
| tiſch, auf dem ein Kruzifix stand und eine Bibel lag,
davor ein Stuhl. In der Ecke ſah man eine eiſerne
Truhe, die mit großen Schrauben im Gemäuer be-
feſtigt und mit zwei Vorhängeſchlössern versehen war.
„Das ist der Bücherſchrein, “ sagte Cramer und
ſtellte die Laterne auf den Tisch. Er ſchloß die Kiſte_ |
auf, wühlte darin herum und brachte endlich ein großes,
in Schweinsleder gebundenes Buch zum Vorſchin.
Unter dem Licht der Laterne ſchlug er das erſte Blatt
auf und las: ; :
îHGeburts- und Taufregiſter der Kirchengemeinde
zu Ellrode. Begonnen am 1. Juli des Jahres 1779.
Geſchloſſen am 31. Dezember des Jahres 1859.0
Darunter befand sich das Kirchensiegel.
_ Der erſte Abſat war mit verblaßter Tinte unn
von derſelben Hand geschrieben, welche die ersten Ein-
träge bewirkt hatte; der Schlußvermerk wies eine tief.
ſchwarze Schrift auf und stammte offenbar von der
Hand des Pfarrers Bode.
„Die beiden Bücher ergänzen einander genau, “ sagte
Cramer. „Was wollten Sie ſuchen, Herr Baum?“
„Bitte, das letzte Blatt. “
uHier.' . Ô |
Es war eigentlich das vorletzte, auf das Cramer
seinen Finger legte, aber das letzte war leer. Auf
dem vorlettten befand ſich von Bodes Hand eine Ein-
tragung aus dem Dezember 1859, die erſt unten a::
. | Rande ſchloß, dann kam das letzte leere Blatt. Aber
zwiſchen dieſem und dem vorletzten war ein ganz
ſchmaler Rand.
„Hier iſt ein Blatt herausgeſchnitten, “ sagte Richard.
Der Geiſtliche prüfte genau die Stelle und ſchüttelte
den Kopf : „Die Blätter ſind nicht nummeriert, das iſt
erſt in neuerer Zeit eingeführt worden, aber Sie können
dennoch recht haben. Der Schnitt iſt sehr fein und
vorsichtig ausgeführt, aber man sieht noch den Reſt des
Hilou:t. welche Vermutung knüpfen Sie an dieſe
Thatsache?"
bagethes ſchwieg und zuckte die Achſel.
„Ich will Ihnen sagen, was Sie denken," fuhr
„Sie meinen, die
von Ihnen geſuchte Eintragung könnte auf dem aus-
geſchnittenen Blatte gestanden haben. – Halten Sie
meinen Vorgänger und Schwiegervater für einen Fäl-
cher?"
„Nein, " entgegnete Richard mit warmer Betonung,
„ganz gewiß nicht. Paſtor Bode hat nach dem Zeug-
nis meines . Vaters das Gebot der Nächſtenliebe in
Huter rie erfüllt; der Mann kann kein Fälſcher
gewesen ſein.“
Cramer nickte mit einem wehmütigen Lächeln. „Ich
danke Ihnen für dieſe Erklärung, Herr Baum; ein
Verdacht würde mich tief geſchmerzt haben. Aber auch
ein Verſehen kann nicht vorliegen. Paſtor Bode be-
kundet ausdrücklich auf dem ersten Blatt, daß dieses
Kirchenbuch am 831. Dezember 1859 geſchloſſen fei.
Die von Ihnen geſuchte Eintragung soll am 5. Januar
1860 stattgefunden haben. Sie müßte ſich also folge-
richtig in dem nächstfolgenden Bande vorfinden, und
da dies nicht der Fall iſt &
„So folgern Sie mit Recht, daß ich in Ellrode
überhaupt nicht geboren bin, “ vollendete Richard den
Sat. „Kommen Sie, Herr Paſtor, wir haben hier
und ſie ſchien weniger zuversichtlich zu werden ~ „frei-
mir die Abendkühle so auf die Bruſt.“
Heft 26.
D a s Bu ch für Alle. .
wirklich nur die Zuſammenſetzung der hiesigen Gefsell-
ſchaft, die mir nicht gefällt. ~ Also meinen Schlupf-
winkel oben in den Bergen wollten Sie aufspüren?
Und h:clleicht. hegen Sie ſogar dieſe ſchlimme Abhſicht
“tts r sei denn, daß Sie es mir ausdrücklich
verbieten. Und ein solches Verbot würde mich ſehr
traurig machen, Fräulein v. Ranten. “ :
J„Warum Jollte ich s Ihnen auch verwehren? Erſtens
habe ich gar kein Recht dazu, und hvcitent wekven
lich habe ich ja die Unvorsichtigkeit begangen, Sie gestern
elbſt auf die rechte Spur zu leiten.“
Eine kleine, verſchrumpſt und gebrechlich aussehende
alte Dame kam in dieſem Augenblick auf sie zu.
„Wollen wir nicht jetzt nach Hauſe gehen, liebſte
Lilli?“ fragte sie, ohne von Rudolf weiter Notiz zu
nehmen, mit einer dünnen, ängstlich klingenden Stimme.
„Der Major hat die Güte gehabt, mir seine Begleitung
anzubieten, und wenn wir noch länger warten, fällt
„Meinetwegen mögen wir aufbrechen,“ erwiderte
Lilli in einem Tone, der durchaus nicht den Anſchein
erweckte, als hätte die Teilnahme für die ſchwache Bruſt
des alten Fräuleins ihren Entſchluß beſtimmt. „Sie
wiſſen ja, daß ich überhaupt nur auf Ihr Zureden
hierher ging. – Guten Abend, Herr Rechtsanwalt,
~ und wenn Sie mein Märchenſchloß finden, ſo ~
„Nun?" forſchte er, da sie inne hielt. „Wird es
ein Lohn oder eine Strafe sein, was mich alsdann
erwartet ?" ; L
: ? . C(Fortſeugung folgt.)
Ludwig Freiherr v. Falkenhauſen,
kommandierender General des XII. (königlich
württembergiſchen) Armeecorps.
(Siehe das Porträt auf Seite 613.)
m März 1899 wurde der bisherige kommandierende Ge-:
neral des XIU. (königlich württembergiſchen) Armeecorps,
General der Infanterie v. Lindequiſt, in gleicher Eigenschaft |
an die. Spitze des neugebildeten XVI. Armeecorps mit dem
Sitze in Frankfurt a. M. berufen. Als sein Nachfolger ist
_ der bisherige Kommandeur der 2. Gardediviſion in Berlin,
Generalleutnant Jreiherr v. Falkenhauſen, nach Stuttgart
verſetzt und zunächſt mit der Führung des Armeecorps beauf- |
tragt worden. – Ludwig Freiherr v. Falkenhauſen, dessen |
HBildnis wir unseren Lesern auf S. 61:3 vorführen, ist als
_ Sohn des 1889 zu Breslau verstorbenen Generalleutnants
_ v. Falkenhauſen am 18. September 1844 zu Guben geboren.
Nachdem er die Kadettenschule durchgemacht hatte, wurde er
_ 1862 zum Leutnant befördert und 1873 unter Ueberweiſung
zum Generalſtab des XIV. Armeecorps als Hauptmann in
î den Generalstab der Armee verſezt. 1875 wurde er dem
. E. ...
Generalstab der 16. Diviſion und 1879 dem des VIII. Armee-
corps zugeteilt; im letzteren Jahre erfolgte auch seine Be-
förderung zum Major. 1885 erhielt Freiherr v. Falkenhauſen
das Kommando des 1. Eataillons des 65. Infanterieregiments,
wurde 1887 unter Rückverſezung in den .Generalsſtab der
Armee mit Wahrnehmung der Geschäfte als Chef des General-
stabes des Gardecorps beauftragt und im gleichen Jahr zum
Oberſtleutnant befördert und zum Chef jenes Generalstabes
ernannt. 1889 erfolgte seine Beförderung zum Oberst, 1890 die
Ernennung zum Kommandeur des Garde-Grenadierregiments
Nr. 4 (Königin Augusta), worauf er 1892 mit der Führung
der 29. Infanteriebrigade in Aachen beauftragt und im
ghgleichen Jahre unter Leförderung zum Generalmajor zum
Kommandeur dieser Brigade ernannt wurde. 1893 wurde
Freiherr v. Falkenhauſen unter Stellung à la svite der
î Anmee zur Verfügung des Chefs des Generalstabes der
Armee gestellt und zum Oberquartiermeiſter ernannt. 1895
erfolgte seine Berufung zum Direktor des Allgemeinen Kriegs-
departements und Mitglied der Landesverteidigungskommission
(in Vertretung des Kriegsministers), wie zum stellvertretenden
Bevollmächtigten zum Bundesrat und zum Vorsitzenden der
Reichsrayonkommission und Mitglied des kaiserlichen Diszi-
plinarhofes. Nachdem er am 16. Juni 1896 zum General-
leutnant befördert worden war, wurde ihm am 27. Januar 1897
das Kommando der 2. Garde-JInfanteriediviſion übertragen,
das er bis zu ſeiner jüngsten Berufung inne gehabt hat.
Dem neuen kommandierenden General, der wie sein Vor-
_ gjgqaänger die Schule des Generalstabes durchgemacht hat, geht
der Ruf eines hervorragend tüchtigen Offiziers voraus. Sein
Name wurde ſchon früher auch in der Oeffentlichkeit genannt.
î Als Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements iſt Freiherr
v. Falkenhauſen im Reichstag mit Geſchick und Erfolg für
_ die Interessen der Heeresverwaltung eingetreten.
Ankunft der Sommerfriſchler auf der Alm.
(Siehe das Bild auf Seite 616 und 617.)
ine Alm gehört," wie Karl Stieler humoriſtiſch bemerkt,
„zu den glücklichen Dingen, welche bei jedermann beliebt
ſind: jene etwa ausgenommen, die das Podagra haben. Von
den meiſten, die darüber geschrieben, wurden Einzelheiten
geſchildert: der eine nahm die Landschaft, der andere die
î Teouriſten; das jedoch, was das Wichtigste iſt, haben die
von ſsämtlichen Booten umfahren werden. mußte.
meiſten übergangen. Dies ist der tiefe Zuſammenhang, den
das ganze Kulturleben des Hochlandes mit dem Almenleben
hat. – Nur mitten unter Bergestannen wachſen jene Ge-
stalten auf, die selber wie die Tannen sind; nur auf der
Alm kann man ſingen aus freier voller Bruſt. Wie das
Souveräne, so wurzelt auch das Rhythmiſche, das im Wesen
des Hochländers liegt, das aus seinem Tanz und ſeinen
Liedern hervorbricht, auf der Alm. Sie bildet das lebendige
Bindeglied zwiſchen dem Gebirge und seinen Bewohnern."
Das begreift und empfindet auch der Fremde, und wer in
die Berge kommt, will eine Alm und ihre Bewohner aus
eigener Anschauung kennen lernen. Das hübſche Gemälde
von P. Felgentreff, das wir auf S. 616 und 617 in Holz-
ſchnittnachbildung den Lesern bieten, bringt in überaus
charakteriſtiſcher Weiſe und mit köſtlichem Humor eine ſolche
„Ankunft der Sommerfriſchler auf der Alm“ zur Darſtellung.
Vie alljährlich in der Zeit von Mitte Juli bis September,
sind unten im Dorfe Sommergäſte eingetroffen, darunter auch
ständige Besucher, die immer wieder nach diesem ihnen lieb
gewordenen Fleckchen Erde in den Bergen kommen. Sie
wissen natürlich längſt genau in der ganzen Umgebung Be-
scheid und machen gern die Neulinge mit den bemerkens-
werteſten Punkten bekannt. Von den Touristen auf dem
Vilde iſt der Herr mit dem unten ſpitz zugeſchnittenen Voll-
bart, der durch Schwenken seines Hutes die den Gäſten
entgegenſchauende Alte begrüßt, und seine Frau, die der
einen ſchmucken Almerin gerade herzlich die Hand ſchüttelt,
offenbar hier oben ſchon von früheren Beſuchen her bekannt.
Ein Neuling dagegen ist, wie seine ganze Ausſtaffierung
zeigt, der zweite Herr, der sich gerade den Kneifer aufsetzt,
um die „Einjeborenen“ näher zu betrachten. Er bildet eine
überaus komiſche Figur und ein würdiges Gegenstück zu
; Allerliebſt iſt der im Vorder-
grunde stehende Bub, den das ſstädtiſche Mädchen lächelnd
betrachtet, und ein echter Gebirgler der im Hintergrund auf-
ure otst oder Hansei, auf den das bekannte. Schnader-
üpfel paßt: ;
Defreggers „Salontiroler“.
„Für 'n langweili’n Knecht
Is a Heimdirndl recht.
Doch a lustiger Vua
Geht an Almdirndl zua."
In diesen Versen drückt ſich die Hochſchätung aus, die die
Gebirgler selbſt dem „alpinen“ Berufe entgegenbringen. Eine
| Kuh, die nicht friſch und derb genug ist, um auf die Alp zu
fahren, nennt man eine „Heimkuh"“, und ein nur zur Haus-
arbeit taugendes Mädchen ein „Heimdirndl“ im Gegensatz
zu den „Almdirndln", von denen wir zwei prächtige Exem-
plare auf unserem Bilde sehen. :
: . §
Eine Ruderregatta in der Bucht von Kiautſchou.
; . . (Siehe das Bild auf Seite 621.) f
M'U;g t °un luutfhon und etanſgquittht bie tt rt
einem Sonntage veranſtaltete Ruderregatta von Matroſen der
dort ankernden deutſchen Kriegsschiffe. Die diesem für die
wackeren „Blaujacten" als ein Ereignis von höchster Wichtigkeit
geltenden Wettbewerb vorhergehenden Tage waren dazu be-
nützt worden, um die Boote in besten Stand zu bringen,
ihren Boden möglichſt glatt zu machen und mit Fett ein-
zureiben, für die stärkſten und elaſstiſchen Riemen (Ruder)
zu sorgen und vor allem, um die tüchtigsten Leute als Be-
ſatungen auszuſuchen, deren Muskelkraft mit der nötigen
Ausdauer gleichen Schritt hielt. Unter den Mannschaften
bot sich dafür eine reiche Auswahl, und als die Leute ſich
an einigen Morgen und Abenden eingerudert hatten, sah
man dem auf den nächſten Sonntag festgesetzten Regattatage
mit Spannung entgegen. Zur festgesetzten Stunde erschienen
die Boote, die ſich an der Wettfahrt beteiligten, am Start,
legten ſich in Linie nebeneinander, die Riemen in die Höhe
geſtellt, klar zur Abfahrt und des Signals dazu gewärtig.
In jedem Boot befand sich ein Unteroffizier am Steuer.
Ziemlich nahe dem Jlaggſchiff „Deutschland“ der 2. Division
unter Kommando des Prinzen Heinrich war eine Boje
mit Flagge verankert, die als Wendemarke galt, das heißt
Der
Kreuzer „Kaiserin Auguſta“, der ziemlich an der Einfahrt
des Hafens verankert war, bildete das Endziel. Punkt
4 Uhr fiel der Startſchuß. Gleichzeitig ſchlugen sämtliche
Riemen auf das Wasser nieder, und die Boote ſetzten sich in
Fahrt, begleitet von einem tauſendfachen kräftigen Hurra der
zuſchauenden Mannſchaften. Dann trat einen Augenblick Stille
ein, doch ſchon nach einigen Minuten ersſcholl wieder ein
lautes „Hip! Hip! Hurra!“ von der „Deutſchland“ her, deren
Kutter zuſehends gewann, während die anderen Boote zurück-
blieben. Da iſt die Boje erreicht, und das erſte ſie um-
rudernde Boot zeigt ſich breit und mit auswehender Flagge.
Wiederum ertönt ein donnerndes „Hip! Hip! Hurra!" von
der ,„Deutſchland" ihren Kameraden im ersten Boot ent-
gegen. Die Boote kamen immer näher aneinander. Vergebens
gaben die etwas Zurückgebliebenen ihre letzte Kraft aus, um
es half ihnen nichts,
das Verlorene wieder zu gewinnen -
der Kutter der „Deutſchland“ behielt die Führung. Kurz
hinter ihm folgten noch zwei andere Kutter von den Kreuzern
„Kaiſer" und ,„Prinzeß Wilhelm“, nach hundert Schritten
etwa der Rest. „Pik die Riemen!“ ertönte das Kommando,
als der erſte Sieger das Ziel, den Kreuzer „Kaiserin Auguſta“,
erreichte. Die Riemen flogen in die Höhe, ſtellten ſich senk-
recht im Boot, und ein nicht endenwollendes „Hurra empfing
die Kameraden, welche ſich ſo tapfer gehalten hatten. Am
Abend, nach der Preisverteilung, wurde der Sieg auf der
„Deutſchland“ bei einer kräftigen Grogbowle, die der Kapitän
ſpendete, sowie mit Spiel, Tanz und Gesang gebührend ge-
feiert '
der Geiſtliche etwas erregt fort.
| | | Ê619
Der Geburtsſchein.
L Roman
Friedrich Jarobſen.
m
|E w . (Nachdruck verboten.)
U as iſt ja ganz unheimlich, " ſagte Baum zu dem
EW!
I).
D
Z!
V /H%& Pfarrer, indem sie auf die Kirche zugingen;
E H! Sie den Weg um diese Stunde
öfters ?“ t
„Faſt niemals, “ entgegnete der Geiſtliche.
„Aeltere Urkunden werden ſo ſelten verlangt,
daß die in der Sakriſtei befindlichen Kirchen-
bücher oft Jahre hindurch Ruhe haben. Während mei-
ner Amtsführung bin ich nur ein einziges Mal dar-
über gewesen, und damals handelte es sich um enn
Totenſchein. Das Buch, das Sie einzuſehen wünschen,
iſt noch niemals in meinen Händen geweſen. “
Sie hatten inzwiſchen die Kirche erreicht und be-
traten die in dem Ausbau befindliche Sakriſtei. Sie
war mit einer ſchweren, eiſenbeſchlagenen Thür ven
ſchloſſen, und die aus rohen Feldſteinen aufgeführte
Mauer war ſo dick, daß Baum unwillkürlich sagte:
„Was hier aufgehoben wird, erſcheint allerdings gegen
jeden unberechtigten Eingriff gesichert.nn.
„Ich wüßte auch wirklich nicht, “ entgegnete Cramer,
„wer einen ſolchen jemals verſuchen sollte.“ ;
Das Jnnere der Satriſtei war sehr einfach aus-
geſtattet. Weißgetünchte Wände, ein klobiger Eichen-
| tiſch, auf dem ein Kruzifix stand und eine Bibel lag,
davor ein Stuhl. In der Ecke ſah man eine eiſerne
Truhe, die mit großen Schrauben im Gemäuer be-
feſtigt und mit zwei Vorhängeſchlössern versehen war.
„Das ist der Bücherſchrein, “ sagte Cramer und
ſtellte die Laterne auf den Tisch. Er ſchloß die Kiſte_ |
auf, wühlte darin herum und brachte endlich ein großes,
in Schweinsleder gebundenes Buch zum Vorſchin.
Unter dem Licht der Laterne ſchlug er das erſte Blatt
auf und las: ; :
îHGeburts- und Taufregiſter der Kirchengemeinde
zu Ellrode. Begonnen am 1. Juli des Jahres 1779.
Geſchloſſen am 31. Dezember des Jahres 1859.0
Darunter befand sich das Kirchensiegel.
_ Der erſte Abſat war mit verblaßter Tinte unn
von derſelben Hand geschrieben, welche die ersten Ein-
träge bewirkt hatte; der Schlußvermerk wies eine tief.
ſchwarze Schrift auf und stammte offenbar von der
Hand des Pfarrers Bode.
„Die beiden Bücher ergänzen einander genau, “ sagte
Cramer. „Was wollten Sie ſuchen, Herr Baum?“
„Bitte, das letzte Blatt. “
uHier.' . Ô |
Es war eigentlich das vorletzte, auf das Cramer
seinen Finger legte, aber das letzte war leer. Auf
dem vorlettten befand ſich von Bodes Hand eine Ein-
tragung aus dem Dezember 1859, die erſt unten a::
. | Rande ſchloß, dann kam das letzte leere Blatt. Aber
zwiſchen dieſem und dem vorletzten war ein ganz
ſchmaler Rand.
„Hier iſt ein Blatt herausgeſchnitten, “ sagte Richard.
Der Geiſtliche prüfte genau die Stelle und ſchüttelte
den Kopf : „Die Blätter ſind nicht nummeriert, das iſt
erſt in neuerer Zeit eingeführt worden, aber Sie können
dennoch recht haben. Der Schnitt iſt sehr fein und
vorsichtig ausgeführt, aber man sieht noch den Reſt des
Hilou:t. welche Vermutung knüpfen Sie an dieſe
Thatsache?"
bagethes ſchwieg und zuckte die Achſel.
„Ich will Ihnen sagen, was Sie denken," fuhr
„Sie meinen, die
von Ihnen geſuchte Eintragung könnte auf dem aus-
geſchnittenen Blatte gestanden haben. – Halten Sie
meinen Vorgänger und Schwiegervater für einen Fäl-
cher?"
„Nein, " entgegnete Richard mit warmer Betonung,
„ganz gewiß nicht. Paſtor Bode hat nach dem Zeug-
nis meines . Vaters das Gebot der Nächſtenliebe in
Huter rie erfüllt; der Mann kann kein Fälſcher
gewesen ſein.“
Cramer nickte mit einem wehmütigen Lächeln. „Ich
danke Ihnen für dieſe Erklärung, Herr Baum; ein
Verdacht würde mich tief geſchmerzt haben. Aber auch
ein Verſehen kann nicht vorliegen. Paſtor Bode be-
kundet ausdrücklich auf dem ersten Blatt, daß dieses
Kirchenbuch am 831. Dezember 1859 geſchloſſen fei.
Die von Ihnen geſuchte Eintragung soll am 5. Januar
1860 stattgefunden haben. Sie müßte ſich also folge-
richtig in dem nächstfolgenden Bande vorfinden, und
da dies nicht der Fall iſt &
„So folgern Sie mit Recht, daß ich in Ellrode
überhaupt nicht geboren bin, “ vollendete Richard den
Sat. „Kommen Sie, Herr Paſtor, wir haben hier