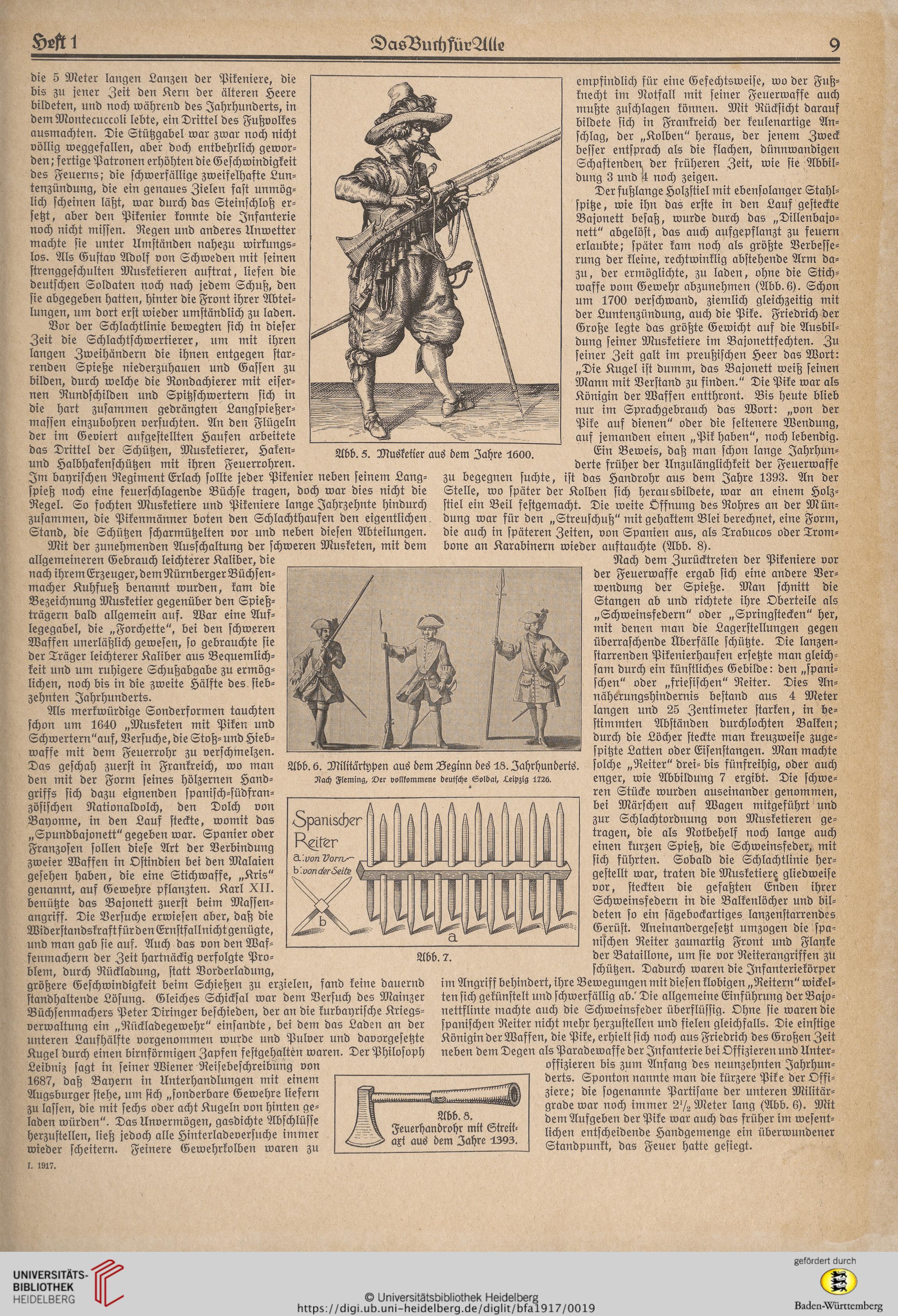DasVuchsüvAlts
Abb. 5. Musketier aus dem Zähre 4600.
Abb. 6. Militartypen aus dem Beginn des 48. Jahrhunderts.
Nach Fleming, Oer vollkommene deutsche Soldat, Leipzig 1226.
empfindlich für eine Gefechtsweise, wo der Fuß-
knecht im Notfall mit seiner Feuerwaffe auch
mußte zuschlagen können. Mit Rücksicht darauf
bildete sich in Frankreich der keulenartige An-
schlag, der „Kolben" heraus, der jenem Zweck
besser entsprach als die flachen, dünnwandigen
Schaftenden, der früheren Zeit, wie sie Abbil-
dung 3 und 4 noch zeigen.
Der fußlange Holzstiel mit ebensolanger Stahl-
spitze, wie ihn das erste in den Lauf gesteckte
Bajonett besaß, wurde durch das „Dillenbajo-
nett" abgelöst, das auch aufgepflanzt zu feuern
erlaubte; später kam noch als größte Verbesse-
rung der kleine, rechtwinklig abstehende Arm da-
zu, der ermöglichte, zu laden, ohne die Stich-
waffe vom Gewehr abzunehmen (Abb.6). Schon
um 1700 verschwand, ziemlich gleichzeitig mit
der Luntenzündung, auch die Pike. Friedrich der
Große legte das größte Gewicht auf die Ausbil-
dung seiner Musketiere im Bajonettfechten. Zu
seiner Zeit galt im preußischen Heer das Wort:
„Die Kugel ist dumm, das Bajonett weiß seinen
Mann mit Verstand zu finden." Die Pike war als
Königin der Waffen entthront. Bis heute blieb
nur im Sprachgebrauch das Wort: „von der
Pike auf dienen" oder die seltenere Wendung,
auf jemanden einen „Pik haben", noch lebendig.
Ein Beweis, daß man schon lange Jahrhun-
derte früher der Unzulänglichkeit der Feuerwaffe
zu begegnen suchte, ist das Handrohr aus dem Jahre 1393. An der
Stelle, wo später der Kolben sich herausbildete, war an einem Holz-
stiel ein Beil festgemacht. Die weite Öffnung des Rohres an der Mün-
dung war für den „Streuschuß" mit gehaktem Blei berechnet, eine Form,
die auch in späteren Zeiten, von Spanien aus, als Trabucos oder Trom-
bone an Karabinern wieder auftauchte (Abb. 8).
Nach dem Zurücktreten der Pikeniere vor
der Feuerwaffe ergab sich eine andere Ver-
wendung der Spieße. Man schnitt die
Stangen ab und richtete ihre Oberteile als
„Schweinsfedern" oder „Springstecken" her,
mit denen man die Lagerstellungen gegen
überraschende Überfälle schützte. Die lanzen-
starrenden Pikenierhaufen ersetzte man gleich-
sam durch ein künstliches Gebilde: den „spani-
schen" oder „friesischen" Reiter. Dies An-
näherungshindernis bestand aus 4 Meter
langen und 25 Zentimeter starken, in be-
stimmten Abständen durchlochten Balken;
durch die Löcher steckte man kreuzweise zuge-
spitzte Latten oder Eisenstangen. Man machte
solche „Reiter" drei- bis fünfreihig, oder auch
enger, wie Abbildung 7 ergibt. Die schwe-
ren Stücke wurden auseinander genommen,
bei Märschen auf Wagen mitgeführt und
zur Schlachtordnung von Musketieren ge-
tragen, die als Notbehelf noch lange auch
einen kurzen Spieß, die Schweinsfeder, mit
sich führten. Sobald die Schlachtlinie her-
gestellt war, traten die Musketier^ gliedweise
vor, steckten die gefaßten Enden ihrer
Schweinsfedern in die Balkenlöcher und bil-
deten so ein sägebockartiges lanzenstarrendes
Gerüst. Aneinandergesetzt umzogen die spa-
nischen Reiter zaunartig Front und Flanke
der Bataillone, um sie vor Reiterangriffen zu
schützen. Dadurch waren die Jnfanteriekörper
im Angriff behindert, ihre Bewegungen mit diesen klobigen „Reitern" wickel-
ten sich gekünstelt und schwerfällig ab.' Die allgemeine Einführung der Bajo-
nettflinte machte auch die Schweinsfeder überflüssig. Ohne sie waren die
spanischen Reiter nicht mehr herzustellen und fielen gleichfalls. Die einstige
Königin der Waffen, die Pike, erhielt sich noch aus Friedrich des Großen Zeit
neben dem Degen als Paradewaffe der Infanterie bei Offizieren und Unter-
offizieren bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhun-
derts. Spontan nannte man die kürzere Pike der Offi-
ziere; die sogenannte Partisane der unteren Militär-
grade war noch immer 2^ Meter lang (Abb. 6). Mit
dem Aufgeben der Pike war auch das früher im wesent-
lichen entscheidende Handgemenge ein überwundener
Standpunkt, das Feuer hatte gesiegt.
die 5 Meter langen Lanzen der Pikeniere, die
bis zu jener Zeit den Kern der älteren Heere
bildeten, und noch während des Jahrhunderts, in
dem Montecuccoli lebte, ein Drittel des Fußvolkes
ausmachten. Die Stützgabel war zwar noch nicht
völlig weggefallen, aber doch entbehrlich gewor¬
den; fertige Patronen erhöhten die Geschwindigkeit
des Feuerns; die schwerfällige zweifelhafte Lun¬
tenzündung, die ein genaues Zielen fast unmög¬
lich scheinen läßt, war durch das Steinschloß er¬
setzt, aber den Pikenier konnte die Infanterie
noch nicht missen. Regen und anderes Unwetter
machte sie unter Umständen nahezu wirkungs¬
los. Als Gustav Adolf von Schweden mit seinen
strenggeschulten Musketieren auftrat, liefen die
deutschen Soldaten noch nach jedem Schuß, den
sie abgegeben hatten, hinter die Front ihrer Abtei-
lungen, um dort erst wieder umständlich zu laden.
Vor der Schlachtlinie bewegten sich in dieser
Zeit die Schlachtschwertierer, um mit ihren
langen Zweihändern die ihnen entgegen star¬
renden Spieße niederzuhauen und Gassen zu
bilden, durch welche die Rondachierer mit eiser¬
nen Rundschilden und Spitzschwertern sich in
die hart zusammen gedrängten Langspießer-
massen einzubohren versuchten. An den Flügeln
der im Geviert aufgestellten Haufen arbeitete
das Drittel der Schützen, Musketierer, Haken-
und Halbhakenschützen mit ihren Feuerrohren.
Im bayrischen Regiment Erlach sollte jeder Pikenier neben seinem Lang-
spieß noch eine feuerschlagende Büchse tragen, doch war dies nicht die
Regel. So fochten Musketiere und Pikeniere lange Jahrzehnte hindurch
zusammen, die Pikenmänner boten den Schlachthaufen den eigentlichen
Stand, die Schützen scharmützelten vor und neben diesen Abteilungen.
Mit der zunehmenden Ausschaltung der schweren Musketen, mit dem
allgemeineren Gebrauch leichterer Kaliber, die
nach ihrem Erzeuger, dem Nürnberger Büchsen¬
macher Kuhfueß benannt wurden, kam die
Bezeichnung Musketier gegenüber den Spie߬
trägern bald allgemein auf. War eine Auf-
legegabel, die „Forchette", bei den schweren
Waffen unerläßlich gewesen, so gebrauchte sie
der Träger leichterer Kaliber aus Bequemlich¬
keit und um ruhigere Schußabgabe zu ermög¬
lichen, noch bis in die zweite Hälfte des. sieb-
zehnten Jahrhunderts.
Als merkwürdige Sonderformen tauchten
schon um 1640 „Musketen mit Piken und
Schwertern"auf, Versuche, die Stoß- und Hieb¬
waffe mit dem Feuerrohr zu verschmelzen.
Das geschah zuerst in Frankreich, wo man
den mit der Form seines hölzernen Hand¬
griffs sich dazu eignenden spanisch-südfran-
zösischen Nationaldolch, den Dolch von
Bayonne, in den Lauf steckte, womit das
„Spundbajonett" gegeben war. Spanier oder
Franzosen sollen diese Art der Verbindung
zweier Waffen in Ostindien bei den Malaien
gesehen haben, die eine Stichwaffe, „Kris"
genannt, auf Gewehre pflanzten. Karl XII.
benützte das Bajonett zuerst beim Massen¬
angriff. Die Versuche erwiesen aber, daß die
WiderstandskraftfürdenErnstfallnicht genügte,
und man gab sie auf. Auch das von den Waf¬
fenmachern der Zeit hartnäckig verfolgte Pro¬
blem, durch Rückladung, statt Vorderladung,
größere Geschwindigkeit beim Schießen zu erzielen, fand keine dauernd
standhaltende Lösung. Gleiches Schicksal war dem Versuch des Mainzer
Büchsenmachers Peter Diringer beschieden, der an die kurbayrische Kriegs-
verwaltung ein „Rückladegewehr" einsandte, bei dem das Laden an der
unteren Laufhälfte vorgenommen wurde und Pulver und davorgesetzte
Kugel durch einen birnförmigen Zapfen festgehalten waren. Der Philosoph
Leibniz sagt in seiner Wiener Reisebeschreibung von
1687, daß Bayern in Unterhandlungen mit einem
Augsburger stehe, um sich „sonderbare Gewehre liefern
zu lassen, die mit sechs oder acht Kugeln von hinten ge-
laden würden". Das Unvermögen, gasdichte Abschlüsse
herzustellen, ließ jedoch alle Hinterladeversuche immer
wieder scheitern. Feinere Gewehrkolben waren zu
l. 1917.