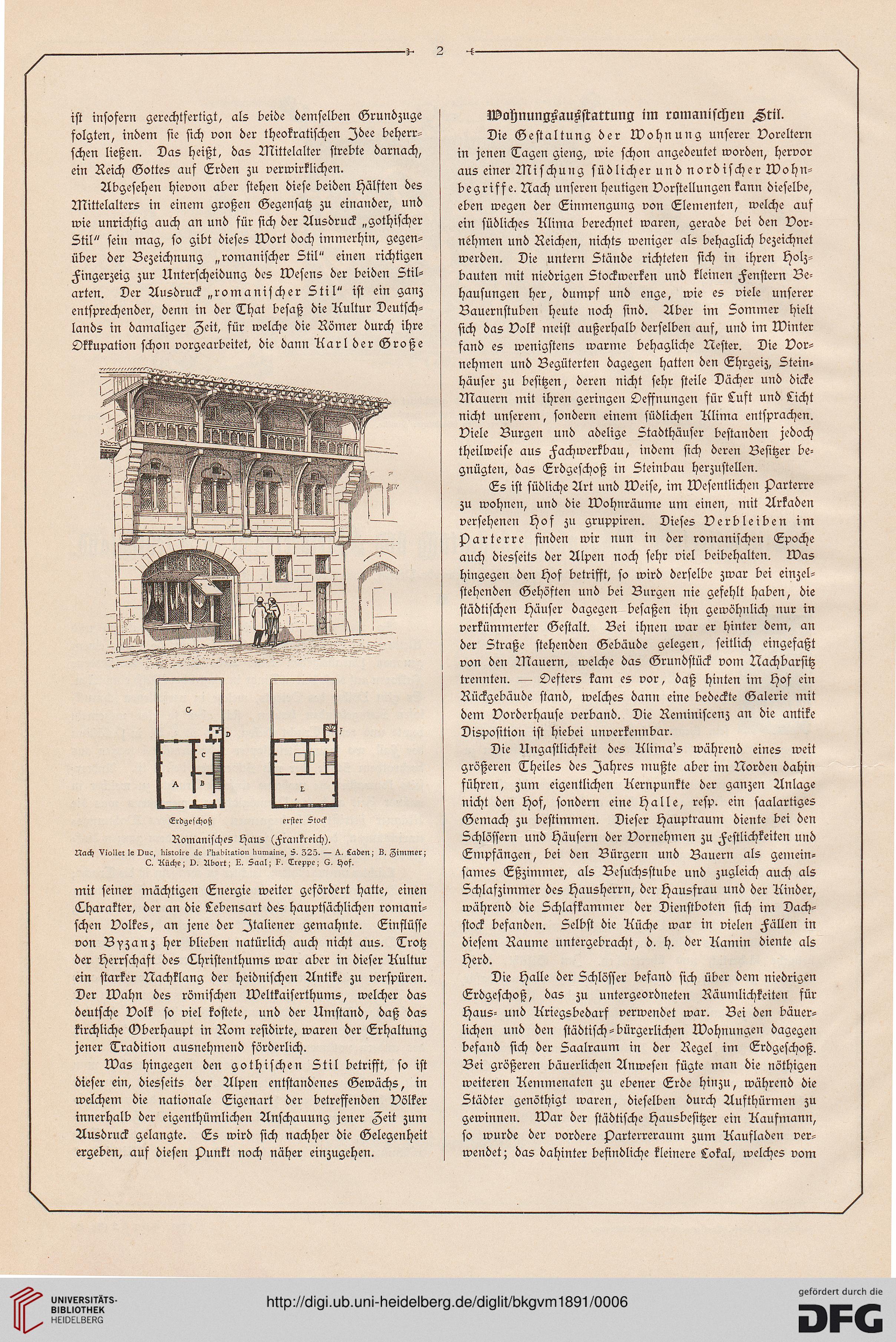ist insofern gerechtfertigt, als beide demselben Grundzuge
folgten, indem sie sich von der theokratischen Idee beherr-
schen ließen. Das heißt, das Mittelalter strebte darnach,
ein Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.
Abgesehen hievon aber stehen diese beiden Hälften des
Mittelalters in einem großen Gegensatz zu einander, und
wie unrichtig auch an und für sich der Ausdruck „gothischer
Stil" sein mag, so gibt dieses Wort doch immerhin, gegen-
über der Bezeichnung „romanischer Stil" einen richtigen
Fingerzeig zur Unterscheidung des Wesens der beiden Stil-
arten. Der Ausdruck „romanischer Stil" ist ein ganz
entsprechender, denn in der That besaß die Kultur Deutsch-
lands in damaliger Zeit, für welche die Römer durch ihre
Okkupation schon vorgearbeitet, die dann Karl der Große
Erdgeschoß erster Stock
Romanisches lsaus (Frankreich).
Nach Violler le Duc, histoire de l’habitation humaine, S. 525. — A. Laden; B. Zimmer;
C. Küche; D. Abort; E. Saal; F. Treppe; G. yof.
mit seiner mächtigen Energie weiter gefördert hatte, einen
Eharakter, der an die Lebensart des hauptsächlichen romani-
schen Volkes, an jene der Italiener gemahnte. Einflüsse
von Byzanz her blieben natürlich auch nicht aus. Trotz
der Herrschaft des Ehristenthums war aber in dieser Kultur
ein starker Nachklang der heidnischen Antike zu verspüren.
Der Wahn des römischen Weltkaiserthums, welcher das
deutsche Volk so viel kostete, und der Umstand, daß das
kirchliche (Oberhaupt in Rom residirte, waren der Erhaltung
jener Tradition ausnehmend förderlich.
Was hingegen den gothischeu Stil betrifft, so ist
dieser ein, diesseits der Alpen entstandenes Gewächs, in
welchem die nationale Eigenart der betreffenden Völker
innerhalb der eigenthümlichen Anschauung jener Zeit zum
Ausdruck gelangte. Es wird sich nachher die Gelegenheit
ergeben, auf diesen Punkt noch näher einzugehen.
WohmmgFauFstattung im romanischen Stil.
Die Gestaltung der Wohnung unserer Voreltern
in jenen Tagen gieng, wie schon angedeutet worden, hervor
aus einer Mischung südlicher und nordischer Wohn-
begriffe. Nach unseren heutigen Vorstellungen kann dieselbe,
eben wegen der Einmengung von Elementen, welche auf
ein südliches Klima berechnet waren, gerade bei den Vor-
nehmen und Reichen, nichts weniger als behaglich bezeichnet
werden. Die untern Stände richteten sich in ihren Holz-
bauten mit niedrigen Stockwerken und kleinen Fenstern Be-
hausungen her, dumpf und enge, wie es viele unserer
Bauernstuben heute noch sind. Aber im Sommer hielt
sich das Volk meist außerhalb derselben auf, und im Winter
fand es wenigstens warine behagliche Nester. Die Vor-
nehmen und Begüterten dagegen hatten den Ehrgeiz, Stein-
häuser zu besitzen, deren nicht sehr steile Dächer und dicke
Mauern mit ihren geringen Oeffnungen für Luft und Licht
nicht unserem, sondern einem südlichen Klima entsprachen.
Viele Burgen und adelige Stadthäuser bestanden jedoch
theilweise aus Fachwerkbau, indem sich deren Besitzer be-
gnügten, das Erdgeschoß in Steinbau herzustellen.
Ls ist südliche Art und weise, im wesentlichen Parterre
zu wohnen, und die Wohnräume um einen, mit Arkaden
versehenen Hof zu gruppiren. Dieses Verbleiben im
parterre finden wir nun in der romanischen Epoche
auch diesseits der Alpen noch sehr viel beibehalten, was
hingegen den Hof betrifft, so wird derselbe zwar bei einzel-
stehenden Gehöften und bei Burgen nie gefehlt haben, die
städtischen Häuser dagegen besaßen ihn gewöhnlich nur in
verkümmerter Gestalt. Bei ihnen war er hinter dem, an
der Straße stehenden Gebäude gelegen, seitlich eingefaßt
von den Mauern, welche das Grundstück vom Nachbarsitz
trennte». •— Oesters kam es vor, daß hinten im Hof ein
Rückgebäude stand, welches dann eine bedeckte Galerie mit
dem Vorderhause verband. Die Reminiscenz an die antike
Disposition ist hiebei unverkennbar.
Die Ungastlichkeit des Klima's während eines weit
größeren Theiles des Zahres mußte aber im Norden dahin
führen, zum eigentlichen Kernpunkte der ganzen Anlage
nicht den Hof, sondern eine Halle, resp. ein saalartiges
Gemach zu bestimmen. Dieser Hauptraum diente bei den
Schlössern und Däusern der Vornehmen zu Festlichkeiten und
Empfängen, bei den Bürgern und Bauern als gemein-
sames Eßzimmer, als Besuchsstube und zugleich auch als
Schlafzimmer des Hausherrn, der Hausfrau und der Kinder,
während die Schlafkammer der Dienstboten sich im Dach-
stock befanden. Selbst die Küche war in vielen Fällen in
diesem Raume untergebracht, d. h. der Kamin diente als
Herd.
Die Halle der Schlösser befand sich über dem niedrigen
Erdgeschoß, das zu untergeordneten Räumlichkeiten für
Haus- und Kriegsbedarf verwendet war. Bei den bäuer-
lichen und den städtisch-bürgerlichen Wohnungen dagegen
befand sich der Saalraum in der Regel im Erdgeschoß.
Bei größeren bäuerlichen Anwesen fügte man die nöthigen
weiteren Kenimenaten zu ebener Erde hinzu, während die
Städter genöthigt waren, dieselben durch Aufthürmen zu
gewinnen. War der städtische Hausbesitzer ein Kaufmann,
so wurde der vordere Parterreraum zum Kaufladen ver-
wendet ; das dahinter befindliche kleinere Lokal, welches vom
folgten, indem sie sich von der theokratischen Idee beherr-
schen ließen. Das heißt, das Mittelalter strebte darnach,
ein Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen.
Abgesehen hievon aber stehen diese beiden Hälften des
Mittelalters in einem großen Gegensatz zu einander, und
wie unrichtig auch an und für sich der Ausdruck „gothischer
Stil" sein mag, so gibt dieses Wort doch immerhin, gegen-
über der Bezeichnung „romanischer Stil" einen richtigen
Fingerzeig zur Unterscheidung des Wesens der beiden Stil-
arten. Der Ausdruck „romanischer Stil" ist ein ganz
entsprechender, denn in der That besaß die Kultur Deutsch-
lands in damaliger Zeit, für welche die Römer durch ihre
Okkupation schon vorgearbeitet, die dann Karl der Große
Erdgeschoß erster Stock
Romanisches lsaus (Frankreich).
Nach Violler le Duc, histoire de l’habitation humaine, S. 525. — A. Laden; B. Zimmer;
C. Küche; D. Abort; E. Saal; F. Treppe; G. yof.
mit seiner mächtigen Energie weiter gefördert hatte, einen
Eharakter, der an die Lebensart des hauptsächlichen romani-
schen Volkes, an jene der Italiener gemahnte. Einflüsse
von Byzanz her blieben natürlich auch nicht aus. Trotz
der Herrschaft des Ehristenthums war aber in dieser Kultur
ein starker Nachklang der heidnischen Antike zu verspüren.
Der Wahn des römischen Weltkaiserthums, welcher das
deutsche Volk so viel kostete, und der Umstand, daß das
kirchliche (Oberhaupt in Rom residirte, waren der Erhaltung
jener Tradition ausnehmend förderlich.
Was hingegen den gothischeu Stil betrifft, so ist
dieser ein, diesseits der Alpen entstandenes Gewächs, in
welchem die nationale Eigenart der betreffenden Völker
innerhalb der eigenthümlichen Anschauung jener Zeit zum
Ausdruck gelangte. Es wird sich nachher die Gelegenheit
ergeben, auf diesen Punkt noch näher einzugehen.
WohmmgFauFstattung im romanischen Stil.
Die Gestaltung der Wohnung unserer Voreltern
in jenen Tagen gieng, wie schon angedeutet worden, hervor
aus einer Mischung südlicher und nordischer Wohn-
begriffe. Nach unseren heutigen Vorstellungen kann dieselbe,
eben wegen der Einmengung von Elementen, welche auf
ein südliches Klima berechnet waren, gerade bei den Vor-
nehmen und Reichen, nichts weniger als behaglich bezeichnet
werden. Die untern Stände richteten sich in ihren Holz-
bauten mit niedrigen Stockwerken und kleinen Fenstern Be-
hausungen her, dumpf und enge, wie es viele unserer
Bauernstuben heute noch sind. Aber im Sommer hielt
sich das Volk meist außerhalb derselben auf, und im Winter
fand es wenigstens warine behagliche Nester. Die Vor-
nehmen und Begüterten dagegen hatten den Ehrgeiz, Stein-
häuser zu besitzen, deren nicht sehr steile Dächer und dicke
Mauern mit ihren geringen Oeffnungen für Luft und Licht
nicht unserem, sondern einem südlichen Klima entsprachen.
Viele Burgen und adelige Stadthäuser bestanden jedoch
theilweise aus Fachwerkbau, indem sich deren Besitzer be-
gnügten, das Erdgeschoß in Steinbau herzustellen.
Ls ist südliche Art und weise, im wesentlichen Parterre
zu wohnen, und die Wohnräume um einen, mit Arkaden
versehenen Hof zu gruppiren. Dieses Verbleiben im
parterre finden wir nun in der romanischen Epoche
auch diesseits der Alpen noch sehr viel beibehalten, was
hingegen den Hof betrifft, so wird derselbe zwar bei einzel-
stehenden Gehöften und bei Burgen nie gefehlt haben, die
städtischen Häuser dagegen besaßen ihn gewöhnlich nur in
verkümmerter Gestalt. Bei ihnen war er hinter dem, an
der Straße stehenden Gebäude gelegen, seitlich eingefaßt
von den Mauern, welche das Grundstück vom Nachbarsitz
trennte». •— Oesters kam es vor, daß hinten im Hof ein
Rückgebäude stand, welches dann eine bedeckte Galerie mit
dem Vorderhause verband. Die Reminiscenz an die antike
Disposition ist hiebei unverkennbar.
Die Ungastlichkeit des Klima's während eines weit
größeren Theiles des Zahres mußte aber im Norden dahin
führen, zum eigentlichen Kernpunkte der ganzen Anlage
nicht den Hof, sondern eine Halle, resp. ein saalartiges
Gemach zu bestimmen. Dieser Hauptraum diente bei den
Schlössern und Däusern der Vornehmen zu Festlichkeiten und
Empfängen, bei den Bürgern und Bauern als gemein-
sames Eßzimmer, als Besuchsstube und zugleich auch als
Schlafzimmer des Hausherrn, der Hausfrau und der Kinder,
während die Schlafkammer der Dienstboten sich im Dach-
stock befanden. Selbst die Küche war in vielen Fällen in
diesem Raume untergebracht, d. h. der Kamin diente als
Herd.
Die Halle der Schlösser befand sich über dem niedrigen
Erdgeschoß, das zu untergeordneten Räumlichkeiten für
Haus- und Kriegsbedarf verwendet war. Bei den bäuer-
lichen und den städtisch-bürgerlichen Wohnungen dagegen
befand sich der Saalraum in der Regel im Erdgeschoß.
Bei größeren bäuerlichen Anwesen fügte man die nöthigen
weiteren Kenimenaten zu ebener Erde hinzu, während die
Städter genöthigt waren, dieselben durch Aufthürmen zu
gewinnen. War der städtische Hausbesitzer ein Kaufmann,
so wurde der vordere Parterreraum zum Kaufladen ver-
wendet ; das dahinter befindliche kleinere Lokal, welches vom