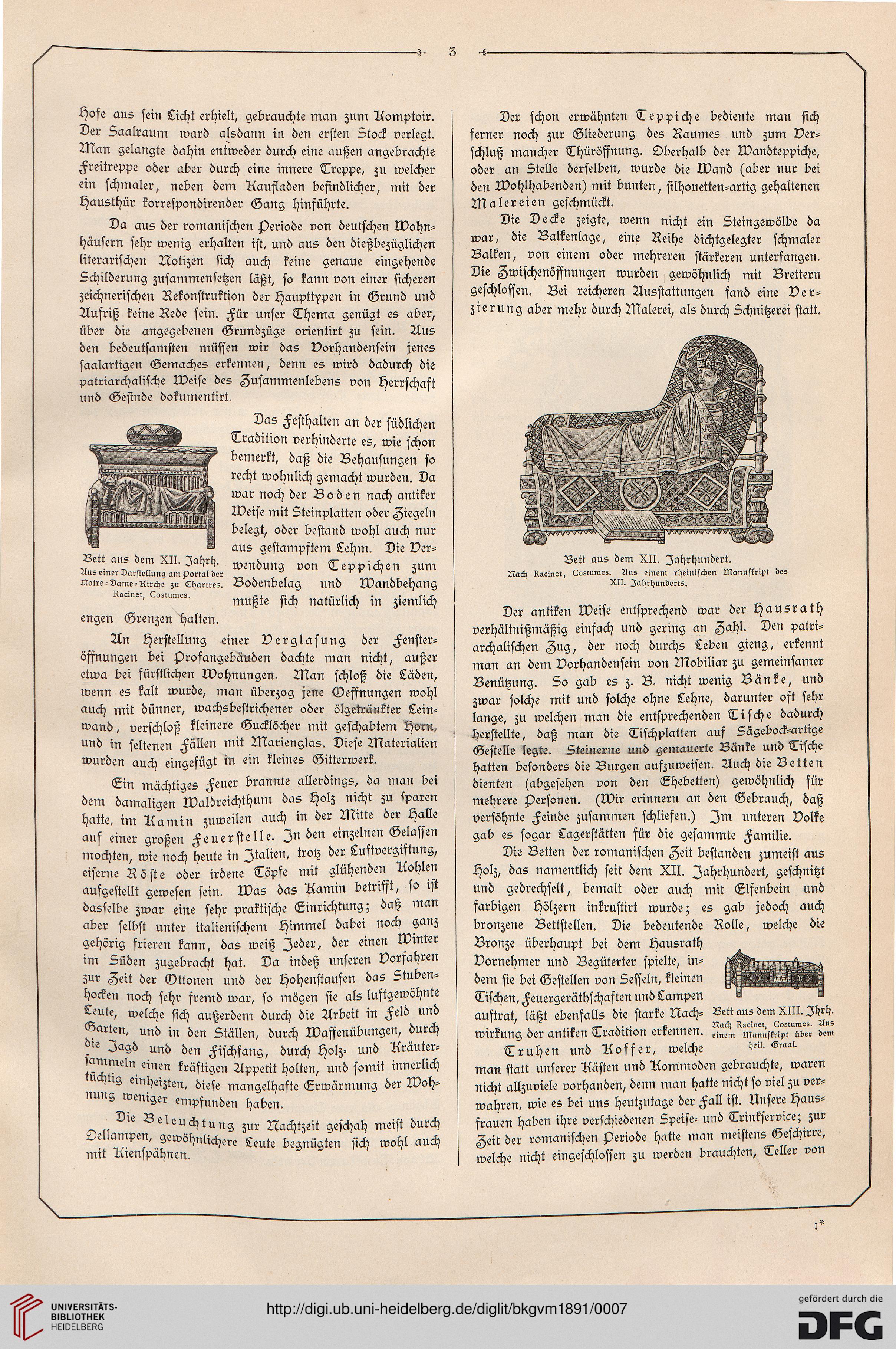3
Bett aus dem XII. Iahrh.
Aus einer Darstellung am j)ortal der
Notre-Dame-Kirche zu Lhartres.
Raciner, Losrumes.
Hofe aus sein Licht erhielt, gebrauchte man zun: Komptoir.
Der Saalraum ward alsdann in den ersten Stock verlegt.
Man gelangte dahin entweder durch eine außen angebrachte
Freitreppe oder aber durch eine innere Treppe, zu welcher
ein schmaler, neben dem Kaufladen besindlicher, mit der
Hausthür korrespondirender Gang hinführte.
Da aus der romanischen Periode von deutschen Wohn-
häusern sehr wenig erhalten ist, und aus den dießbezüglichen
literarischen Notizen sich auch keine genaue eingehende
Schilderung zusammensetzen läßt, so kann von einer sicheren
zeichnerischen Rekonstruktion der haupttypen in Grund und
Aufriß keine Rede sein. Für unser Thema genügt es aber,
über die angegebenen Grundzüge orientirt zu fein. Aus
den bedeutsamsten müssen wir das Vorhandensein jenes
saalartigen Gemaches erkennen, denn es wird dadurch die
patriarchalische weise des Zusammenlebens von Herrschaft
und Gesinde dokumentirt.
Das Festhalten an der südlichen
Tradition verhinderte es, wie schon
bemerkt, daß die Behausungen so
recht wohnlich gemacht wurden. Da
war noch der Boden nach antiker
weise mit Steinplatten oder Ziegeln
belegt, oder bestand wohl auch nur
aus gestampftem Lehm. Die Ver-
wendung von Teppichen zum
Bodenbelag und Wandbehang
mußte sich natürlich in ziemlich
engen Grenzen halten.
An Herstellung einer Verglasung der Fenster-
öffnungen bei Profangebäuden dachte man nicht, außer
etwa bei fürstlichen Wohnungen. Man schloß die Läden,
wenn es kalt wurde, man überzog jene Veffnungen wohl
auch mit dünner, wachsbeftrichener oder ölgetränkter Lein-
wand, verschloß kleinere Gucklöcher mit geschabten: Horn,
und in seltenen Fällen mit Marienglas. Diese Materialien
wurden auch eingefügt in ein kleines Gitterwerk.
Ein mächtiges Feuer brannte allerdings, da man bei
dem damaligen Waldreichthum das Holz nicht zu sparen
hatte, in: Kamin zuweilen auch in der Mitte der Halle
auf einer großen Feuer stelle. Zn den einzelnen Gelassen
mochten, wie noch heute in Ztalien, trotz der Luftvergiftung,
eisern- Röste oder irdene Töpfe mit glühenden Aohlen
ausgestellt gewesen sein, was das Kamin betrifft, so ist
dasselbe zwar eine sehr praktische Einrichtung; daß :nan
aber selbst unter italienischen: Himmel dabei noch ganz
gehörig frieren kann, das weiß Zeder, der einen Winter
im Süden zugebracht hat. Da indeß unseren Vorfahren
zur Zeit der Dttonen und der Hohenstaufen das Stuben-
hocken noch sehr fremd war, so mögen sie als luftgewöhnte
^eute, welche sich außerdem durch die Arbeit in Feld und
Karten, und in den Ställen, durch Waffenübungen, durch
und den Fischfang, durch Holz- und Kräuter-
lammeln einen kräftigen Appetit holten, und somit innerlich
uchtig einheizten, diese mangelhafte Erwärmung der Woh-
nung weniger empfunden haben.
Dll Beleuchtung zur Nachtzeit geschah meist durch
C a”ipC’1' gewöhnlichere Leute begnügten sich wohl auch
m:t Kienspahnen.
Der schon erwähnten Teppiche bediente man sich
ferner noch zur Gliederung des Raumes uud zum Ver-
schluß mancher Thüröffnung. Oberhalb der Wandteppiche,
oder an Stelle derselben, wurde die wand (aber nur bei
den Wohlhabenden) n:it bunten, silhouetten-artig gehaltenen
Malereien geschmückt.
Die Decke zeigte, wenn nicht ein Steingewölbe da
war, die Balkenlage, eine Reihe dichtgelegter schinaler
Balken, von einem oder mehreren stärkeren unterfangen.
Die Zwischenöffnungen wurden gewöhnlich mit Brettern
geschloffen. Bei reicheren Ausstattungen fand eine Ver-
zierung aber mehr durch Malerei, als durch Schnitzerei statt.
Bett aus dem XII. Jahrhundert.
Nach Racinet, Costumes. Aus einem rheinischen Manuskript des
XII. Jahrhunderts.
Der antiken weise entsprechend war der Hausrath
verhältnißinäßig einfach und gering an Zahl. Den patri-
archalischen Zug, der noch durchs Leben gieng, erkennt
man an dem Vorhandensein von Mobiliar zu gemeinsamer
Benützung. So gab es z. B. nicht wenig Bänke, und
zwar solche mit und solche ohne Lehne, darunter oft sehr
lange, zu welchen man die entsprechenden Tische dadurch
hcrstellte, daß man die Tischplatten auf Sägebock-artige
Gestelle legte. Steinerne und gemauerte Bänke und Tische
hatten besonders die Burgen auszuweisen. Auch die Betten
dienten (abgesehen von den Ehebetten) gewöhnlich für
mehrere Personen, (wir erinnern an den Gebrauch, daß
versöhnte Feinde zusammen schliefen.) Zm unteren Volke
gab es sogar Lagerstätten für die gesammte Familie.
Die Betten der romanischen Zeit bestanden zumeist aus
Holz, das namentlich seit dem XII. Zahrhundert, geschnitzt
uud gedrechselt, bemalt oder auch mit Elfenbein und
farbigen hölzern inkrustirt wurde; es gab jedoch auch
bronzene Bettstellen. Die bedeutende Rolle, welche die
Bronze überhaupt bei den: Hausrath
vornehmer und Begüterter spielte, in-
dcn: sie bei Gestellen von Sesseln, kleinen
Tischen, Feuergeräthschaften und Lampen
auftrat, läßt ebenfalls die starke Nach- Bett aus dem XIII. Jhrh.
Wirkung der antiken Tradition erkennen. »em
Truhen und Koffer, welche ®raaI-
man statt unserer Kästen und Kommoden gebrauchte, waren
nicht allzuviele vorhanden, denn man hatte nicht so viel zu ver-
wahren, wie es bei uns heutzutage der Fall ist. Unsere Haus-
frauen haben ihre verschiedenen Speise- und Trinkservice; zur
Zeit der romanischen Periode hatte man meistens Geschirre,
welche nicht eingeschlossen zu werden brauchten, Teller von
Bett aus dem XII. Iahrh.
Aus einer Darstellung am j)ortal der
Notre-Dame-Kirche zu Lhartres.
Raciner, Losrumes.
Hofe aus sein Licht erhielt, gebrauchte man zun: Komptoir.
Der Saalraum ward alsdann in den ersten Stock verlegt.
Man gelangte dahin entweder durch eine außen angebrachte
Freitreppe oder aber durch eine innere Treppe, zu welcher
ein schmaler, neben dem Kaufladen besindlicher, mit der
Hausthür korrespondirender Gang hinführte.
Da aus der romanischen Periode von deutschen Wohn-
häusern sehr wenig erhalten ist, und aus den dießbezüglichen
literarischen Notizen sich auch keine genaue eingehende
Schilderung zusammensetzen läßt, so kann von einer sicheren
zeichnerischen Rekonstruktion der haupttypen in Grund und
Aufriß keine Rede sein. Für unser Thema genügt es aber,
über die angegebenen Grundzüge orientirt zu fein. Aus
den bedeutsamsten müssen wir das Vorhandensein jenes
saalartigen Gemaches erkennen, denn es wird dadurch die
patriarchalische weise des Zusammenlebens von Herrschaft
und Gesinde dokumentirt.
Das Festhalten an der südlichen
Tradition verhinderte es, wie schon
bemerkt, daß die Behausungen so
recht wohnlich gemacht wurden. Da
war noch der Boden nach antiker
weise mit Steinplatten oder Ziegeln
belegt, oder bestand wohl auch nur
aus gestampftem Lehm. Die Ver-
wendung von Teppichen zum
Bodenbelag und Wandbehang
mußte sich natürlich in ziemlich
engen Grenzen halten.
An Herstellung einer Verglasung der Fenster-
öffnungen bei Profangebäuden dachte man nicht, außer
etwa bei fürstlichen Wohnungen. Man schloß die Läden,
wenn es kalt wurde, man überzog jene Veffnungen wohl
auch mit dünner, wachsbeftrichener oder ölgetränkter Lein-
wand, verschloß kleinere Gucklöcher mit geschabten: Horn,
und in seltenen Fällen mit Marienglas. Diese Materialien
wurden auch eingefügt in ein kleines Gitterwerk.
Ein mächtiges Feuer brannte allerdings, da man bei
dem damaligen Waldreichthum das Holz nicht zu sparen
hatte, in: Kamin zuweilen auch in der Mitte der Halle
auf einer großen Feuer stelle. Zn den einzelnen Gelassen
mochten, wie noch heute in Ztalien, trotz der Luftvergiftung,
eisern- Röste oder irdene Töpfe mit glühenden Aohlen
ausgestellt gewesen sein, was das Kamin betrifft, so ist
dasselbe zwar eine sehr praktische Einrichtung; daß :nan
aber selbst unter italienischen: Himmel dabei noch ganz
gehörig frieren kann, das weiß Zeder, der einen Winter
im Süden zugebracht hat. Da indeß unseren Vorfahren
zur Zeit der Dttonen und der Hohenstaufen das Stuben-
hocken noch sehr fremd war, so mögen sie als luftgewöhnte
^eute, welche sich außerdem durch die Arbeit in Feld und
Karten, und in den Ställen, durch Waffenübungen, durch
und den Fischfang, durch Holz- und Kräuter-
lammeln einen kräftigen Appetit holten, und somit innerlich
uchtig einheizten, diese mangelhafte Erwärmung der Woh-
nung weniger empfunden haben.
Dll Beleuchtung zur Nachtzeit geschah meist durch
C a”ipC’1' gewöhnlichere Leute begnügten sich wohl auch
m:t Kienspahnen.
Der schon erwähnten Teppiche bediente man sich
ferner noch zur Gliederung des Raumes uud zum Ver-
schluß mancher Thüröffnung. Oberhalb der Wandteppiche,
oder an Stelle derselben, wurde die wand (aber nur bei
den Wohlhabenden) n:it bunten, silhouetten-artig gehaltenen
Malereien geschmückt.
Die Decke zeigte, wenn nicht ein Steingewölbe da
war, die Balkenlage, eine Reihe dichtgelegter schinaler
Balken, von einem oder mehreren stärkeren unterfangen.
Die Zwischenöffnungen wurden gewöhnlich mit Brettern
geschloffen. Bei reicheren Ausstattungen fand eine Ver-
zierung aber mehr durch Malerei, als durch Schnitzerei statt.
Bett aus dem XII. Jahrhundert.
Nach Racinet, Costumes. Aus einem rheinischen Manuskript des
XII. Jahrhunderts.
Der antiken weise entsprechend war der Hausrath
verhältnißinäßig einfach und gering an Zahl. Den patri-
archalischen Zug, der noch durchs Leben gieng, erkennt
man an dem Vorhandensein von Mobiliar zu gemeinsamer
Benützung. So gab es z. B. nicht wenig Bänke, und
zwar solche mit und solche ohne Lehne, darunter oft sehr
lange, zu welchen man die entsprechenden Tische dadurch
hcrstellte, daß man die Tischplatten auf Sägebock-artige
Gestelle legte. Steinerne und gemauerte Bänke und Tische
hatten besonders die Burgen auszuweisen. Auch die Betten
dienten (abgesehen von den Ehebetten) gewöhnlich für
mehrere Personen, (wir erinnern an den Gebrauch, daß
versöhnte Feinde zusammen schliefen.) Zm unteren Volke
gab es sogar Lagerstätten für die gesammte Familie.
Die Betten der romanischen Zeit bestanden zumeist aus
Holz, das namentlich seit dem XII. Zahrhundert, geschnitzt
uud gedrechselt, bemalt oder auch mit Elfenbein und
farbigen hölzern inkrustirt wurde; es gab jedoch auch
bronzene Bettstellen. Die bedeutende Rolle, welche die
Bronze überhaupt bei den: Hausrath
vornehmer und Begüterter spielte, in-
dcn: sie bei Gestellen von Sesseln, kleinen
Tischen, Feuergeräthschaften und Lampen
auftrat, läßt ebenfalls die starke Nach- Bett aus dem XIII. Jhrh.
Wirkung der antiken Tradition erkennen. »em
Truhen und Koffer, welche ®raaI-
man statt unserer Kästen und Kommoden gebrauchte, waren
nicht allzuviele vorhanden, denn man hatte nicht so viel zu ver-
wahren, wie es bei uns heutzutage der Fall ist. Unsere Haus-
frauen haben ihre verschiedenen Speise- und Trinkservice; zur
Zeit der romanischen Periode hatte man meistens Geschirre,
welche nicht eingeschlossen zu werden brauchten, Teller von