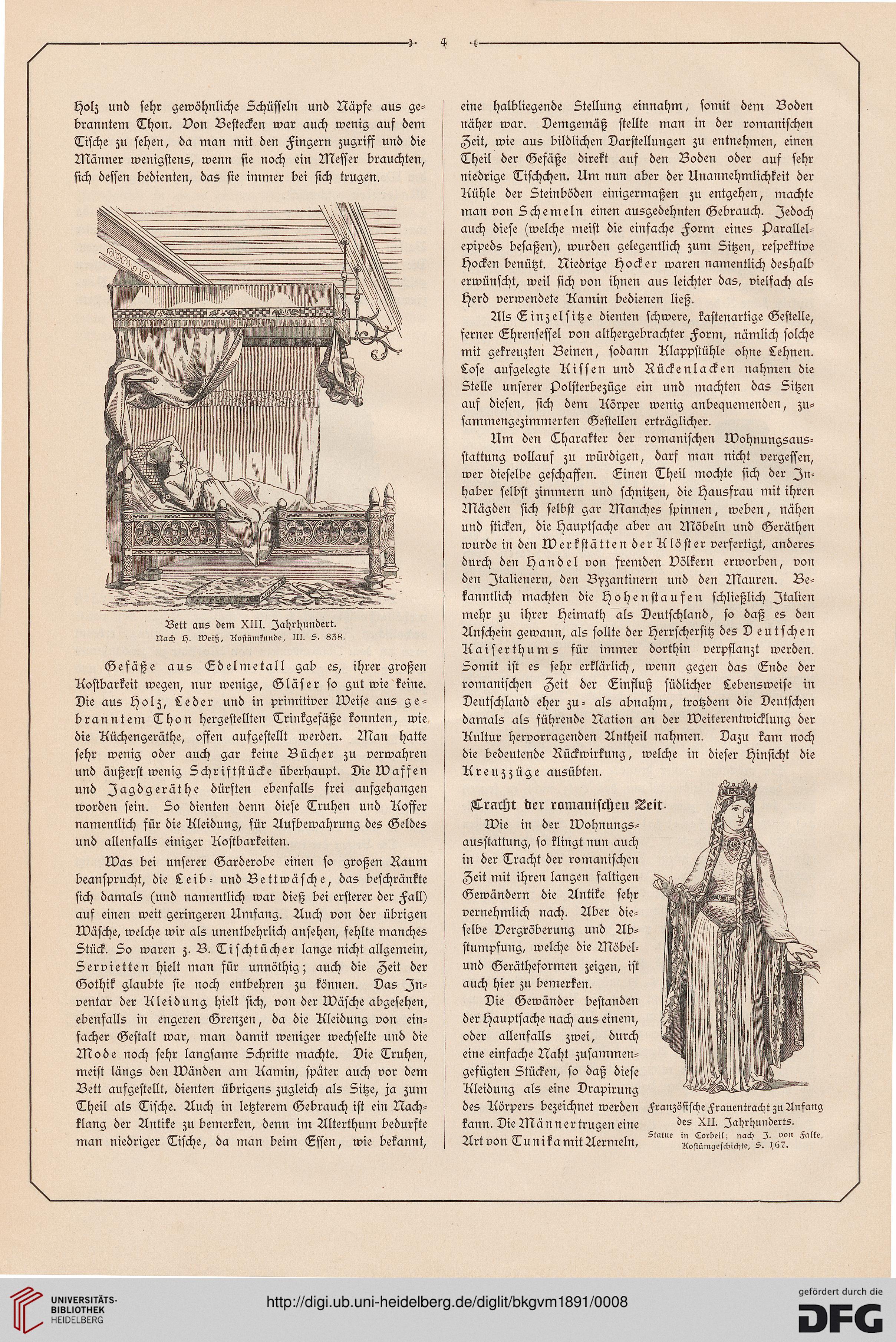Holz und sehr gewöhnliche Schüsseln und Näpfe aus ge-
branntem Thon. Von Bestecken war auch wenig auf dem
Tische zu sehen, da man mit den Fingern Zugriff und die
Männer wenigstens, wenn sie noch ein Messer brauchten,
sich dessen bedienten, das sie immer bei sich trugen.
Bett aus dem XIII. Jahrhundert.
Nach weiß, Aostümkunde, IN. S. 838.
Gefäße aus Edelmetall gab es, ihrer großen
Kostbarkeit wegen, nur wenige, Gläser so gut wie keine.
Die aus Holz, Leder und in primitiver Weise aus ge-
branntem Thon hergestellten Trinkgefäße konnten, wie
die Küchengeräthe, offen aufgestellt werden. Man hatte
sehr wenig oder auch gar keine Bücher zu verwahren
und äußerst wenig Schriftstücke überhaupt. Die Waffen
und Iagdgeräthe dürften ebenfalls frei aufgehangen
worden fein. So dienten denn diese Truhen und Koffer
namentlich für die Kleidung, für Aufbewahrung des Geldes
und allenfalls einiger Kostbarkeiten.
Was bei unserer Garderobe einen so großen Raum
beansprucht, die Leib- und Bettwäsche, das beschränkte
sich damals (und namentlich war dieß bei ersterer der Fall)
auf einen weit geringeren Umfang. Auch von der übrigen
Wäsche, welche wir als unentbehrlich anfshen, fehlte manches
Stück. So waren z. B. Tischtücher lange nicht allgemein,
Servietten hielt man für unnöthig; auch die Zeit der
Gothik glaubte sie noch entbehren zu können. Das In-
ventar der Kleidung hielt sich, von der Wäsche abgesehen,
ebenfalls in engeren Grenzen, da die Kleidung von ein-
facher Gestalt war, man damit weniger wechselte und die
Mode noch sehr langsame Schritte machte. Die Truhen,
meist längs den Wänden am Kamin, später auch vor dem
Bett aufgestellt, dienten übrigens zugleich als Sitze, ja zum
Theil als Tische. Auch in letzterem Gebrauch ist ein Nach-
klang der Antike zu bemerken, denn im Alterthum bedurfte
man niedriger Tische, da man beim Essen, wie bekannt,
eine halbliegende Stellung einnahm, somit dem Boden
näher war. Demgemäß stellte man in der romanischen
Zeit, wie aus bildlichen Darstellungen zu entnehmen, einen
Theil der Gefäße direkt auf den Boden oder auf sehr
niedrige Tischchen. Km nun aber der Unannehmlichkeit der
Kühle der Steinböden einigermaßen zu entgehen, machte
man von Schemeln einen ausgedehnten Gebrauch. Jedoch
auch diese (welche meist die einfache Form eines j)arallel-
epipeds besaßen), wurden gelegentlich zum Sitzen, respektive
Hocken benützt. Niedrige Hocker waren namentlich deshalb
erwünscht, weil sich von ihnen aus leichter das, vielfach als
Herd verwendete Kamin bedienen ließ.
Als Einzel fitze dienten schwere, kastenartige Gestelle,
ferner Ehrensessel von althergebrachter Form, nämlich solche
mit gekreuzten Beinen, sodann Klappstühle ohne Lehnen.
Lose aufgelegte Kissen und Rückenlacken nahmen die
Stelle unserer Polsterbezüge ein und machten das Sitzen
auf diesen, sich dem Körper wenig anbequemenden, zu-
sammengezimmerten Gestellen erträglicher.
Um den Lharakter der romanischen Wohnungsaus-
stattung vollauf zu würdigen, darf man nicht vergessen,
wer dieselbe geschaffen. Einen Theil mochte sich der In-
haber selbst zimmern und schnitzen, die Hausfrau mit ihren
Mägden sich selbst gar Manches spinnen, weben, nähen
und sticken, die Hauptsache aber an Möbeln und Geräthen
wurde in den Werkstätten der Klöster verfertigt, anderes
durch den Handel von fremden Völkern erworben, von
den Italienern, den Byzantinern und den Mauren. Be-
kanntlich machten die Hohenstaufen schließlich Italien
mehr zu ihrer Heimath als Deutschland, so daß es den
Anschein gewann, als sollte der Herrschersitz des D eutschen
Kaiserthums für immer dorthin verpsianzt werden.
Somit ist es sehr erklärlich, wenn gegen das Ende der
romanischen Zeit der Einfluß südlicher Lebensweise in
Deutschland eher zu- als abnahm, trotzdem die Deutschen
damals als führende Nation an der Weiterentwicklung der
Kultur hervorragenden Antheil nahmen. Dazu kanr noch
die bedeutende Rückwirkung, welche in dieser Hinsicht die
Kreuzzüge ausübten.
Kirncht der romanischen Leit.
Wie in der Wohnungs-
ausstattung, so klingt nun auch
in der Tracht der romanischen
Zeit mit ihren langen faltigen
Gewändern die Antike sehr
vernehmlich nach. Aber die-
selbe Vergröberung und Ab-
stumpfung, welche die Möbel-
und Gerätheformcn zeigen, ist
auch hier zu bemerken.
Die Gewänder bestanden
der Hauptsache nach aus einen:,
oder allenfalls zwei, durch
eine einfache Naht zusammen-
gefügten Stücken, so daß diese
Kleidung als eine Drapirung
des Körpers bezeichnet werden Französische Frauentracht zu Anfang
kann. Die Männertrugen eine &es XII. Jahrhunderts.
Art von Tunika mit Hermein, Aostümgeschichte, s. *67.
X
branntem Thon. Von Bestecken war auch wenig auf dem
Tische zu sehen, da man mit den Fingern Zugriff und die
Männer wenigstens, wenn sie noch ein Messer brauchten,
sich dessen bedienten, das sie immer bei sich trugen.
Bett aus dem XIII. Jahrhundert.
Nach weiß, Aostümkunde, IN. S. 838.
Gefäße aus Edelmetall gab es, ihrer großen
Kostbarkeit wegen, nur wenige, Gläser so gut wie keine.
Die aus Holz, Leder und in primitiver Weise aus ge-
branntem Thon hergestellten Trinkgefäße konnten, wie
die Küchengeräthe, offen aufgestellt werden. Man hatte
sehr wenig oder auch gar keine Bücher zu verwahren
und äußerst wenig Schriftstücke überhaupt. Die Waffen
und Iagdgeräthe dürften ebenfalls frei aufgehangen
worden fein. So dienten denn diese Truhen und Koffer
namentlich für die Kleidung, für Aufbewahrung des Geldes
und allenfalls einiger Kostbarkeiten.
Was bei unserer Garderobe einen so großen Raum
beansprucht, die Leib- und Bettwäsche, das beschränkte
sich damals (und namentlich war dieß bei ersterer der Fall)
auf einen weit geringeren Umfang. Auch von der übrigen
Wäsche, welche wir als unentbehrlich anfshen, fehlte manches
Stück. So waren z. B. Tischtücher lange nicht allgemein,
Servietten hielt man für unnöthig; auch die Zeit der
Gothik glaubte sie noch entbehren zu können. Das In-
ventar der Kleidung hielt sich, von der Wäsche abgesehen,
ebenfalls in engeren Grenzen, da die Kleidung von ein-
facher Gestalt war, man damit weniger wechselte und die
Mode noch sehr langsame Schritte machte. Die Truhen,
meist längs den Wänden am Kamin, später auch vor dem
Bett aufgestellt, dienten übrigens zugleich als Sitze, ja zum
Theil als Tische. Auch in letzterem Gebrauch ist ein Nach-
klang der Antike zu bemerken, denn im Alterthum bedurfte
man niedriger Tische, da man beim Essen, wie bekannt,
eine halbliegende Stellung einnahm, somit dem Boden
näher war. Demgemäß stellte man in der romanischen
Zeit, wie aus bildlichen Darstellungen zu entnehmen, einen
Theil der Gefäße direkt auf den Boden oder auf sehr
niedrige Tischchen. Km nun aber der Unannehmlichkeit der
Kühle der Steinböden einigermaßen zu entgehen, machte
man von Schemeln einen ausgedehnten Gebrauch. Jedoch
auch diese (welche meist die einfache Form eines j)arallel-
epipeds besaßen), wurden gelegentlich zum Sitzen, respektive
Hocken benützt. Niedrige Hocker waren namentlich deshalb
erwünscht, weil sich von ihnen aus leichter das, vielfach als
Herd verwendete Kamin bedienen ließ.
Als Einzel fitze dienten schwere, kastenartige Gestelle,
ferner Ehrensessel von althergebrachter Form, nämlich solche
mit gekreuzten Beinen, sodann Klappstühle ohne Lehnen.
Lose aufgelegte Kissen und Rückenlacken nahmen die
Stelle unserer Polsterbezüge ein und machten das Sitzen
auf diesen, sich dem Körper wenig anbequemenden, zu-
sammengezimmerten Gestellen erträglicher.
Um den Lharakter der romanischen Wohnungsaus-
stattung vollauf zu würdigen, darf man nicht vergessen,
wer dieselbe geschaffen. Einen Theil mochte sich der In-
haber selbst zimmern und schnitzen, die Hausfrau mit ihren
Mägden sich selbst gar Manches spinnen, weben, nähen
und sticken, die Hauptsache aber an Möbeln und Geräthen
wurde in den Werkstätten der Klöster verfertigt, anderes
durch den Handel von fremden Völkern erworben, von
den Italienern, den Byzantinern und den Mauren. Be-
kanntlich machten die Hohenstaufen schließlich Italien
mehr zu ihrer Heimath als Deutschland, so daß es den
Anschein gewann, als sollte der Herrschersitz des D eutschen
Kaiserthums für immer dorthin verpsianzt werden.
Somit ist es sehr erklärlich, wenn gegen das Ende der
romanischen Zeit der Einfluß südlicher Lebensweise in
Deutschland eher zu- als abnahm, trotzdem die Deutschen
damals als führende Nation an der Weiterentwicklung der
Kultur hervorragenden Antheil nahmen. Dazu kanr noch
die bedeutende Rückwirkung, welche in dieser Hinsicht die
Kreuzzüge ausübten.
Kirncht der romanischen Leit.
Wie in der Wohnungs-
ausstattung, so klingt nun auch
in der Tracht der romanischen
Zeit mit ihren langen faltigen
Gewändern die Antike sehr
vernehmlich nach. Aber die-
selbe Vergröberung und Ab-
stumpfung, welche die Möbel-
und Gerätheformcn zeigen, ist
auch hier zu bemerken.
Die Gewänder bestanden
der Hauptsache nach aus einen:,
oder allenfalls zwei, durch
eine einfache Naht zusammen-
gefügten Stücken, so daß diese
Kleidung als eine Drapirung
des Körpers bezeichnet werden Französische Frauentracht zu Anfang
kann. Die Männertrugen eine &es XII. Jahrhunderts.
Art von Tunika mit Hermein, Aostümgeschichte, s. *67.
X