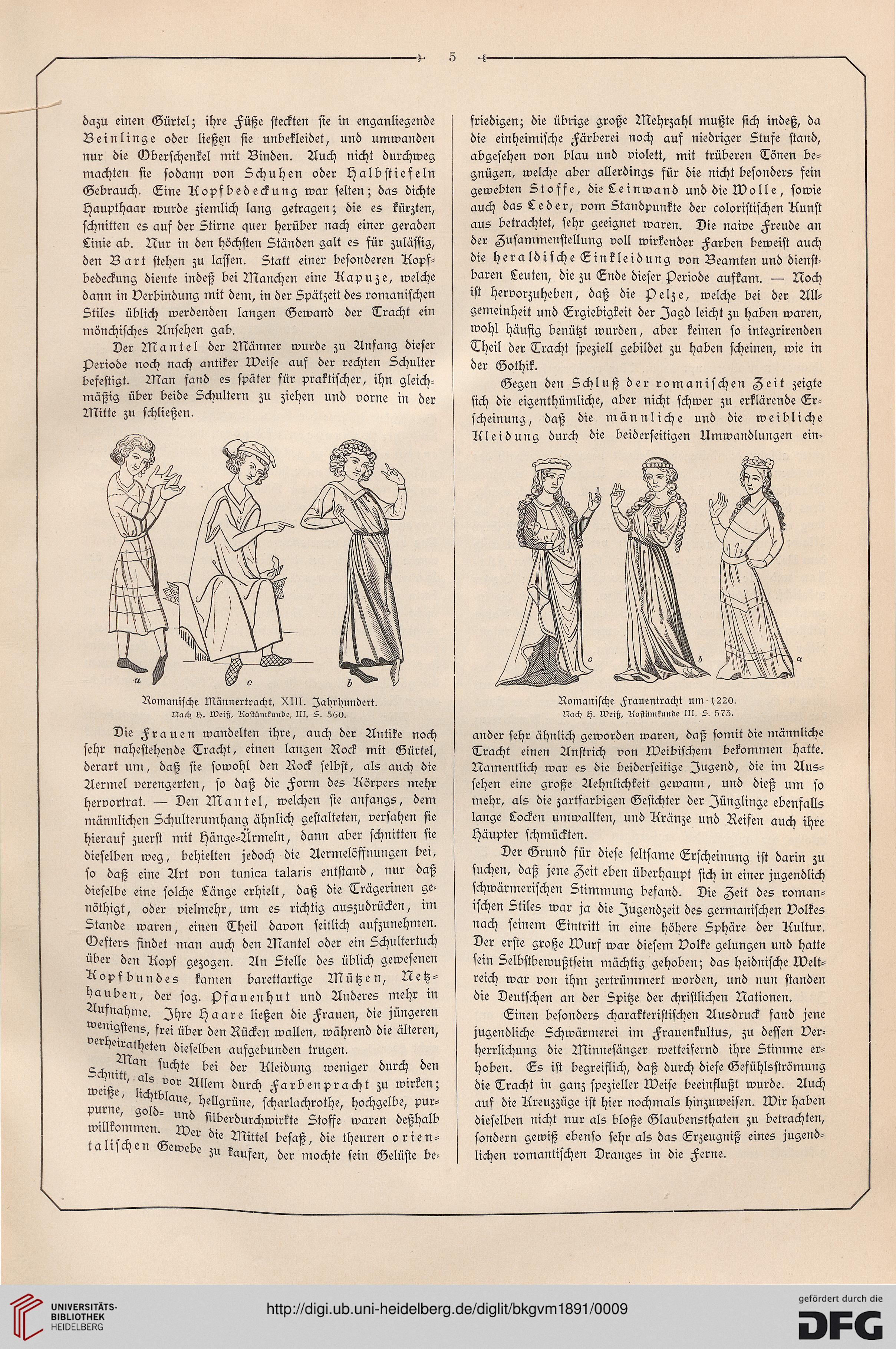dazu einen Gürtel; ihre Füße steckten sie in enganliegende
Beinlinge oder ließen sie unbekleidet, und umwanden
nur die Oberschenkel mit Binden. Auch nicht durchweg
machten sie sodann von Schuhen oder Halb stiefeln
Gebrauch. Eine Kopfbedeckung war selten; das dichte
Haupthaar wurde ziemlich lang getragen; die es kürzten,
schnitten es auf der Stirne quer herüber nach einer geraden
Linie ab. Nur in den höchsten Ständen galt es für zulässig,
den Bart stehen zu lassen. Statt einer besonderen Aopf-
bedeckung diente indeß bei Manchen eine Aapuze, welche
dann in Verbindung mit dem, in der Spätzeit des ronmnifchen
Stiles üblich werdenden langen Gewand der Tracht ein
mönchisches Ansehen gab.
Der Mantel der Männer wurde zu Anfang dieser
Periode noch nach antiker weise auf der rechten Schulter
befestigt. Man fand es später für praktischer, ihn gleich-
mäßig über beide Schultern zu ziehen und vorne in der
Mitte zu schließen.
Romanische MLunertracht, XIII. Jahrhundert.
Nach £}. Weiß, Äostümkunde, III. 5. 560.
Die Fra uen wandelten ihre, auch der Antike noch
sehr nahestehende Tracht, einen langen Rock mit Gürtel,
derart um, daß sie sowohl den Rock selbst, als auch die
Aermel verengerten, so daß die Form des Aörpers mehr
hervortrat. — Den Mantel, welchen sie anfangs, dem
männlichen Schulterumhang ähnlich gestalteten, versahen sie
hieraus zuerst mit Hänge-Ärmeln, dann aber schnitten sie
dieselben weg, behielten jedoch die Aermelöfsnungen bei,
so daß eine Art von tunica talaris entstand, nur daß
dieselbe eine solche Länge erhielt, daß die Trägerinen ge-
nöthigt, oder vielmehr, um es richtig auszudrücken, im
Stande waren, einen Theil davon seitlich aufzunehmen.
Defters findet man auch den Mantel oder ein Schultertuch
über den Aopf gezogen. An Stelle des üblich gewesenen
Ropfbundes kamen barettartige Mützen, Netz-
hauben, der sog. Pfauenhut und Anderes mehr in
Aufnahme. Ihre Haare ließen die Frauen, die jüngeren
wenigstens, frei über den Rücken wallen, während die älteren,
er?ckratheten dieselben aufgebunden trugen.
Schnitt^" ^chte bei der Aleidung weniger durch den
wRße ' Stw0* ^Uem d"rch Farbenpracht zu wirken;
.. uue, hellgrüne, scharlachrothe, hochgelbe, pur-
willkommen ' uf liiberdurchwirkte Stoffe waren deßhalb
..... er Mittel besaß, die theurcn orien-
a : en ewebe zu kaufen, der mochte sein Gelüste be-
friedigen; die übrige große Mehrzahl mußte sich indeß, da
die einheimische Färberei noch auf niedriger Stufe stand,
abgesehen von blau und violett, mit trüberen Tönen be-
gnügen, welche aber allerdings für die nicht besonders fein
gewebten Stoffe, die Leinwand und die wolle, sowie
auch das Leder, vom Standpunkte der coloristischen Aunst
aus betrachtet, sehr geeignet waren. Die naive Freude an
der Zusammenstellung voll wirkender Farben beweist auch
die heraldische Einkleidung von Beamten und dienst-
baren Leuten, die zu Ende dieser Periode aufkam. — Noch
ist hervorzuheben, daß die pelze, welche bei der All-
gemeinheit und Ergiebigkeit der Jagd leicht zu haben waren,
wohl häufig benützt wurden, aber keinen so integrirenden
Theil der Tracht speziell gebildet zu haben scheinen, wie in
der Gothik.
Gegen den Schluß der romanischen Zeit zeigte
sich die eigenthünlliche, aber nicht schwer zu erklärende Er-
scheinung, daß die männliche und die weibliche
Al ei düng durch die beiderseitigen Umwandlungen ein-
Romanische Frauentracht um ; 220.
Nach £?. weiß, Aostümkunde III. 5. 573.
ander sehr ähnlich geworden waren, daß somit die männliche
Tracht einen Anstrich von weibischen: bekommen hatte.
Namentlich war es die beiderseitige Jugend, die in: Aus-
sehen eine große Aehnlichkeit gewann, und dieß um so
mehr, als die zartfarbigen Gesichter der Jünglinge ebenfalls
lange Locken umwallten, und Aränze und Reifen auch ihre
Häupter schmückten.
Der Grund für diese seltsame Erscheinung ist darin zu
suchen, daß jene Zeit eben überhaupt sich in einer jugendlich
schwärmerischen Stimmung befand. Die Zeit des roman-
ischen Stiles war ja die Jugendzeit des germanischen Volkes
nach seinem Eintritt in eine höhere Sphäre der Aultur.
Der erste große Wurf war diesem Volke gelungen und hatte
sein Selbstbewußtsein mächtig gehoben; das heidnische Welt-
reich war von ihn: zertrümrnert worden, und nun standen
die Deutschen an der Spitze der christlichen Nationen.
Einen besonders charakteristischen Ausdruck fand jene
jugendliche Schwärinerei im Frauenkultus, zu dessen Ver-
herrlichung die Minnesänger wetteifernd ihre Stiinme er-
hoben. Es ist begreifiich, daß durch diese Gefühlsströmung
die Tracht in ganz spezieller weise beeinflußt wurde. Auch
auf die Areuzzüge ist hier nochmals hinzuweisen, wir haben
dieselben nicht nur als bloße Glaubensthaten zu betrachten,
sondern gewiß ebenso sehr als das Erzeugniß eines jugend-
lichen romantischen Dranges in die Ferne.
Beinlinge oder ließen sie unbekleidet, und umwanden
nur die Oberschenkel mit Binden. Auch nicht durchweg
machten sie sodann von Schuhen oder Halb stiefeln
Gebrauch. Eine Kopfbedeckung war selten; das dichte
Haupthaar wurde ziemlich lang getragen; die es kürzten,
schnitten es auf der Stirne quer herüber nach einer geraden
Linie ab. Nur in den höchsten Ständen galt es für zulässig,
den Bart stehen zu lassen. Statt einer besonderen Aopf-
bedeckung diente indeß bei Manchen eine Aapuze, welche
dann in Verbindung mit dem, in der Spätzeit des ronmnifchen
Stiles üblich werdenden langen Gewand der Tracht ein
mönchisches Ansehen gab.
Der Mantel der Männer wurde zu Anfang dieser
Periode noch nach antiker weise auf der rechten Schulter
befestigt. Man fand es später für praktischer, ihn gleich-
mäßig über beide Schultern zu ziehen und vorne in der
Mitte zu schließen.
Romanische MLunertracht, XIII. Jahrhundert.
Nach £}. Weiß, Äostümkunde, III. 5. 560.
Die Fra uen wandelten ihre, auch der Antike noch
sehr nahestehende Tracht, einen langen Rock mit Gürtel,
derart um, daß sie sowohl den Rock selbst, als auch die
Aermel verengerten, so daß die Form des Aörpers mehr
hervortrat. — Den Mantel, welchen sie anfangs, dem
männlichen Schulterumhang ähnlich gestalteten, versahen sie
hieraus zuerst mit Hänge-Ärmeln, dann aber schnitten sie
dieselben weg, behielten jedoch die Aermelöfsnungen bei,
so daß eine Art von tunica talaris entstand, nur daß
dieselbe eine solche Länge erhielt, daß die Trägerinen ge-
nöthigt, oder vielmehr, um es richtig auszudrücken, im
Stande waren, einen Theil davon seitlich aufzunehmen.
Defters findet man auch den Mantel oder ein Schultertuch
über den Aopf gezogen. An Stelle des üblich gewesenen
Ropfbundes kamen barettartige Mützen, Netz-
hauben, der sog. Pfauenhut und Anderes mehr in
Aufnahme. Ihre Haare ließen die Frauen, die jüngeren
wenigstens, frei über den Rücken wallen, während die älteren,
er?ckratheten dieselben aufgebunden trugen.
Schnitt^" ^chte bei der Aleidung weniger durch den
wRße ' Stw0* ^Uem d"rch Farbenpracht zu wirken;
.. uue, hellgrüne, scharlachrothe, hochgelbe, pur-
willkommen ' uf liiberdurchwirkte Stoffe waren deßhalb
..... er Mittel besaß, die theurcn orien-
a : en ewebe zu kaufen, der mochte sein Gelüste be-
friedigen; die übrige große Mehrzahl mußte sich indeß, da
die einheimische Färberei noch auf niedriger Stufe stand,
abgesehen von blau und violett, mit trüberen Tönen be-
gnügen, welche aber allerdings für die nicht besonders fein
gewebten Stoffe, die Leinwand und die wolle, sowie
auch das Leder, vom Standpunkte der coloristischen Aunst
aus betrachtet, sehr geeignet waren. Die naive Freude an
der Zusammenstellung voll wirkender Farben beweist auch
die heraldische Einkleidung von Beamten und dienst-
baren Leuten, die zu Ende dieser Periode aufkam. — Noch
ist hervorzuheben, daß die pelze, welche bei der All-
gemeinheit und Ergiebigkeit der Jagd leicht zu haben waren,
wohl häufig benützt wurden, aber keinen so integrirenden
Theil der Tracht speziell gebildet zu haben scheinen, wie in
der Gothik.
Gegen den Schluß der romanischen Zeit zeigte
sich die eigenthünlliche, aber nicht schwer zu erklärende Er-
scheinung, daß die männliche und die weibliche
Al ei düng durch die beiderseitigen Umwandlungen ein-
Romanische Frauentracht um ; 220.
Nach £?. weiß, Aostümkunde III. 5. 573.
ander sehr ähnlich geworden waren, daß somit die männliche
Tracht einen Anstrich von weibischen: bekommen hatte.
Namentlich war es die beiderseitige Jugend, die in: Aus-
sehen eine große Aehnlichkeit gewann, und dieß um so
mehr, als die zartfarbigen Gesichter der Jünglinge ebenfalls
lange Locken umwallten, und Aränze und Reifen auch ihre
Häupter schmückten.
Der Grund für diese seltsame Erscheinung ist darin zu
suchen, daß jene Zeit eben überhaupt sich in einer jugendlich
schwärmerischen Stimmung befand. Die Zeit des roman-
ischen Stiles war ja die Jugendzeit des germanischen Volkes
nach seinem Eintritt in eine höhere Sphäre der Aultur.
Der erste große Wurf war diesem Volke gelungen und hatte
sein Selbstbewußtsein mächtig gehoben; das heidnische Welt-
reich war von ihn: zertrümrnert worden, und nun standen
die Deutschen an der Spitze der christlichen Nationen.
Einen besonders charakteristischen Ausdruck fand jene
jugendliche Schwärinerei im Frauenkultus, zu dessen Ver-
herrlichung die Minnesänger wetteifernd ihre Stiinme er-
hoben. Es ist begreifiich, daß durch diese Gefühlsströmung
die Tracht in ganz spezieller weise beeinflußt wurde. Auch
auf die Areuzzüge ist hier nochmals hinzuweisen, wir haben
dieselben nicht nur als bloße Glaubensthaten zu betrachten,
sondern gewiß ebenso sehr als das Erzeugniß eines jugend-
lichen romantischen Dranges in die Ferne.