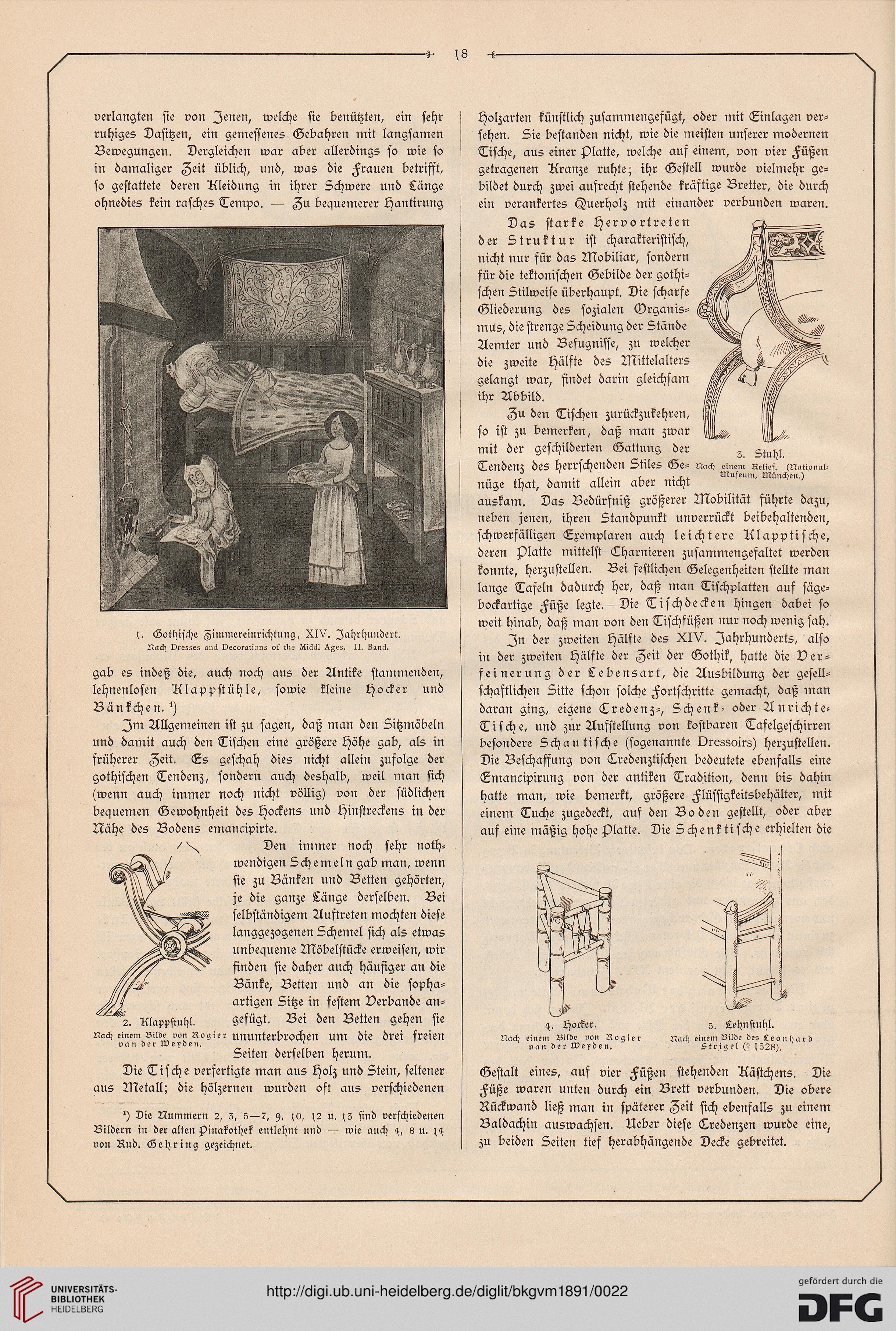\ 8 h-
verlangten sie von Jenen, welche sie benützten, ein sehr
ruhiges Dasitzen, ein gemessenes Gebahren mit langsamen
Bewegungen. Dergleichen war aber allerdings so wie so
in damaliger Zeit üblich, und, was die grauen betrifft,
so gestattete deren Kleidung in ihrer Schwere und Länge
ohnedies kein rasches Tempo. — Zu bequemerer hantirung
Gothische Zimmereinrichtung, XIV. Jahrhundert.
Nach Dresses and Decorations of the Middl Ages. II. Band.
gab es indeß die, auch noch aus der Antike stammenden,
lehnenlosen Klappstühle, sowie kleine Hocker und
Bänkchen. *)
Zur Allgenieinen ist zu sagen, daß man den Sitzmöbeln
und danrit auch den Tischen eine größere höhe gab, als in
früherer Zeit. Ls geschah dies nicht allein zufolge der
gothischen Tendenz, sondern auch deshalb, weil man sich
(wenn auch immer noch nicht völlig) voit der südlichen
bequemen Gewohnheit des hockens und Hinstreckens in der
Nähe des Bodens emancipirte.
Den immer noch sehr noth-
wendigen Schemeln gab man, wenn
sie zu Bänken und Betten gehörten,
je die ganze Länge derselben. Bei
selbständigen: Auftreten mochten diese
langgezogenen Scheniel sich als etwas
unbequenie Nkäbelstücke erweisen, wir
finden sie daher auch häufiger an die
Bänke, Betten und an die sopha-
artigen Sitze in festem Verbände an-
gefügt. Bei den Betten gehen sie
Nach einem Bilde von Rogier ununterbrochen um die drei freien
vanderweyden. ‘
Seiten derselben herum.
Die Tische verfertigte man aus Holz und Stein, seltener
aus Metall; die hölzernen wurden oft aus verschiedenen
*) Die Nummer» 2, 3, 5—7, 9, ;o, [2 u. ;z sind verschiedenen
Bildern in der alten Pinakothek entlehnt und — wie anch 8 u.
von Rnd. Gehring gezeichnet.
Holzarten künstlich zusammengefügt, oder mit Einlagen ver-
sehen. Sie bestanden nicht, wie die meisten unserer modernen
Tische, aus einer Platte, welche auf einem, von vier Füßen
getragenen Kranze ruhte; ihr Gestell wurde vielniehr ge-
bildet durch zwei aufrecht stehende kräftige Bretter, die durch
ein verankertes Querholz mit einander verbunden waren.
Das starke hervor treten
der Struktur ist charakteristisch,
nicht nur für das Mobiliar, sondern
für die tektonischen Gebilde der gothi-
schen Stilweise überhaupt. Die scharfe
Gliederung des sozialen Organis-
mus, die strenge Scheidung der Stände
Aemter und Befugnisse, zu welcher
die zweite Hälfte des Mittelalters
gelangt war, findet darin gleichsam
ihr Abbild.
Zu den Tischen zurückzukehren,
so ist zu bemerken, daß man zwar
mit der geschilderten Gattung der
Tendenz des herrschenden Stiles Ge- Noch o,nem Relief. (National-
, . ., „ . , . < , Museum, München.)
nütze that, damit allem aber Nicht
auskam. Das Bedürfniß größerer Mobilität führte dazu,
neben jenen, ihren Standpunkt unverrückt beibehaltenden,
schwerfälligen Exemplaren auch leichtere Klapptische,
deren Platte mittelst Tharnieren zusammengefaltet werden
konnte, herzustellen. Bei festlichen Gelegenheiten stellte man
lange Tafeln dadurch her, daß man Tischplatten auf säge-
bockartige Füße legte. Die Tischdecken hingen dabei so
weit hinab, daß man von den Tischfüßen nur noch wenig sah.
In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, also
in der zweiten Hälfte der Zeit der Gothik, hatte die Ver-
feinerung der Lebensart, die Ausbildung der gesell-
schaftlichen Sitte schon solche Fortschritte gemacht, daß man
daran ging, eigene Tredenz-, Schenk- oder Anrichte-
Tische, und zur Aufstellung von kostbaren Tafelgeschirren
besondere Schau tische (sogenannte Vressoirs) herzustellen.
Die Beschaffung von Tredenztischen bedeutete ebenfalls eine
Emancipirung von der antiken Tradition, denn bis dahin
hatte man, wie bemerkt, größere Flüssigkeitsbehälter, mit
einem Tuche zugedeckt, auf den Boden gestellt, oder aber
auf eine mäßig hohe Platte. Die Schenk tische erhielten die
5. Lehnstuhl.
Nach einem Bilde des Leonhard
Strigel (f J528).
Gestalt eines, auf vier Füßen stehenden Kästchens. Die
Füße waren unten durch ein Brett verbunden. Die obere
Rückwand ließ man in späterer Zeit sich ebenfalls zu einem
Baldachin auswachsen. lieber diese Tredenzen wurde eine,
zu beiden Seiten tief herabhängende Decke gebreitet.
verlangten sie von Jenen, welche sie benützten, ein sehr
ruhiges Dasitzen, ein gemessenes Gebahren mit langsamen
Bewegungen. Dergleichen war aber allerdings so wie so
in damaliger Zeit üblich, und, was die grauen betrifft,
so gestattete deren Kleidung in ihrer Schwere und Länge
ohnedies kein rasches Tempo. — Zu bequemerer hantirung
Gothische Zimmereinrichtung, XIV. Jahrhundert.
Nach Dresses and Decorations of the Middl Ages. II. Band.
gab es indeß die, auch noch aus der Antike stammenden,
lehnenlosen Klappstühle, sowie kleine Hocker und
Bänkchen. *)
Zur Allgenieinen ist zu sagen, daß man den Sitzmöbeln
und danrit auch den Tischen eine größere höhe gab, als in
früherer Zeit. Ls geschah dies nicht allein zufolge der
gothischen Tendenz, sondern auch deshalb, weil man sich
(wenn auch immer noch nicht völlig) voit der südlichen
bequemen Gewohnheit des hockens und Hinstreckens in der
Nähe des Bodens emancipirte.
Den immer noch sehr noth-
wendigen Schemeln gab man, wenn
sie zu Bänken und Betten gehörten,
je die ganze Länge derselben. Bei
selbständigen: Auftreten mochten diese
langgezogenen Scheniel sich als etwas
unbequenie Nkäbelstücke erweisen, wir
finden sie daher auch häufiger an die
Bänke, Betten und an die sopha-
artigen Sitze in festem Verbände an-
gefügt. Bei den Betten gehen sie
Nach einem Bilde von Rogier ununterbrochen um die drei freien
vanderweyden. ‘
Seiten derselben herum.
Die Tische verfertigte man aus Holz und Stein, seltener
aus Metall; die hölzernen wurden oft aus verschiedenen
*) Die Nummer» 2, 3, 5—7, 9, ;o, [2 u. ;z sind verschiedenen
Bildern in der alten Pinakothek entlehnt und — wie anch 8 u.
von Rnd. Gehring gezeichnet.
Holzarten künstlich zusammengefügt, oder mit Einlagen ver-
sehen. Sie bestanden nicht, wie die meisten unserer modernen
Tische, aus einer Platte, welche auf einem, von vier Füßen
getragenen Kranze ruhte; ihr Gestell wurde vielniehr ge-
bildet durch zwei aufrecht stehende kräftige Bretter, die durch
ein verankertes Querholz mit einander verbunden waren.
Das starke hervor treten
der Struktur ist charakteristisch,
nicht nur für das Mobiliar, sondern
für die tektonischen Gebilde der gothi-
schen Stilweise überhaupt. Die scharfe
Gliederung des sozialen Organis-
mus, die strenge Scheidung der Stände
Aemter und Befugnisse, zu welcher
die zweite Hälfte des Mittelalters
gelangt war, findet darin gleichsam
ihr Abbild.
Zu den Tischen zurückzukehren,
so ist zu bemerken, daß man zwar
mit der geschilderten Gattung der
Tendenz des herrschenden Stiles Ge- Noch o,nem Relief. (National-
, . ., „ . , . < , Museum, München.)
nütze that, damit allem aber Nicht
auskam. Das Bedürfniß größerer Mobilität führte dazu,
neben jenen, ihren Standpunkt unverrückt beibehaltenden,
schwerfälligen Exemplaren auch leichtere Klapptische,
deren Platte mittelst Tharnieren zusammengefaltet werden
konnte, herzustellen. Bei festlichen Gelegenheiten stellte man
lange Tafeln dadurch her, daß man Tischplatten auf säge-
bockartige Füße legte. Die Tischdecken hingen dabei so
weit hinab, daß man von den Tischfüßen nur noch wenig sah.
In der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, also
in der zweiten Hälfte der Zeit der Gothik, hatte die Ver-
feinerung der Lebensart, die Ausbildung der gesell-
schaftlichen Sitte schon solche Fortschritte gemacht, daß man
daran ging, eigene Tredenz-, Schenk- oder Anrichte-
Tische, und zur Aufstellung von kostbaren Tafelgeschirren
besondere Schau tische (sogenannte Vressoirs) herzustellen.
Die Beschaffung von Tredenztischen bedeutete ebenfalls eine
Emancipirung von der antiken Tradition, denn bis dahin
hatte man, wie bemerkt, größere Flüssigkeitsbehälter, mit
einem Tuche zugedeckt, auf den Boden gestellt, oder aber
auf eine mäßig hohe Platte. Die Schenk tische erhielten die
5. Lehnstuhl.
Nach einem Bilde des Leonhard
Strigel (f J528).
Gestalt eines, auf vier Füßen stehenden Kästchens. Die
Füße waren unten durch ein Brett verbunden. Die obere
Rückwand ließ man in späterer Zeit sich ebenfalls zu einem
Baldachin auswachsen. lieber diese Tredenzen wurde eine,
zu beiden Seiten tief herabhängende Decke gebreitet.