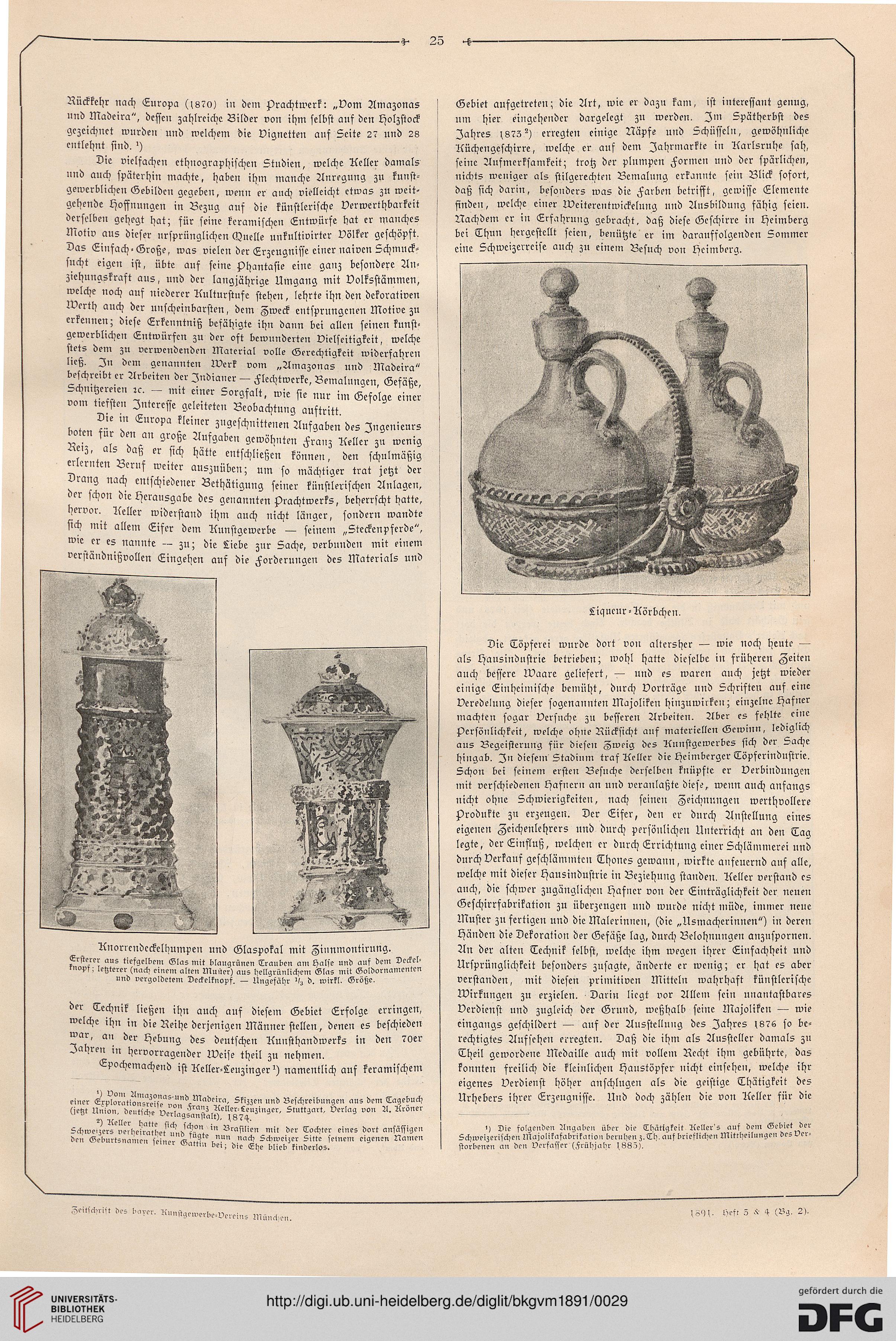25 -#•
Rückkehr nach Europa ((870) in dem Prachtwerk: „vom Amazonas
und Madeira", dessen zahlreiche Bilder von ihm selbst ans den ksolzstock
gezeichnet wurden und welchem die Vignetten aus Seite 27 und 28
entlehnt find. ')
Die vielfachen ethnographischen Studien, welche Keller damals
liiiö auch späterhin machte, haben ihm manche Anregung zu kunst-
gewerblichen Gebilden gegeben, wenn er auch vielleicht etwas zu weit-
gehende Hoffnungen in Bezug auf die künstlerische verwerthbarkeit
derselben gehegt hat; für seine keramischen Entwürfe hat er manches
Motiv aus dieser ursprünglichen Tnelle unknltivirter Völker geschöpft.
Das Einfach-Große, was vielen der Erzeugnisse einer naiven Schmnck-
sucht eigen ist, übte auf seine Phantasie eine ganz besondere An-
ziehungskraft aus, und der langjährige Umgang mit Volksstämmen,
welche noch auf niederer Kulturstufe stehen, lehrte ihn den dekorativen
Werth auch der unscheinbarsten, dem Zweck entsprungenen Motive zu
erkennen; diese Lrkenntniß befähigte ihn dann bei allen seinen kunst-
gewerblichen Entwürfen zu der oft bewunderten Vielseitigkeit, welche
stets dem zu verwendenden Malcrial volle Gerechtigkeit widerfahren
ließ. In dem genannten Werk vom „Amazonas und Madeira"
beschreibt er Arbeiten der Indianer — Flechtwcrkc, Bemalungen, Gefäße,
Schnitzereien re. — mit einer Sorgfalt, wie sie nur im Gefolge einer
vo,n tiefste» Interesse geleiteten Beobachtung austritt.
Die in Europa kleiner zngeschnitteiien Aufgaben des Ingenieurs
boten für den an große Aufgaben gewöhnten Franz Keller zu wenig
-u’i;, als daß er sich hätte entschließen können, den schnlmäßig
erlernten Beruf weiter auszuüben; um so mächtiger trat jetzt der
Diang nach entschiedener Bethätignng seiner künstlerischen Anlagen,
der schon die Herausgabe des genannten Prachtwerks, beherrscht hatte,
hervor. Keller widerstaiid ihm auch nicht länger, sondern wandte
sich mit allem Eifer dem Knnstgewerbc — seinem „Steckenpferde",
wie er es nannte — zu; die Liebe zur Sache, verbunden mit einem
verstäudnißvollen Eingehen auf die Forderungen des Materials und
Lrsie ^""^""dcckelhumpen und Glaspokal mit Ziunmontirnng.
knöpf; Trauben am Halse und auf deni Hecfcl*
unb Di'fnn ü»!1” Q S"i^,u"cr) 1,115 bellgrünlichem Glas mit Goldornamenten
mtb vergoldetem Dechelknopf. - Ungefähr >i3 d. wirkl. Grütze.
w^lrl C^n'^. auch auf diesem Gebiet Erfolge erringen,
'^u 'n die Reihe derjenigen Männer stellen, denen es befchicden
, an der Hebung des deutschen Kunsthandwerks in den 7oer
- r ,ren in hervorragender weife theil zu nehmen.
"0 ^machend ist Keller-Leuzinger') namentlich auf keramischem
einer Gxplorationsreise"vön^L^^s!k"' Skizzen und Beschreibungen aus dem Tagebuch
(jetzt Union, deutsche verlagsanst^ i?Icr‘*e,1äi,1ä|tr, Stuttgart, Verlag von A. Aröner
^)Aellcr hatte firf, i, ” -.i87^’
Schweizers verheirathot und tüot " Brasilien mit der Tochter eines dort ansässigen
den Geburtsnanien seiner ,.n.un nach Schweizer Sitte seinem eigenen Namen
1 >"°r Wattn, bei; die Ehe blieb kinderlos.
Gebiet ausgetreten; die Art, wie er dazu kam, ist interessant genug,
um hier eingehender dargelegt zu werden. Iw Spätherbst des
Iahres (873 *) erregten einige Räpfe und Schüsseln, gewöhnliche
Küchengcfchirre, welche er auf dem Iahrmarkte in Karlsruhe sah,
seine Aufmerksamkeit; trotz der plumpen Formen und der spärlichen,
nichts weniger als stilgerechten Bemalung erkannte sein Blick sofort,
daß sich dar!», besonders was die Farben betrifft, gewisse Elemente
finden, welche einer Weiterentwickelung und Ausbildung fähig feien.
Rachdem er in Erfahrung gebracht, daß diese Geschirre in Hcimberg
bei Thun hergestellt seien, benützte er im darauffolgenden Sommer
eine Schweizetreise auch zn einem Besuch von Heimberg.
Liqueur-Körbchen.
Die Töpferei wurde dort von altersher — wie noch heute —
als Hansindnstrie betrieben; wohl hatte dieselbe in früheren Zeiten
auch bessere waare geliefert, — und es waren auch jetzt wieder
einige Einheimische bemüht, durch Vorträge und Schriften auf eine
Veredelung dieser sogenannten Majoliken hinzuwirken; einzelne Hafner
machten sogar versuche zn besseren Arbeiten. Aber cs fehlte eine
Persönlichkeit, welche ohne Rücksicht ans materiellen Gewinn, lediglich
ans Begeisterung für diesen Zweig des Knnstgewerbes sich det Sache
hingab. In diesem Stadium traf Keller die pcimberger Töpferindustrie.
Schon bei seinem ersten Besuche derselben knüpfte er Verbindungen
mit verschiedenen Hafnern an und veranlaßte diese, wenn auch anfangs
nicht ohne Schwierigkeiten, nach seinen Zeichnungen werthvollcre
Produkte zu erzeugen. Der Eifer, den er durch Anstellung eines
eigenen Zeichenlehrers und durch persönlichen Unterricht an den Tag
legte, der Einfluß, welchen er durch Errichtung einer Schlämmerei und
durch verkauf geschlämmten Thones gewann, wirkte anfenernd auf alle,
welche mit dieser Hausindustrie in Beziehung standen. Keller verstand es
auch, die schwer zugänglichen Hafner von der Einträglichkeit der neuen
Geschirrsabrikation zu überzeugen und wurde nicht müde, immer neue
Muster zn fertigen und die Malerinnen, (die „Usmacherinnen") in deren
fänden die Dekoration der Gefäße lag, durch Belohnungen anznspornen.
An der alten Technik selbst, welche ihm wegen ihrer Einfachheit und
Ursprünglichkeit besonders zusagte, änderte er wenig; er hat es aber
verstanden, mit diesen primitiven Mitteln wahrhaft künstlerische
Wirkungen zu erzielen. Darin liegt vor Allem sein unantastbares
Verdienst und zugleich der Grund, wcßhalb seine Majoliken — wie
eingangs geschildert — auf der Ausstellung des Iahres (87S so be-
rechtigtes Aufsehen erregten. Daß die ihm als Aussteller damals zu
Theil gewordene Medaille auch mit vollem Recht ihm gebührte, das
konnten freilich die kleinlichen Haustöpfer nicht einsehen, welche ihr
eigenes Verdienst höher anschlugen als die geistige Thätigkeit des
Urhebers ihrer Erzeugnisse. Und doch zählen die von Keller für die
<j Die folgenden Angaben über die Thätigkeit Aeller's auf dem Gebiet der
Schweizerischen Majolikafabrikation beruhen z.Tb. auf brieflichen Mittheilungen des ver-
storbenen an den Verfasser (Frühjahr (883).
Zeitschrift des baser. Aunstgewerbe-Vcreins München.
(Sg(. Heft 3 ch 4 (Bg. 2).
Rückkehr nach Europa ((870) in dem Prachtwerk: „vom Amazonas
und Madeira", dessen zahlreiche Bilder von ihm selbst ans den ksolzstock
gezeichnet wurden und welchem die Vignetten aus Seite 27 und 28
entlehnt find. ')
Die vielfachen ethnographischen Studien, welche Keller damals
liiiö auch späterhin machte, haben ihm manche Anregung zu kunst-
gewerblichen Gebilden gegeben, wenn er auch vielleicht etwas zu weit-
gehende Hoffnungen in Bezug auf die künstlerische verwerthbarkeit
derselben gehegt hat; für seine keramischen Entwürfe hat er manches
Motiv aus dieser ursprünglichen Tnelle unknltivirter Völker geschöpft.
Das Einfach-Große, was vielen der Erzeugnisse einer naiven Schmnck-
sucht eigen ist, übte auf seine Phantasie eine ganz besondere An-
ziehungskraft aus, und der langjährige Umgang mit Volksstämmen,
welche noch auf niederer Kulturstufe stehen, lehrte ihn den dekorativen
Werth auch der unscheinbarsten, dem Zweck entsprungenen Motive zu
erkennen; diese Lrkenntniß befähigte ihn dann bei allen seinen kunst-
gewerblichen Entwürfen zu der oft bewunderten Vielseitigkeit, welche
stets dem zu verwendenden Malcrial volle Gerechtigkeit widerfahren
ließ. In dem genannten Werk vom „Amazonas und Madeira"
beschreibt er Arbeiten der Indianer — Flechtwcrkc, Bemalungen, Gefäße,
Schnitzereien re. — mit einer Sorgfalt, wie sie nur im Gefolge einer
vo,n tiefste» Interesse geleiteten Beobachtung austritt.
Die in Europa kleiner zngeschnitteiien Aufgaben des Ingenieurs
boten für den an große Aufgaben gewöhnten Franz Keller zu wenig
-u’i;, als daß er sich hätte entschließen können, den schnlmäßig
erlernten Beruf weiter auszuüben; um so mächtiger trat jetzt der
Diang nach entschiedener Bethätignng seiner künstlerischen Anlagen,
der schon die Herausgabe des genannten Prachtwerks, beherrscht hatte,
hervor. Keller widerstaiid ihm auch nicht länger, sondern wandte
sich mit allem Eifer dem Knnstgewerbc — seinem „Steckenpferde",
wie er es nannte — zu; die Liebe zur Sache, verbunden mit einem
verstäudnißvollen Eingehen auf die Forderungen des Materials und
Lrsie ^""^""dcckelhumpen und Glaspokal mit Ziunmontirnng.
knöpf; Trauben am Halse und auf deni Hecfcl*
unb Di'fnn ü»!1” Q S"i^,u"cr) 1,115 bellgrünlichem Glas mit Goldornamenten
mtb vergoldetem Dechelknopf. - Ungefähr >i3 d. wirkl. Grütze.
w^lrl C^n'^. auch auf diesem Gebiet Erfolge erringen,
'^u 'n die Reihe derjenigen Männer stellen, denen es befchicden
, an der Hebung des deutschen Kunsthandwerks in den 7oer
- r ,ren in hervorragender weife theil zu nehmen.
"0 ^machend ist Keller-Leuzinger') namentlich auf keramischem
einer Gxplorationsreise"vön^L^^s!k"' Skizzen und Beschreibungen aus dem Tagebuch
(jetzt Union, deutsche verlagsanst^ i?Icr‘*e,1äi,1ä|tr, Stuttgart, Verlag von A. Aröner
^)Aellcr hatte firf, i, ” -.i87^’
Schweizers verheirathot und tüot " Brasilien mit der Tochter eines dort ansässigen
den Geburtsnanien seiner ,.n.un nach Schweizer Sitte seinem eigenen Namen
1 >"°r Wattn, bei; die Ehe blieb kinderlos.
Gebiet ausgetreten; die Art, wie er dazu kam, ist interessant genug,
um hier eingehender dargelegt zu werden. Iw Spätherbst des
Iahres (873 *) erregten einige Räpfe und Schüsseln, gewöhnliche
Küchengcfchirre, welche er auf dem Iahrmarkte in Karlsruhe sah,
seine Aufmerksamkeit; trotz der plumpen Formen und der spärlichen,
nichts weniger als stilgerechten Bemalung erkannte sein Blick sofort,
daß sich dar!», besonders was die Farben betrifft, gewisse Elemente
finden, welche einer Weiterentwickelung und Ausbildung fähig feien.
Rachdem er in Erfahrung gebracht, daß diese Geschirre in Hcimberg
bei Thun hergestellt seien, benützte er im darauffolgenden Sommer
eine Schweizetreise auch zn einem Besuch von Heimberg.
Liqueur-Körbchen.
Die Töpferei wurde dort von altersher — wie noch heute —
als Hansindnstrie betrieben; wohl hatte dieselbe in früheren Zeiten
auch bessere waare geliefert, — und es waren auch jetzt wieder
einige Einheimische bemüht, durch Vorträge und Schriften auf eine
Veredelung dieser sogenannten Majoliken hinzuwirken; einzelne Hafner
machten sogar versuche zn besseren Arbeiten. Aber cs fehlte eine
Persönlichkeit, welche ohne Rücksicht ans materiellen Gewinn, lediglich
ans Begeisterung für diesen Zweig des Knnstgewerbes sich det Sache
hingab. In diesem Stadium traf Keller die pcimberger Töpferindustrie.
Schon bei seinem ersten Besuche derselben knüpfte er Verbindungen
mit verschiedenen Hafnern an und veranlaßte diese, wenn auch anfangs
nicht ohne Schwierigkeiten, nach seinen Zeichnungen werthvollcre
Produkte zu erzeugen. Der Eifer, den er durch Anstellung eines
eigenen Zeichenlehrers und durch persönlichen Unterricht an den Tag
legte, der Einfluß, welchen er durch Errichtung einer Schlämmerei und
durch verkauf geschlämmten Thones gewann, wirkte anfenernd auf alle,
welche mit dieser Hausindustrie in Beziehung standen. Keller verstand es
auch, die schwer zugänglichen Hafner von der Einträglichkeit der neuen
Geschirrsabrikation zu überzeugen und wurde nicht müde, immer neue
Muster zn fertigen und die Malerinnen, (die „Usmacherinnen") in deren
fänden die Dekoration der Gefäße lag, durch Belohnungen anznspornen.
An der alten Technik selbst, welche ihm wegen ihrer Einfachheit und
Ursprünglichkeit besonders zusagte, änderte er wenig; er hat es aber
verstanden, mit diesen primitiven Mitteln wahrhaft künstlerische
Wirkungen zu erzielen. Darin liegt vor Allem sein unantastbares
Verdienst und zugleich der Grund, wcßhalb seine Majoliken — wie
eingangs geschildert — auf der Ausstellung des Iahres (87S so be-
rechtigtes Aufsehen erregten. Daß die ihm als Aussteller damals zu
Theil gewordene Medaille auch mit vollem Recht ihm gebührte, das
konnten freilich die kleinlichen Haustöpfer nicht einsehen, welche ihr
eigenes Verdienst höher anschlugen als die geistige Thätigkeit des
Urhebers ihrer Erzeugnisse. Und doch zählen die von Keller für die
<j Die folgenden Angaben über die Thätigkeit Aeller's auf dem Gebiet der
Schweizerischen Majolikafabrikation beruhen z.Tb. auf brieflichen Mittheilungen des ver-
storbenen an den Verfasser (Frühjahr (883).
Zeitschrift des baser. Aunstgewerbe-Vcreins München.
(Sg(. Heft 3 ch 4 (Bg. 2).