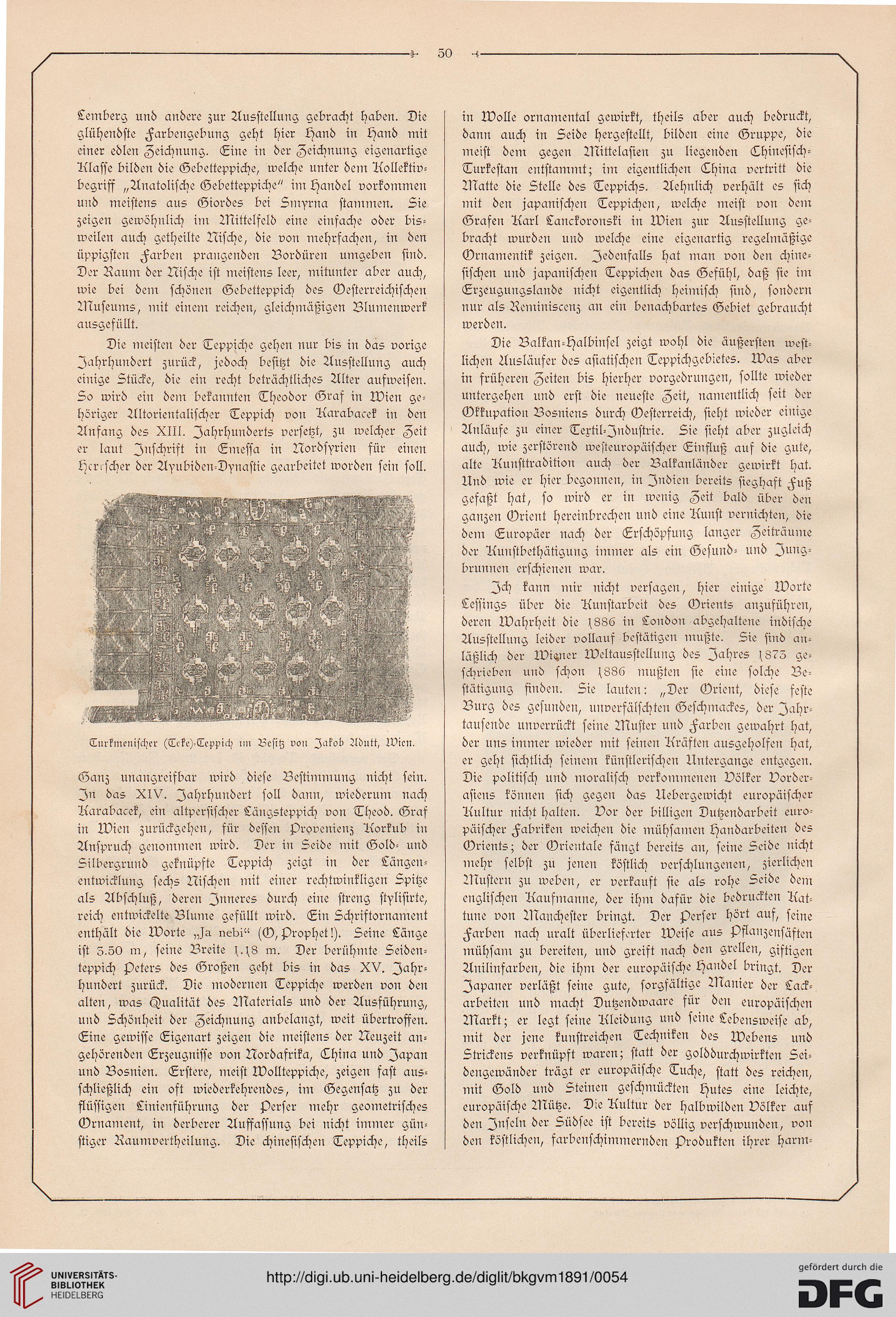Lemberg und andere zur Ausstellung gebracht haben. Die
glühendste Farbengebung geht hier Hand in Hand mit
einer edlen Zeichnung. Eine in der Zeichnung eigenartige
“Klaffe bilden die Gebetteppiche, welche unter dem Uollektiv-
begriff „Anatolische Gebetteppiche" im Handel Vorkommen
und meistens aus Giordes bei Smyrna stammen. Sie
zeigen gewöhnlich im Mittelfeld eine einsache oder bis-
weilen auch gctheilte Nische, die von mehrfachen, in den
üppigsten Farben prangenden Bordüren umgeben sind.
Der Raum der Nische ist meistens leer, mitunter aber auch,
wie bei dein schönen Gebetteppich des Dssterreichischen
Museums, mit einem reichen, gleichmäßigen Blumenwerk
ausgefüllt.
Die meiftert der Teppiche gehen nur bis in das vorige
Jahrhundert zurück, jedoch besitzt die Ausstellung auch
einige Stücke, die ein recht beträchtliches Alter aufweisen.
So wird ein dein bekannten Theodor Gras in Wien ge-
höriger Altorientalischer Teppich von Uarabacek in den
Anfang des XIII. Jahrhunderts versetzt, zu welcher Zeit
er laut Zuschrift in Emessa in Nordsyrien für einen
Hcrffcher der Ayubiden-Dynastie gearbeitet worden sein soll.
Turkmenischer (Tcke)-Teppich tm Besitz von Jakob Adutt, Wien.
Ganz unangreifbar wird diese Bestimmung nicht sein.
Zn das XIV. Zahrhundert soll dann, wiederum nach
Uarabacek, ein altpersischer Längsteppich von Theod. Graf
in Wien zurückgehen, für dessen Provenienz Uorkub in
Anspruch genommen wird. Der in Seide mit Gold- und
Silbergrund geknüpfte Teppich zeigt in der Längen-
entwicklung sechs Nischen mit einer rechtwinkligen Spitze
als Abschluß, deren Znneres durch eins streng stylisirte,
reich entwickelte Blume gefüllt wird. Ein Schriftornament
enthält die Morte „ja nebi“ (O, Prophet I). Seine Länge
ist 5.50 tn, feine Breite j.j8 m. Der berühmte Seidcn-
teppich Peters des Großen geht bis in das XV. Zahr-
hundert zurück. Die modernen Teppiche werden von den
alten, was Qualität des Materials und der Ausführung,
und Schönheit der Zeichnung anbelangt, weit übertroffen.
Eine gewisse Eigenart zeigen die meistens der Neuzeit an-
gehörenden Erzeugnisse von Nordafrika, Thina und Zapan
und Bosnien. Erstere, meist Mollteppiche, zeigen fast aus-
schließlich ein oft wiederkehrendes, inr Gegensatz zu der
flüssigen Linienführung der Perser mehr geometrisches
Ornament, in derberer Auffassung bei nicht immer gün-
stiger RaumvertheiluNg. Die chinesischen Teppiche, theils
in Molle ornamental gewirkt, theils aber auch bedruckt,
dann auch in Seide hergestellt, bilden eine Gruppe, die
ineist dem gegen Mittelasien zu liegenden Lhinesisch-
Turkestan entstammt; im eigentlichen Thina vertritt die
Matte die Stelle des Teppichs. Achnlich verhält es sich
mit den japanischen Teppichen, welche ineist von dein
Grafen Uarl Lanckoronski in Wien zur Ausstellung ge-
bracht wurden und welche eine eigenartig regelmäßige
Ornamentik zeigen. Zedenfalls hat man von den chine-
sischen und japanischen Teppichen das Gefühl, daß sie in:
Erzeugungslande nicht eigentlich heimisch sind, sondern
nur als Reiiiiniscenz an ein benachbartes Gebiet gebraucht
werden.
Die Balkan-Halbinsel zeigt wohl die äußersten west-
lichen Ausläufer des asiatischen Teppichgebietes, was aber
in früheren Zeiten bis hierher vorgedrungen, sollte wieder
untergehen und erst die neueste Zeit, namentlich seit der
Okkupation Bosniens durch Oesterreich, sieht wieder einige
Anläufe zu einer Textil-Zndustrie. Sie sieht aber zugleich
auch, wie zerstörend westeuropäischer Einfluß auf die gute,
alte Uunsttradition auch der Balkanländer gewirkt hat.
Und wie er hier begonnen, in Zndien bereits sieghaft Fuß
gefaßt hat, so wird er in wenig Zeit bald über den
ganzen Orient Hereinbrechen und eine Uunst vernichten, die
dem Europäer nach der Erschöpfung langer Zeiträume
der Uunstbethätigung immer als ein Gesund- und Zung-
brunnen erschienen war.
Zch kann mir nicht versagen, hier einige Worte
Lessings über die Uunstarbeit des Orients anzuführen,
deren Wahrheit die j886 in London abgehaltene indische
Ausstellung leider vollauf bestätigen mußte. Sie sind an-
läßlich der wiener Weltausstellung des Zahres j875 ge-
schrieben und schon f886 mußten sie eine solche Be-
stätigung finden. Sie lauten: „Der Grient, diese feste
Burg des gesunden, unverfälschten Geschmackes, der Zahr-
tausende unverrückt seine Muster und Farben gewahrt hat,
der uns immer wieder mit seinen Uräften ausgeholfen hat,
er geht sichtlich seinem künstlerischen Untergänge entgegen.
Die politisch und moralisch verkommenen Völker Vorder-
asiens können sich gegen das Uebergewicht europäischer
Uultur nicht halten. Vor der billigen Dutzendarbeit euro-
päischer Fabriken weichen die mühsamen Landarbeiten des
Orients; der Orientale fängt bereits an, feine Seide nicht
mehr selbst zu jenen köstlich verschlungenen, zierlichen
Mustern zu weben, er verkauft sie als rohe Seide dem
englischen Uaufmanne, der ihm dafür die bedruckten Uat-
tune von Manchester bringt. Der Perser hört auf, seine
Farben nach uralt überlieferter Meise aus Pflanzensäften
mühsam zu bereiten, und greift nach den grellen, giftigen
Anilinfarben, die ihm der europäische Handel bringt. Der
Zapaner verläßt seine gute, sorgfältige Manier der Lack-
arbeiten und macht Dutzendwaare für den europäischen
Markt; er legt seine Uleidung und seine Lebensweise ab,
mit der jene kunstreichen Techniken des Mebens und
Strickens verknüpft waren; statt der golddurchwirkten Sei-
dengewänder trägt er europäische Tuche, statt des reichen,
mit Gold und Steinen geschmückten Hutes eine leichte,
europäische Mütze. Die Uultur der halbwilden Völker auf
den Znseln der Südsee ist bereits völlig verschwunden, von
den köstlichen, farbenschimmernden Produkten ihrer Harm-
glühendste Farbengebung geht hier Hand in Hand mit
einer edlen Zeichnung. Eine in der Zeichnung eigenartige
“Klaffe bilden die Gebetteppiche, welche unter dem Uollektiv-
begriff „Anatolische Gebetteppiche" im Handel Vorkommen
und meistens aus Giordes bei Smyrna stammen. Sie
zeigen gewöhnlich im Mittelfeld eine einsache oder bis-
weilen auch gctheilte Nische, die von mehrfachen, in den
üppigsten Farben prangenden Bordüren umgeben sind.
Der Raum der Nische ist meistens leer, mitunter aber auch,
wie bei dein schönen Gebetteppich des Dssterreichischen
Museums, mit einem reichen, gleichmäßigen Blumenwerk
ausgefüllt.
Die meiftert der Teppiche gehen nur bis in das vorige
Jahrhundert zurück, jedoch besitzt die Ausstellung auch
einige Stücke, die ein recht beträchtliches Alter aufweisen.
So wird ein dein bekannten Theodor Gras in Wien ge-
höriger Altorientalischer Teppich von Uarabacek in den
Anfang des XIII. Jahrhunderts versetzt, zu welcher Zeit
er laut Zuschrift in Emessa in Nordsyrien für einen
Hcrffcher der Ayubiden-Dynastie gearbeitet worden sein soll.
Turkmenischer (Tcke)-Teppich tm Besitz von Jakob Adutt, Wien.
Ganz unangreifbar wird diese Bestimmung nicht sein.
Zn das XIV. Zahrhundert soll dann, wiederum nach
Uarabacek, ein altpersischer Längsteppich von Theod. Graf
in Wien zurückgehen, für dessen Provenienz Uorkub in
Anspruch genommen wird. Der in Seide mit Gold- und
Silbergrund geknüpfte Teppich zeigt in der Längen-
entwicklung sechs Nischen mit einer rechtwinkligen Spitze
als Abschluß, deren Znneres durch eins streng stylisirte,
reich entwickelte Blume gefüllt wird. Ein Schriftornament
enthält die Morte „ja nebi“ (O, Prophet I). Seine Länge
ist 5.50 tn, feine Breite j.j8 m. Der berühmte Seidcn-
teppich Peters des Großen geht bis in das XV. Zahr-
hundert zurück. Die modernen Teppiche werden von den
alten, was Qualität des Materials und der Ausführung,
und Schönheit der Zeichnung anbelangt, weit übertroffen.
Eine gewisse Eigenart zeigen die meistens der Neuzeit an-
gehörenden Erzeugnisse von Nordafrika, Thina und Zapan
und Bosnien. Erstere, meist Mollteppiche, zeigen fast aus-
schließlich ein oft wiederkehrendes, inr Gegensatz zu der
flüssigen Linienführung der Perser mehr geometrisches
Ornament, in derberer Auffassung bei nicht immer gün-
stiger RaumvertheiluNg. Die chinesischen Teppiche, theils
in Molle ornamental gewirkt, theils aber auch bedruckt,
dann auch in Seide hergestellt, bilden eine Gruppe, die
ineist dem gegen Mittelasien zu liegenden Lhinesisch-
Turkestan entstammt; im eigentlichen Thina vertritt die
Matte die Stelle des Teppichs. Achnlich verhält es sich
mit den japanischen Teppichen, welche ineist von dein
Grafen Uarl Lanckoronski in Wien zur Ausstellung ge-
bracht wurden und welche eine eigenartig regelmäßige
Ornamentik zeigen. Zedenfalls hat man von den chine-
sischen und japanischen Teppichen das Gefühl, daß sie in:
Erzeugungslande nicht eigentlich heimisch sind, sondern
nur als Reiiiiniscenz an ein benachbartes Gebiet gebraucht
werden.
Die Balkan-Halbinsel zeigt wohl die äußersten west-
lichen Ausläufer des asiatischen Teppichgebietes, was aber
in früheren Zeiten bis hierher vorgedrungen, sollte wieder
untergehen und erst die neueste Zeit, namentlich seit der
Okkupation Bosniens durch Oesterreich, sieht wieder einige
Anläufe zu einer Textil-Zndustrie. Sie sieht aber zugleich
auch, wie zerstörend westeuropäischer Einfluß auf die gute,
alte Uunsttradition auch der Balkanländer gewirkt hat.
Und wie er hier begonnen, in Zndien bereits sieghaft Fuß
gefaßt hat, so wird er in wenig Zeit bald über den
ganzen Orient Hereinbrechen und eine Uunst vernichten, die
dem Europäer nach der Erschöpfung langer Zeiträume
der Uunstbethätigung immer als ein Gesund- und Zung-
brunnen erschienen war.
Zch kann mir nicht versagen, hier einige Worte
Lessings über die Uunstarbeit des Orients anzuführen,
deren Wahrheit die j886 in London abgehaltene indische
Ausstellung leider vollauf bestätigen mußte. Sie sind an-
läßlich der wiener Weltausstellung des Zahres j875 ge-
schrieben und schon f886 mußten sie eine solche Be-
stätigung finden. Sie lauten: „Der Grient, diese feste
Burg des gesunden, unverfälschten Geschmackes, der Zahr-
tausende unverrückt seine Muster und Farben gewahrt hat,
der uns immer wieder mit seinen Uräften ausgeholfen hat,
er geht sichtlich seinem künstlerischen Untergänge entgegen.
Die politisch und moralisch verkommenen Völker Vorder-
asiens können sich gegen das Uebergewicht europäischer
Uultur nicht halten. Vor der billigen Dutzendarbeit euro-
päischer Fabriken weichen die mühsamen Landarbeiten des
Orients; der Orientale fängt bereits an, feine Seide nicht
mehr selbst zu jenen köstlich verschlungenen, zierlichen
Mustern zu weben, er verkauft sie als rohe Seide dem
englischen Uaufmanne, der ihm dafür die bedruckten Uat-
tune von Manchester bringt. Der Perser hört auf, seine
Farben nach uralt überlieferter Meise aus Pflanzensäften
mühsam zu bereiten, und greift nach den grellen, giftigen
Anilinfarben, die ihm der europäische Handel bringt. Der
Zapaner verläßt seine gute, sorgfältige Manier der Lack-
arbeiten und macht Dutzendwaare für den europäischen
Markt; er legt seine Uleidung und seine Lebensweise ab,
mit der jene kunstreichen Techniken des Mebens und
Strickens verknüpft waren; statt der golddurchwirkten Sei-
dengewänder trägt er europäische Tuche, statt des reichen,
mit Gold und Steinen geschmückten Hutes eine leichte,
europäische Mütze. Die Uultur der halbwilden Völker auf
den Znseln der Südsee ist bereits völlig verschwunden, von
den köstlichen, farbenschimmernden Produkten ihrer Harm-