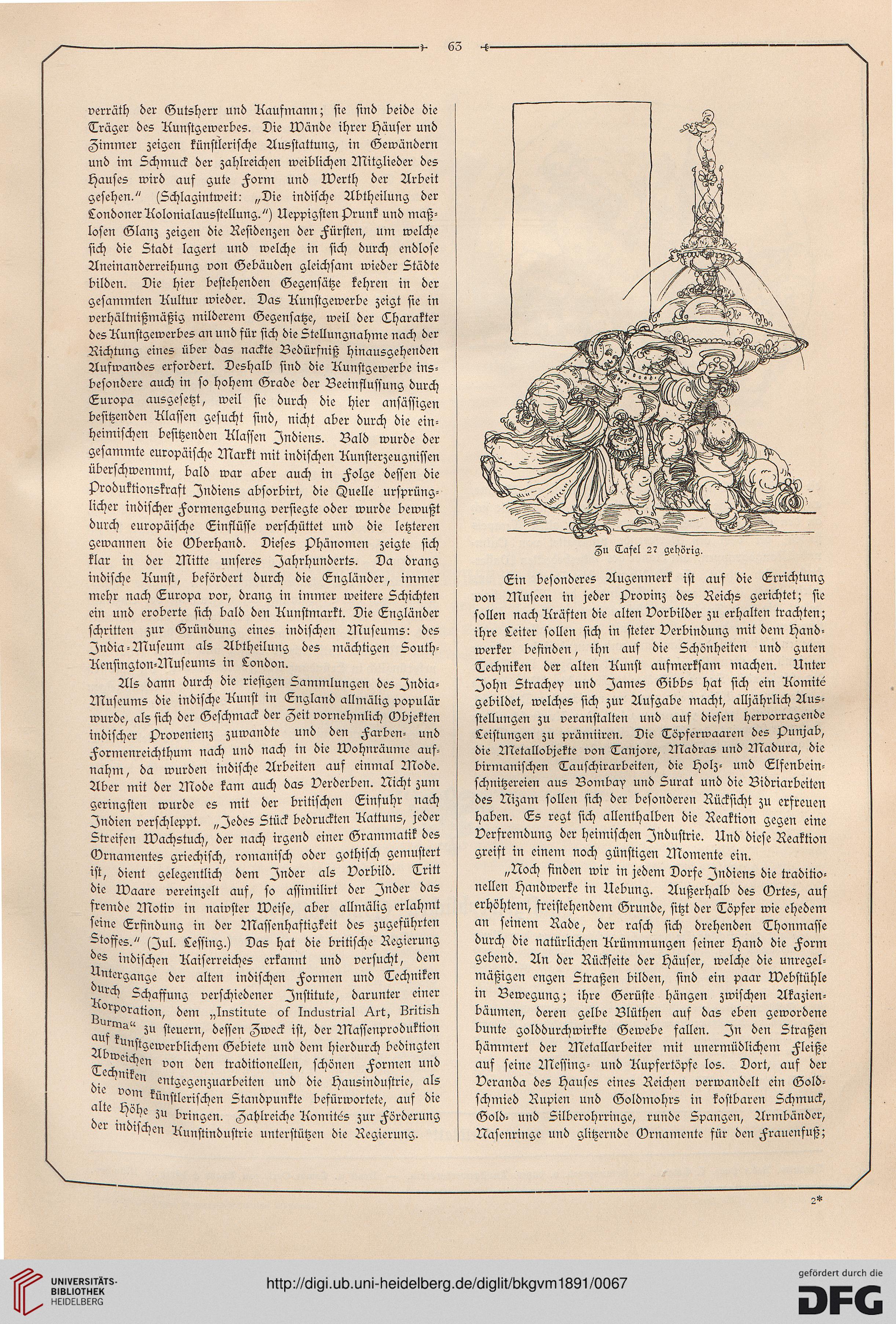65
verräth der Gutsherr und Kaufmann; sie sind beide die
Träger des Kunstgewerbes. Die Wände ihrer Häuser und
Zimmer zeigen künstlerische Ausstattung, in Gewändern
und im Schmuck der zahlreichen weiblichen Mitglieder des
Hauses wird auf gute Form und Werth der Arbeit
gesehen." (Schlagintweit: „Die indische Abtheilung der
Londoner Kolonialausstellung.") Ueppigsten Prunk und maß-
losen Glanz zeigen die Residenzen der Fürsten, um welche
sich die Stadt lagert und welche in sich durch endlose
Aneinanderreihung von Gebäuden gleichsam wieder Städte
bilden. Die hier bestehenden Gegensätze kehren in der
gesammten Kultur wieder. Das Kunstgewerbe zeigt sie in
verhältnißmäßig milderem Gegensätze, weil der Charakter
des Kunstgewerbes an und für sich die Stellungnahme nach der
Richtung eines über das nackte Bedürfniß hinausgehenden
Aufwandes erfordert. Deshalb sind die Kunstgewerbe ins-
besondere auch in so hohem Grade der Beeinflussung durch
Luropa ausgesetzt, weil sie durch die hier ansässigen
besitzenden Klassen gesucht sind, nicht aber durch die ein-
heimischen besitzenden Klassen Indiens. Bald wurde der
gesummte europäische Markt mit indischen Kunsterzeugnissen
überschwemmt, bald war aber auch in Folge dessen die
Produktionskraft Indiens abforbirt, die Quelle ursprüng-
licher indischer Formengebung versiegte oder wurde bewußt
durch europäische Einflüsse verschüttet und die letzteren
gewannen die (Oberhand. Dieses Phänomen zeigte sich
klar in der Witte unseres Jahrhunderts. Da drang
indische Kunst, befördert durch die Engländer, immer
mehr nach Europa vor, drang in immer weitere Schichten
ein und eroberte sich bald den Kunstmarkt. Die Engländer
schritten zur Gründung eines indischen Museums: des
India- Museum als Abtheilung des mächtigen South-
Kensington-Muscums in London.
Als dann durch die riesigen Sammlungen des India-
Museums die indische Kunst in England allmälig populär
wurde, als sich der Geschmack der Zeit vornehmlich Objekten
indischer Provenienz zuwandte und den Farben- und
Formenreichthum nach und nach in die wohnräume auf-
nahm , da wurden indische Arbeiten auf einmal Mode.
Aber mit der Mode kam auch das Verderben. Mcht zum
geringsten wurde es mit der britischen Einfuhr nach
Indien verschleppt. „Jedes Stück bedruckten Kattuns, jeder
Streifen Wachstuch, der nach irgend einer Grammatik des
Ornamentes griechisch, romanisch oder gothisch gemustert
ist, dient gelegentlich dem Inder als Vorbild. Tritt
die Waare vereinzelt auf, so assimilirt der Inder das
sremde Motiv in naivster Weise, aber allmälig erlahmt
seine Erfindung in der Massenhaftigkeit des zugeführten
Stoffes." (Jul. Lessing.) Das hat die britische Regierung
^es indischen Kaiserreiches erkannt und versucht, dem
Uute
ergauge der alten indischen Formen und Techniken
ch Schaffung verschiedener Institute, darunter einer
g0rPoration, dem „Institute of Industrial Art, British
auf ^uern, dessen Zweck ist, der Massenproduktion
^^flstgewerblichem Gebiete und dem hierdurch bedingten
durch
Techniken
die
von den traditionellen, schönen Formen und
entgegenzuarbeiten und die Hausindustrie, als
alt' ty'n ^"^lerischen Standpunkte befürwortete, auf die
, . '0 ■ 3U bringen. Zahlreiche Komites zur Förderung
Ul m ^ Kunstindustrie unterstützen die Regierung.
Lin besonderes Augenmerk ist auf die Errichtung
von Museen in jeder Provinz des Reichs gerichtet; sie
sollen nach Kräften die alten Vorbilder zu erhalten trachten;
ihre Leiter sollen sich in steter Verbindung mit dem Hand-
werker befinden, ihn auf die Schönheiten und guten
Techniken der alten Kunst aufmerksam machen. Unter-
John Strachey und James Gibbs hat sich ein Komite
gebildet, welches sich zur Aufgabe macht, alljährlich Aus-
stellungen zu veranstalten und auf diesen hervorragende
Leistungen zu prämiiren. Die Töpferwaarcn des Punjab,
die Metallobjekte von Tanjore, Madras und Uladura, die
birmanischen Tauschirarbeiten, die Holz- und Elfenbein-
schnitzereien aus Bombay und Surat und die Bidriarbeiten
des Nizam sollen sich der besonderen Rücksicht zu erfreuen
haben. Ls regt sich allenthalben die Reaktion gegen eine
Verfremdung der heimischen Industrie. Und diese Reaktion
greift in einem noch günstigen Momente ein.
„Xcod) finden wir in jedenr Dorfe Indiens die traditio-
nellen Handwerke in Uebung. Außerhalb des Ortes, auf
erhöhtem, freistehendem Grunde, sitzt der Töpfer wie ehedem
an seinem Rade, der rasch sich drehenden Thonmasse
durch die natürlichen Krümmungen seiner Hand die Form
gebend. An der Rückseite der Häuser, welche die unregel-
mäßigen engen Straßen bilden, sind ein paar Webstühle
in Bewegung; ihre Gerüste hängen zwischen Akazien-
bäumen, deren gelbe Blüthen auf das eben gewordene
bunte golddurchwirkte Gewebe fallen. In den Straßen
hämmert der Metallarbeiter mit unermüdlichem Fleiße
auf feine XUeffing- und Kupfertöpfe los. Dort, auf der
Veranda des Hauses eines Reichen verwandelt ein Gold-
schmied Rupien und Goldmohrs in kostbaren Schmuck,
Gold- und Silberohrringe, runde Spangen, Armbänder,
Nasenringe und glitzernde Ornamente für den Fraucnsuß;
2*