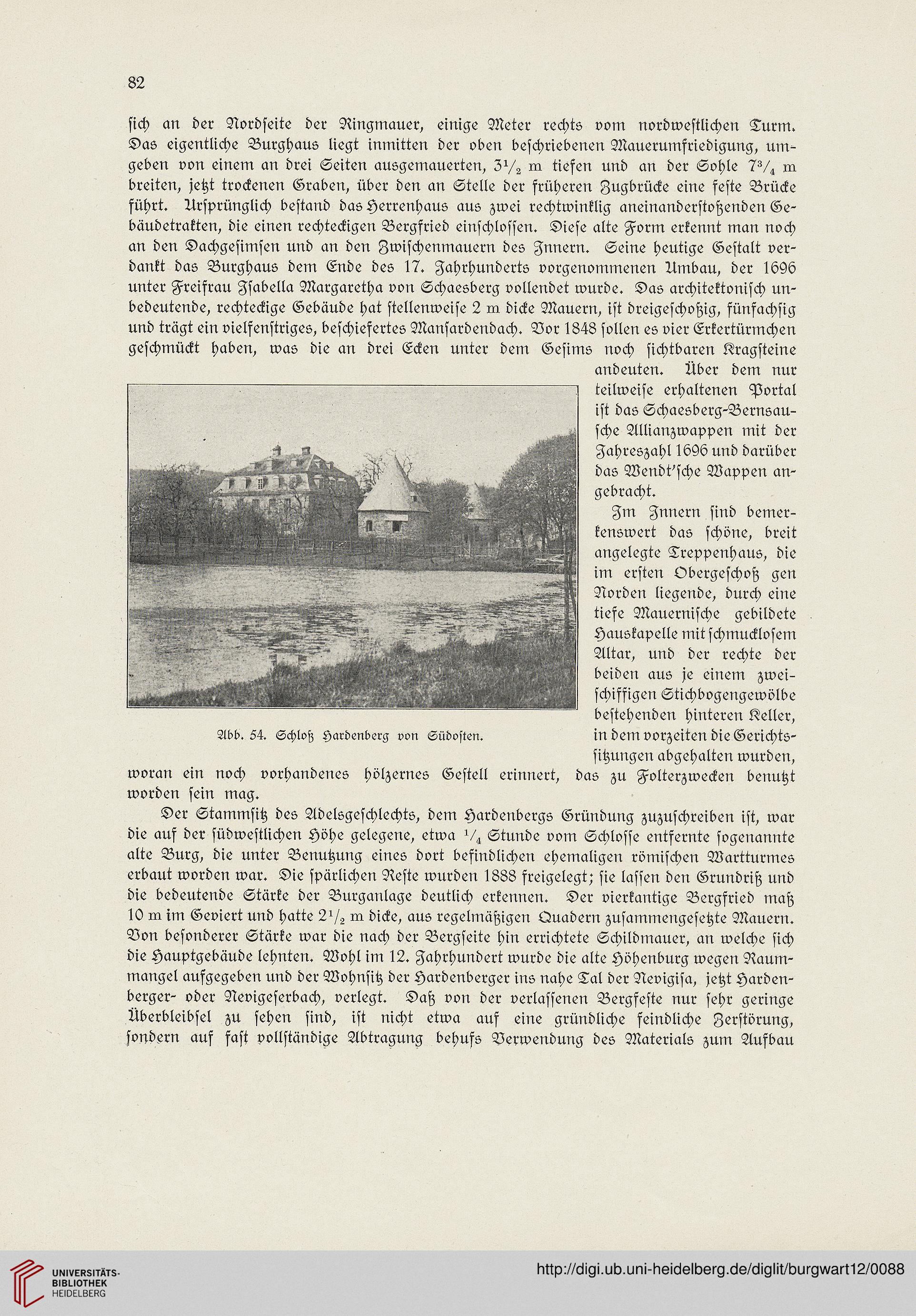82
sich an der Nordseite der Ringmauer, einige Meter rechts vom nordwestlichen Turm.
Das eigentliche Burghaus liegt inmitten der oben beschriebenen Mauerumsriedigung, um-
geben von einem an drei Seiten ausgemauerten, ZVz m tiefen und an der Sohle 7»/^ m
breiten, jetzt trockenen Graben, über den an Stelle der früheren Zugbrücke eine feste Brücke
führt. Ursprünglich bestand das Herrenhaus aus zwei rechtwinklig aneinanderstoßenden Ge-
bäudetrakten, die einen rechteckigen Bergfried einschlossen. Diese alte Form erkennt man noch
an den Dachgesimsen und an den Zwischenmauern des Innern. Seine heutige Gestalt ver-
dankt das Burghaus dem Ende des 17. Jahrhunderts vorgenommenen Umbau, der 1696
unter Freifrau Isabella Margaretha von Schaesberg vollendet wurde. Das architektonisch un-
bedeutende, rechteckige Gebäude hat stellenweise 2 m dicke Mauern, ist dreigeschoßig, fünfachsig
und trägt ein vielfenstriges, beschiesertes Mansardendach. Vor 1848 sollen es vier Erkertürmchen
geschmückt haben, was die an drei Ecken unter dem Gesims noch sichtbaren Kragsteine
andeuten. Uber dem nur
teilweise erhaltenen Portal
ist das Schaesberg-Bernsau-
sche Allianzwappen mit der
Jahreszahl 1696 und darüber
das Wendische Wappen an-
gebracht.
Im Innern sind bemer-
kenswert das schöne, breit
angelegte Treppenhaus, die
im ersten Obergeschoß gen
Norden liegende, durch eine
tiefe Mauernische gebildete
Hauskapelle mit schmucklosem
Altar, und der rechte der
beiden ans je einem zwei-
schisfigcn Stichbogengewölbe
bestehenden Hinteren Keller,
in dem vorzeiten die Gerichts-
sitzungen abgehalten wurden,
woran ein noch vorhandenes hölzernes Gestell erinnert, das zu Folterzwecken benutzt
worden sein mag.
Der Stammsitz des Adelsgeschlechts, dem Hardenbergs Gründung zuznschreiben ist, war
die aus der südwestlichen Höhe gelegene, etwa Stunde vom Schlosse entfernte sogenannte
alte Burg, die unter Benutzung eines dort befindlichen ehemaligen römischen Wartturmes
erbaut worden war. Die spärlichen Reste wurden 1888 sreigelegt; sie lassen den Grundriß und
die bedeutende Stärke der Burganlage deutlich erkennen. Der vierkantige Bergfried maß
IO m im Geviert und hatte 2^/z m dicke, aus regelmäßigen Quadern zusammengesetzte Mauern.
Von besonderer Stärke war die nach der Bergseite hin errichtete Schildmauer, an welche sich
die Hauptgebäude lehnten. Wohl im l2. Jahrhundert wurde die alte Höhenburg wegen Raum-
mangel aufgegeben und der Wohnsitz der Hardenberger ins nahe Tal der Nevigisa, jetzt Harden-
berger- oder Nevigeserbach, verlegt. Daß von der verlassenen Bergfeste nur sehr geringe
Überbleibsel zu sehen sind, ist nicht etwa auf eine gründliche feindliche Zerstörung,
sondern aus fast vollständige Abtragung behufs Verwendung des Materials zum Ausbau
sich an der Nordseite der Ringmauer, einige Meter rechts vom nordwestlichen Turm.
Das eigentliche Burghaus liegt inmitten der oben beschriebenen Mauerumsriedigung, um-
geben von einem an drei Seiten ausgemauerten, ZVz m tiefen und an der Sohle 7»/^ m
breiten, jetzt trockenen Graben, über den an Stelle der früheren Zugbrücke eine feste Brücke
führt. Ursprünglich bestand das Herrenhaus aus zwei rechtwinklig aneinanderstoßenden Ge-
bäudetrakten, die einen rechteckigen Bergfried einschlossen. Diese alte Form erkennt man noch
an den Dachgesimsen und an den Zwischenmauern des Innern. Seine heutige Gestalt ver-
dankt das Burghaus dem Ende des 17. Jahrhunderts vorgenommenen Umbau, der 1696
unter Freifrau Isabella Margaretha von Schaesberg vollendet wurde. Das architektonisch un-
bedeutende, rechteckige Gebäude hat stellenweise 2 m dicke Mauern, ist dreigeschoßig, fünfachsig
und trägt ein vielfenstriges, beschiesertes Mansardendach. Vor 1848 sollen es vier Erkertürmchen
geschmückt haben, was die an drei Ecken unter dem Gesims noch sichtbaren Kragsteine
andeuten. Uber dem nur
teilweise erhaltenen Portal
ist das Schaesberg-Bernsau-
sche Allianzwappen mit der
Jahreszahl 1696 und darüber
das Wendische Wappen an-
gebracht.
Im Innern sind bemer-
kenswert das schöne, breit
angelegte Treppenhaus, die
im ersten Obergeschoß gen
Norden liegende, durch eine
tiefe Mauernische gebildete
Hauskapelle mit schmucklosem
Altar, und der rechte der
beiden ans je einem zwei-
schisfigcn Stichbogengewölbe
bestehenden Hinteren Keller,
in dem vorzeiten die Gerichts-
sitzungen abgehalten wurden,
woran ein noch vorhandenes hölzernes Gestell erinnert, das zu Folterzwecken benutzt
worden sein mag.
Der Stammsitz des Adelsgeschlechts, dem Hardenbergs Gründung zuznschreiben ist, war
die aus der südwestlichen Höhe gelegene, etwa Stunde vom Schlosse entfernte sogenannte
alte Burg, die unter Benutzung eines dort befindlichen ehemaligen römischen Wartturmes
erbaut worden war. Die spärlichen Reste wurden 1888 sreigelegt; sie lassen den Grundriß und
die bedeutende Stärke der Burganlage deutlich erkennen. Der vierkantige Bergfried maß
IO m im Geviert und hatte 2^/z m dicke, aus regelmäßigen Quadern zusammengesetzte Mauern.
Von besonderer Stärke war die nach der Bergseite hin errichtete Schildmauer, an welche sich
die Hauptgebäude lehnten. Wohl im l2. Jahrhundert wurde die alte Höhenburg wegen Raum-
mangel aufgegeben und der Wohnsitz der Hardenberger ins nahe Tal der Nevigisa, jetzt Harden-
berger- oder Nevigeserbach, verlegt. Daß von der verlassenen Bergfeste nur sehr geringe
Überbleibsel zu sehen sind, ist nicht etwa auf eine gründliche feindliche Zerstörung,
sondern aus fast vollständige Abtragung behufs Verwendung des Materials zum Ausbau