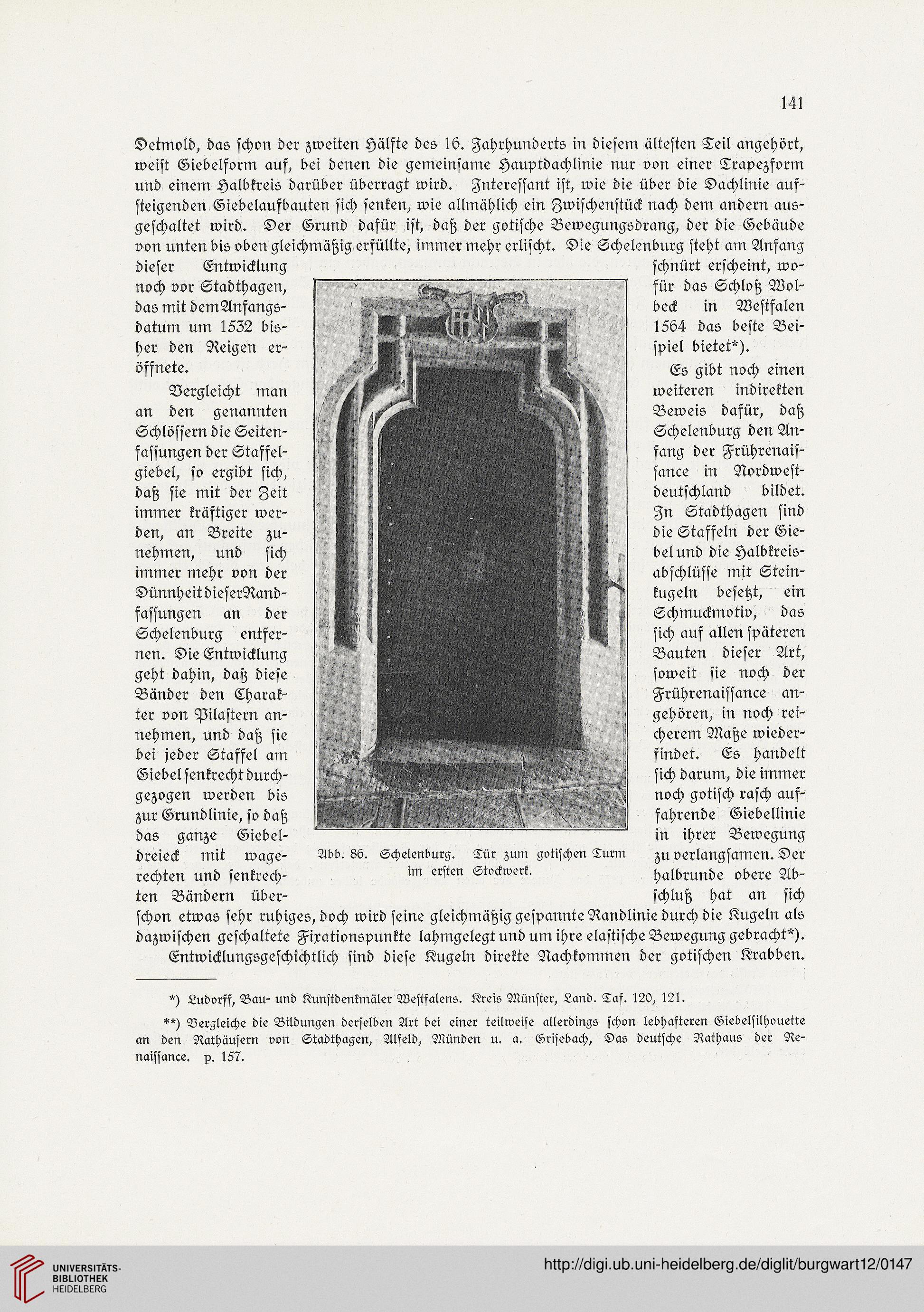141
Detmold, das schon der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in diesem ältesten Teil angehört,
weist Giebelsorm auf, bei denen die gemeinsame Hauptdachlinie nur von einer Trapczform
und einem Halbkreis darüber überragt wird. Interessant ist, wie die über die Dachlinie aus-
steigenden Giebelausbauten sich senken, wie allmählich ein Zwischenstück nach dem andern aus-
geschaltet wird. Der Grund dafür ist, daß der gotische Bewegungsdrang, der die Gebäude
von unten bis oben gleichmäßig erfüllte, immer mehr erlischt. Die Schelenburg steht am Anfang
dieser Entwicklung
noch vor Stadthagen,
das mit dem Anfangs-
datum um 1532 bis-
her den Neigen er-
ösfnete.
Vergleicht man
an den genannten
Schlössern die Seiten-
sassungen der Staffel-
giebel, so ergibt sich,
daß sie mit der Zeit
immer kräftiger wer-
den, an Breite zu-
nehmen, und sich
immer mehr von der
Dünnheit dieserRand-
fassungen an der
Schelenburg entfer-
nen. Die Entwicklung
geht dahin, daß diese
Bänder den Charak-
ter von Pilastern an-
nehmen, und daß sie
bei jeder Staffel am
Giebel senkrecht durch-
gezogen werden bis
zur Grundlinie, so daß
das ganze Giebel-
dreieck mit wage-
rechten und senkrech-
ten Bändern über-
Abb. 86. Schelenburg. Tür zum gotischen Turin
im ersten Stockwerk.
schnürt erscheint, wo-
für das Schloß Wol-
beck in Westfalen
1564 das beste Bei-
spiel bietet* **)).
Es gibt noch einen
weiteren indirekten
Beweis dafür, daß
Schelenburg den An-
fang der Frührenais-
sance in Nordwest-
deutschland bildet.
In Stadthagen sind
die Staffeln der Gie-
bel und die Halbkreis-
abschlüsse mit Stein-
kugeln beseht, ein
Schmuckmotiv, das
sich auf allen späteren
Bauten dieser Art,
soweit sie noch der
Frührenaissance an-
gehören, in noch rei-
cherem Maße wieder-
findet. Es handelt
sich darum, die immer-
noch gotisch rasch auf-
fahrende Giebellinie
in ihrer Bewegung
zu verlangsamen. Der
halbrunde obere Ab-
schluß hat an sich
schon etwas sehr ruhiges, doch wird seine gleichmäßig gespannte Randlinie durch die Kugeln als
dazwischen geschaltete Fipationspunkte lahmgelegt und um ihre elastische Bewegung gebracht*).
Entwicklungsgeschichtlich sind diese Kugeln direkte Nachkommen der gotischen Krabben.
*) Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens. Kreis Münster, Land. Taf. 120, 12l.
**) Vergleiche die Bildungen derselben Art bei einer teilweise allerdings schon lebhafteren Giebelsilhouette
an den Rathäusern von Stadthagen, Alfeld, Münden u. a. Grisebach, Das deutsche Rathaus der Re-
naissance. x>. lS7.
Detmold, das schon der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in diesem ältesten Teil angehört,
weist Giebelsorm auf, bei denen die gemeinsame Hauptdachlinie nur von einer Trapczform
und einem Halbkreis darüber überragt wird. Interessant ist, wie die über die Dachlinie aus-
steigenden Giebelausbauten sich senken, wie allmählich ein Zwischenstück nach dem andern aus-
geschaltet wird. Der Grund dafür ist, daß der gotische Bewegungsdrang, der die Gebäude
von unten bis oben gleichmäßig erfüllte, immer mehr erlischt. Die Schelenburg steht am Anfang
dieser Entwicklung
noch vor Stadthagen,
das mit dem Anfangs-
datum um 1532 bis-
her den Neigen er-
ösfnete.
Vergleicht man
an den genannten
Schlössern die Seiten-
sassungen der Staffel-
giebel, so ergibt sich,
daß sie mit der Zeit
immer kräftiger wer-
den, an Breite zu-
nehmen, und sich
immer mehr von der
Dünnheit dieserRand-
fassungen an der
Schelenburg entfer-
nen. Die Entwicklung
geht dahin, daß diese
Bänder den Charak-
ter von Pilastern an-
nehmen, und daß sie
bei jeder Staffel am
Giebel senkrecht durch-
gezogen werden bis
zur Grundlinie, so daß
das ganze Giebel-
dreieck mit wage-
rechten und senkrech-
ten Bändern über-
Abb. 86. Schelenburg. Tür zum gotischen Turin
im ersten Stockwerk.
schnürt erscheint, wo-
für das Schloß Wol-
beck in Westfalen
1564 das beste Bei-
spiel bietet* **)).
Es gibt noch einen
weiteren indirekten
Beweis dafür, daß
Schelenburg den An-
fang der Frührenais-
sance in Nordwest-
deutschland bildet.
In Stadthagen sind
die Staffeln der Gie-
bel und die Halbkreis-
abschlüsse mit Stein-
kugeln beseht, ein
Schmuckmotiv, das
sich auf allen späteren
Bauten dieser Art,
soweit sie noch der
Frührenaissance an-
gehören, in noch rei-
cherem Maße wieder-
findet. Es handelt
sich darum, die immer-
noch gotisch rasch auf-
fahrende Giebellinie
in ihrer Bewegung
zu verlangsamen. Der
halbrunde obere Ab-
schluß hat an sich
schon etwas sehr ruhiges, doch wird seine gleichmäßig gespannte Randlinie durch die Kugeln als
dazwischen geschaltete Fipationspunkte lahmgelegt und um ihre elastische Bewegung gebracht*).
Entwicklungsgeschichtlich sind diese Kugeln direkte Nachkommen der gotischen Krabben.
*) Ludorff, Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens. Kreis Münster, Land. Taf. 120, 12l.
**) Vergleiche die Bildungen derselben Art bei einer teilweise allerdings schon lebhafteren Giebelsilhouette
an den Rathäusern von Stadthagen, Alfeld, Münden u. a. Grisebach, Das deutsche Rathaus der Re-
naissance. x>. lS7.