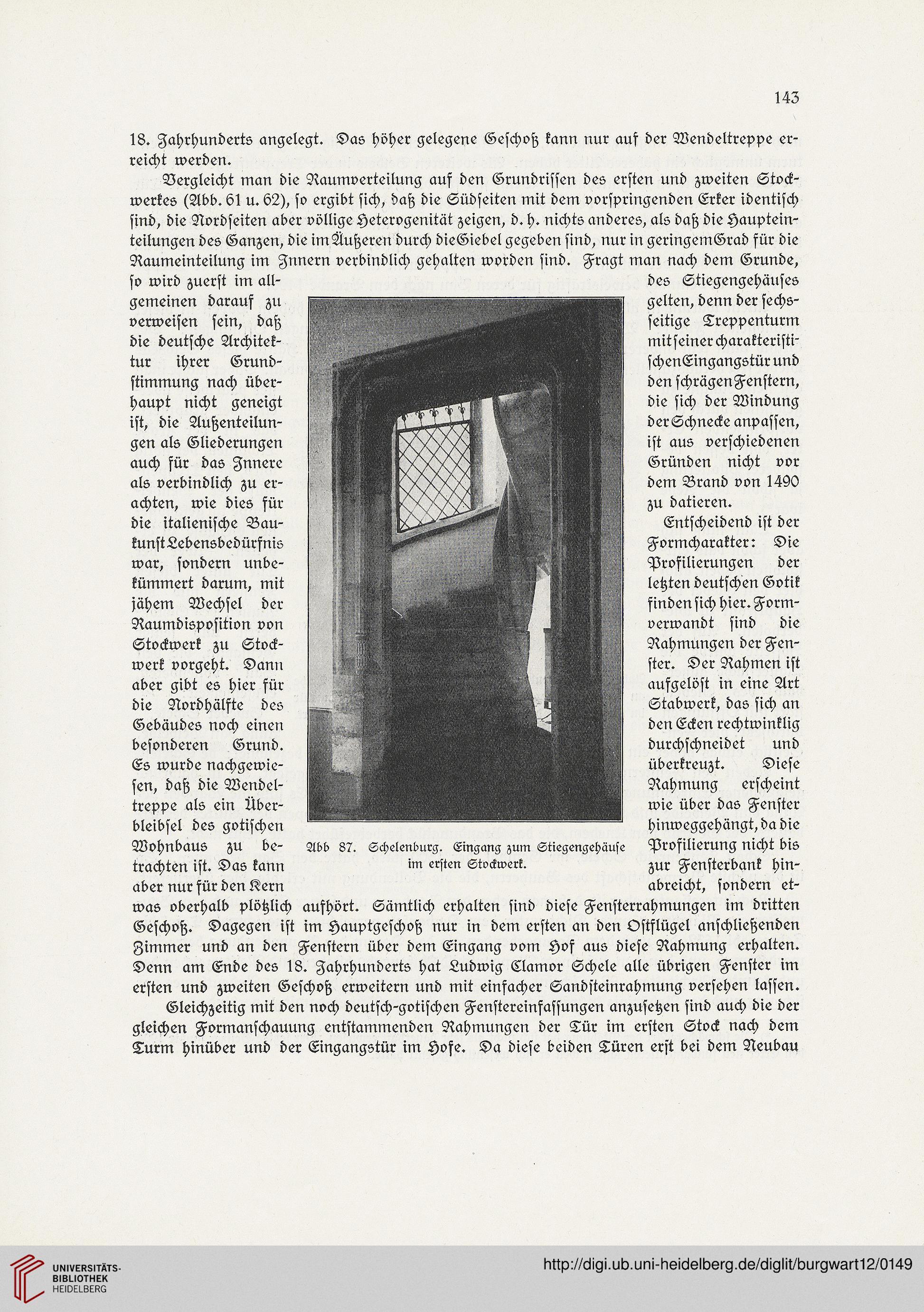I4Z
18. Jahrhunderts angelegt. Das höher gelegene Geschoß kann nur auf der Wendeltreppe er-
reicht werden.
Vergleicht man die Raumverteilung auf den Grundrissen des ersten und zweiten Stock-
werkes (Abb. 61 u. 62), so ergibt sich, daß die Südseiten mit dem vorspringenden Erker identisch
sind, die Nordseiten aber völlige Heterogenität zeigen, d. h. nichts anderes, als daß die Hauptein-
teilungen des Ganzen, die imÄußeren durch dieGiebel gegeben sind, nur in geringemGrad für die
Raumeinteilung im Innern verbindlich gehalten worden sind. Fragt man nach dem Grunde,
so wird zuerst im all-
gemeinen darauf zu
verweisen sein, daß
die deutsche Architek-
tur ihrer Grund-
stimmung nach über-
haupt nicht geneigt
ist, die Außenteilun-
gen als Gliederungen
auch für das Innere
als verbindlich zu er-
achten, wie dies für
die italienische Bau-
kunst Lebensbedürfnis
war, sondern unbe-
kümmert darum, mit
jähem Wechsel der
Raumdisposition von
Stockwerk zu Stock-
werk vorgeht. Dann
aber gibt es hier für
die Nvrdhälste des
Gebäudes noch einen
besonderen Grund.
Es wurde nachgewie-
sen, daß die Wendel-
treppe als ein Über-
bleibsel des gotischen
Wohnbaus zu be-
trachten ist. Das kann
aber nur für den Kern
was oberhalb plötzlich
Geschoß. Dagegen ist
Zimmer und an den
des Stiegengehäuses
gelten, denn der sechs-
seitige Treppenturm
mit seiner charakteristb
schenEingangstür und
den schrägenFenstern,
die sich der Windung
derSchnecke anpassen,
ist aus verschiedenen
Gründen nicht vor
dem Brand von 1490
zu datieren.
Entscheidend ist der
Formcharakter: Die
Profilierungen der
letzten deutschen Gotik
finden sich hier. Form-
verwandt sind die
Rahmungen der Fen-
ster. Der Rahmen ist
aufgelöst in eine Art
Stabwerk, das sich an
den Ecken rechtwinklig
durchschneidet und
überkreuzt. Diese
Rahmung erscheint
wie über das Fenster
hinweggehängt, da die
Profilierung nicht bis
zur Fensterbank hin-
abreicht, sondern et-
aufhört. Sämtlich erhalten sind diese Fensterrahmungen im dritten
im Hauptgeschoß nur in dem ersten an den Ostslügel anschließenden
Fenstern über dem Eingang vom Hof aus diese Rahmung erhalten.
Abb 87. Schelenburg. Eingang zum Stiegengehäuse
im ersten Stockwerk.
Denn am Ende des 18. Jahrhunderts hat Ludwig Clamor Schele alle übrigen Fenster im
ersten und zweiten Geschoß erweitern und mit einfacher Sandsteinrahmung versehen lassen.
Gleichzeitig mit den noch deutsch-gotischen Fenstereinfassungen anzusehen sind auch die der
gleichen Formanschauung entstammenden Rahmungen der Tür im ersten Stock nach dem
Turm hinüber und der Eingangstür im Hose. Da diese beiden Türen erst bei dem Neubau
18. Jahrhunderts angelegt. Das höher gelegene Geschoß kann nur auf der Wendeltreppe er-
reicht werden.
Vergleicht man die Raumverteilung auf den Grundrissen des ersten und zweiten Stock-
werkes (Abb. 61 u. 62), so ergibt sich, daß die Südseiten mit dem vorspringenden Erker identisch
sind, die Nordseiten aber völlige Heterogenität zeigen, d. h. nichts anderes, als daß die Hauptein-
teilungen des Ganzen, die imÄußeren durch dieGiebel gegeben sind, nur in geringemGrad für die
Raumeinteilung im Innern verbindlich gehalten worden sind. Fragt man nach dem Grunde,
so wird zuerst im all-
gemeinen darauf zu
verweisen sein, daß
die deutsche Architek-
tur ihrer Grund-
stimmung nach über-
haupt nicht geneigt
ist, die Außenteilun-
gen als Gliederungen
auch für das Innere
als verbindlich zu er-
achten, wie dies für
die italienische Bau-
kunst Lebensbedürfnis
war, sondern unbe-
kümmert darum, mit
jähem Wechsel der
Raumdisposition von
Stockwerk zu Stock-
werk vorgeht. Dann
aber gibt es hier für
die Nvrdhälste des
Gebäudes noch einen
besonderen Grund.
Es wurde nachgewie-
sen, daß die Wendel-
treppe als ein Über-
bleibsel des gotischen
Wohnbaus zu be-
trachten ist. Das kann
aber nur für den Kern
was oberhalb plötzlich
Geschoß. Dagegen ist
Zimmer und an den
des Stiegengehäuses
gelten, denn der sechs-
seitige Treppenturm
mit seiner charakteristb
schenEingangstür und
den schrägenFenstern,
die sich der Windung
derSchnecke anpassen,
ist aus verschiedenen
Gründen nicht vor
dem Brand von 1490
zu datieren.
Entscheidend ist der
Formcharakter: Die
Profilierungen der
letzten deutschen Gotik
finden sich hier. Form-
verwandt sind die
Rahmungen der Fen-
ster. Der Rahmen ist
aufgelöst in eine Art
Stabwerk, das sich an
den Ecken rechtwinklig
durchschneidet und
überkreuzt. Diese
Rahmung erscheint
wie über das Fenster
hinweggehängt, da die
Profilierung nicht bis
zur Fensterbank hin-
abreicht, sondern et-
aufhört. Sämtlich erhalten sind diese Fensterrahmungen im dritten
im Hauptgeschoß nur in dem ersten an den Ostslügel anschließenden
Fenstern über dem Eingang vom Hof aus diese Rahmung erhalten.
Abb 87. Schelenburg. Eingang zum Stiegengehäuse
im ersten Stockwerk.
Denn am Ende des 18. Jahrhunderts hat Ludwig Clamor Schele alle übrigen Fenster im
ersten und zweiten Geschoß erweitern und mit einfacher Sandsteinrahmung versehen lassen.
Gleichzeitig mit den noch deutsch-gotischen Fenstereinfassungen anzusehen sind auch die der
gleichen Formanschauung entstammenden Rahmungen der Tür im ersten Stock nach dem
Turm hinüber und der Eingangstür im Hose. Da diese beiden Türen erst bei dem Neubau